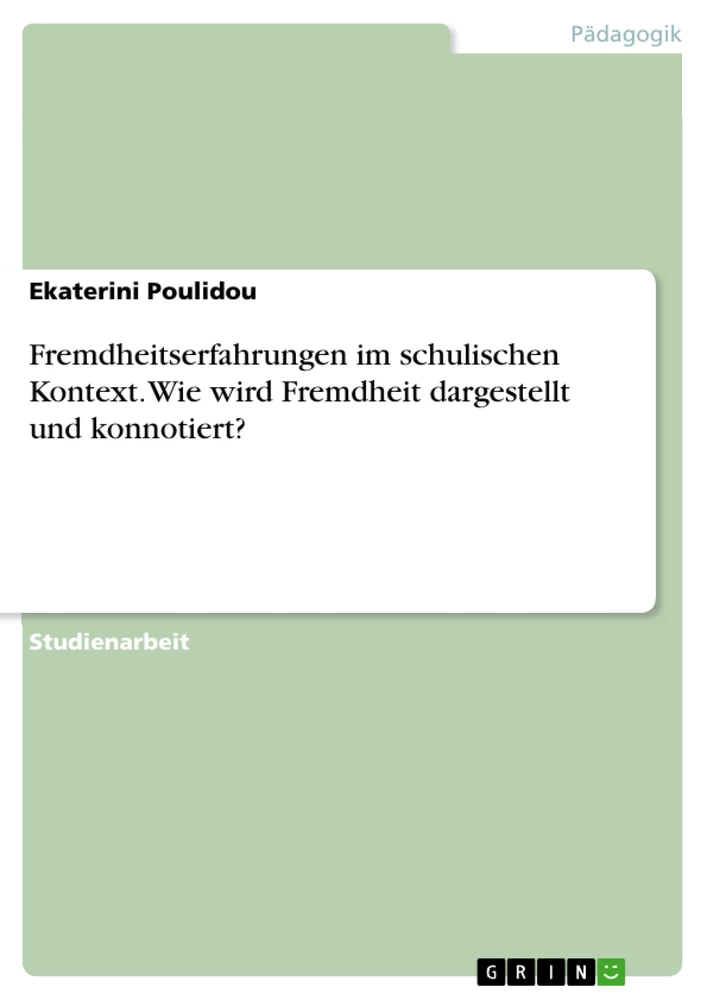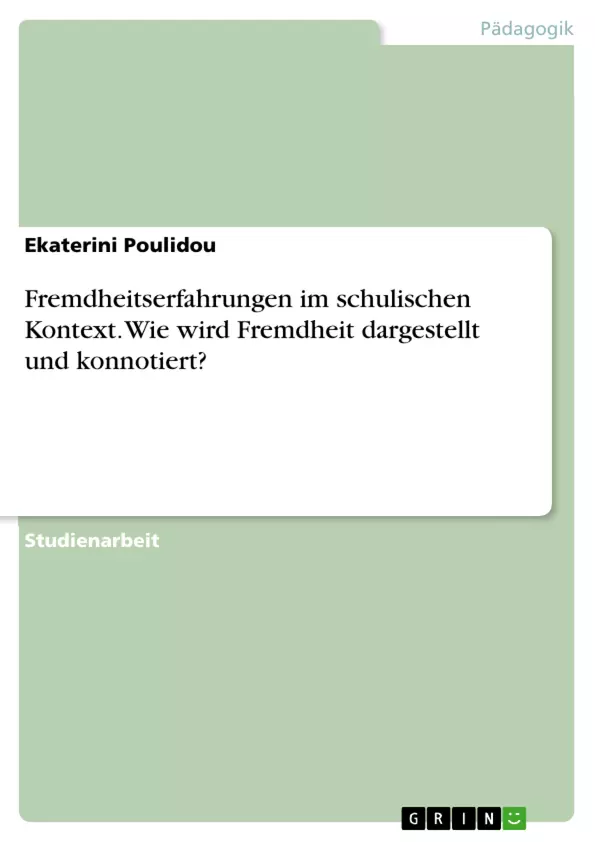Das Thema der Arbeit umfasst den umfangreicheren Themenkomplex der Fremdheitserfahrungen. Hierbei liegt der Fokus auf einer Fragestellung, die sich aus der Analyse eines Interviews vom 21. Februar 2019 ergibt, welches im Hinblick auf Fremdheitserfahrungen im schulischen Kontext durchgeführt wurde. Der analytische Teil der Arbeit erläutert, unter Berücksichtigung des theoretischen Kontextes, die Beurteilung von Fremdheit. Daraus ergibt sich die Fragestellung: Wie wird Fremdheit dargestellt und konnotiert?
Die Relevanz der Auseinandersetzung mit Rassismuskritik ergibt sich grundlegend aus der zunehmenden Institutionalisierung des kritischen Diskurses über Rassismus in modernen Gesellschaften. Dabei stehen internationale Ausschüsse wie die Europäische Kommission gegen Rassismus und Intoleranz und der UN-Ausschuss gegen Rassismus stellvertretend für die Bedeutsamkeit der Thematik in der heutigen Zeit. Diese institutionelle Verankerung von Rassismuskritik bedeutet im gleichen Maße auch, dass sich aus der bildungswissenschaftlichen Sicht eine hohe Relevanz der Thematik ergibt. Abgeleitet daraus, dass bildungswissenschaftliche Institutionen den sozialen Kontext der Gesellschaft stellvertretend abbilden, entspringt auch ihre Verantwortung für rassismuskritische Ansätze zur Kompensation von Rassismus.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Thematische Auseinandersetzung
- 3. Methodischer Zugang
- 3.1 ERHEBUNGSMETHODE
- 3.2 TRANSKRIPTION
- 3.3 AUSWERTUNGSMETHODE
- 4. Auswertung des Interviews
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert ein episodisches Interview vom 21. Februar 2019, das sich mit Fremdheitserfahrungen im schulischen Kontext auseinandersetzt. Ziel ist es, die Darstellung und Konnotation von Fremdheit im Interview zu untersuchen und im Kontext bestehender Theorien zu interpretieren.
- Darstellung und Konnotation von Fremdheit
- Theorien der Fremdheit und Zugehörigkeit
- Einfluss gesellschaftlicher Normen auf die Wahrnehmung von Fremdheit
- Individuelle und soziale Konstruktion von Fremdheit
- Reflexionsprozesse über Fremdheitserfahrungen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung begründet die Relevanz der Auseinandersetzung mit Rassismuskritik im Kontext der zunehmenden Institutionalisierung des Diskurses und hebt die bildungswissenschaftliche Verantwortung für rassismuskritische Ansätze hervor. Das zentrale Thema der Arbeit ist die Analyse von Fremdheitserfahrungen im schulischen Kontext anhand eines Interviews. Die Forschungsfrage lautet: Wie wird Fremdheit dargestellt und konnotiert?
2. Thematische Auseinandersetzung: Dieses Kapitel stellt den theoretischen Rahmen der Arbeit dar, der sich aus der Analyse des Interviews ableitet. Es werden die Ansichten verschiedener Autoren wie Paul Mecheril, Corinna Dietrich, Mark Terkessidis, Werner Bergmann, Zahra Deilami, Michel Foucault und Katharina Dietrich zu zentralen Begriffen im Zusammenhang mit Fremdheit und Zugehörigkeit vorgestellt und miteinander verknüpft. Die Kapitel erläutert unterschiedliche Perspektiven auf die Konstruktion von Normalität und Fremdheit, den Einfluss gesellschaftlicher Normen und Machtstrukturen auf die Wahrnehmung von Fremdheit und die Rolle individueller Wahrnehmungsprozesse und Interpretationen.
Schlüsselwörter
Fremdheitserfahrungen, Schule, Rassismuskritik, Interviewanalyse, Normalität, Zugehörigkeit, Identität, gesellschaftliche Normen, Machtstrukturen, Wahrnehmung, Interpretation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Analyse von Fremdheitserfahrungen im schulischen Kontext
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert ein episodisches Interview vom 21. Februar 2019, das sich mit Fremdheitserfahrungen im schulischen Kontext auseinandersetzt. Ziel ist die Untersuchung der Darstellung und Konnotation von Fremdheit im Interview und deren Interpretation im Kontext bestehender Theorien.
Welche Forschungsfrage wird behandelt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Wie wird Fremdheit dargestellt und konnotiert?
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit der Darstellung und Konnotation von Fremdheit, Theorien der Fremdheit und Zugehörigkeit, dem Einfluss gesellschaftlicher Normen auf die Wahrnehmung von Fremdheit, der individuellen und sozialen Konstruktion von Fremdheit sowie den Reflexionsprozessen über Fremdheitserfahrungen.
Welche Methoden wurden angewendet?
Die Arbeit beschreibt die angewandte Erhebungsmethode (Interview), die Transkription des Interviews und die Auswertungsmethode. Konkrete Details zu den Methoden werden im Kapitel 3 (Methodischer Zugang) erläutert.
Welche Autoren und Theorien werden herangezogen?
Die Arbeit bezieht sich auf die Ansichten verschiedener Autoren wie Paul Mecheril, Corinna Dietrich, Mark Terkessidis, Werner Bergmann, Zahra Deilami, Michel Foucault und Katharina Dietrich. Diese werden im Kapitel 2 (Thematische Auseinandersetzung) vorgestellt und im Kontext der Analyse von Fremdheit und Zugehörigkeit miteinander verknüpft.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Thematische Auseinandersetzung, Methodischer Zugang, Auswertung des Interviews und Fazit. Das Inhaltsverzeichnis bietet einen detaillierten Überblick über die einzelnen Kapitel und Unterkapitel.
Was ist das Fazit der Arbeit (ohne Spoiler)?
Das Fazit der Arbeit wird im Kapitel 5 präsentiert und fasst die zentralen Ergebnisse der Analyse zusammen. Es wird eine Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse zu der Darstellung und Konnotation von Fremdheit im untersuchten Interview liefern.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Fremdheitserfahrungen, Schule, Rassismuskritik, Interviewanalyse, Normalität, Zugehörigkeit, Identität, gesellschaftliche Normen, Machtstrukturen, Wahrnehmung, Interpretation.
Was ist der theoretische Rahmen der Arbeit?
Der theoretische Rahmen der Arbeit leitet sich aus der Analyse des Interviews ab und wird im Kapitel 2 (Thematische Auseinandersetzung) detailliert dargestellt. Er umfasst verschiedene Perspektiven auf die Konstruktion von Normalität und Fremdheit, den Einfluss gesellschaftlicher Normen und Machtstrukturen und die Rolle individueller Wahrnehmungsprozesse und Interpretationen.
Wo finde ich mehr Informationen über die Einleitung?
Die Einleitung (Kapitel 1) begründet die Relevanz der Auseinandersetzung mit Rassismuskritik im Kontext der zunehmenden Institutionalisierung des Diskurses und hebt die bildungswissenschaftliche Verantwortung für rassismuskritische Ansätze hervor. Sie führt das zentrale Thema der Arbeit, die Analyse von Fremdheitserfahrungen im schulischen Kontext, ein.
- Citation du texte
- Ekaterini Poulidou (Auteur), 2019, Fremdheitserfahrungen im schulischen Kontext. Wie wird Fremdheit dargestellt und konnotiert?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/593744