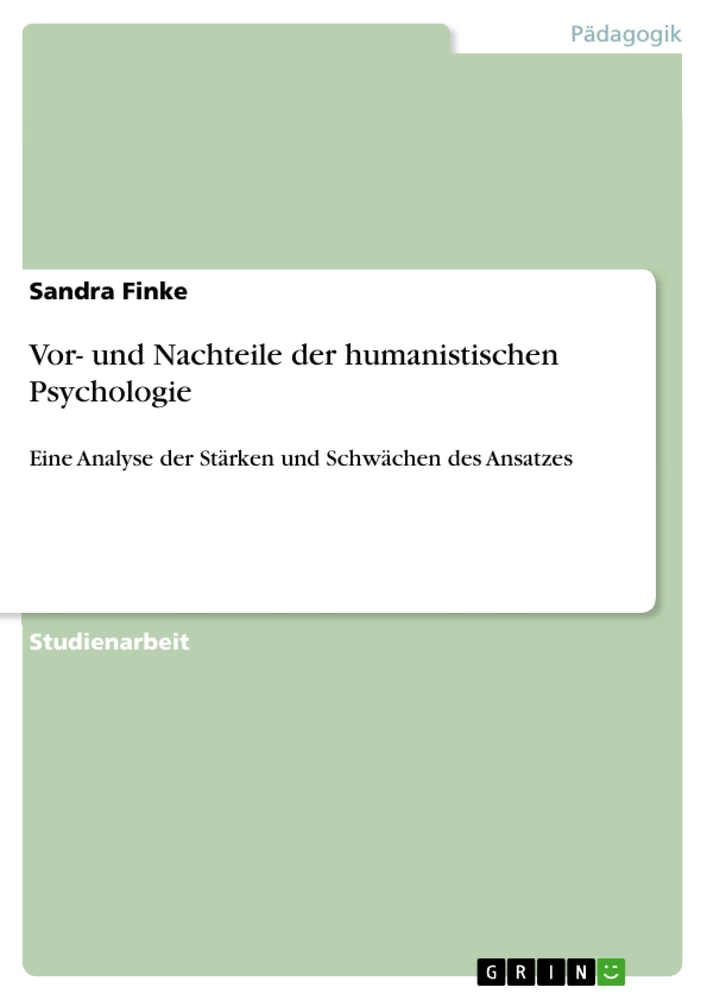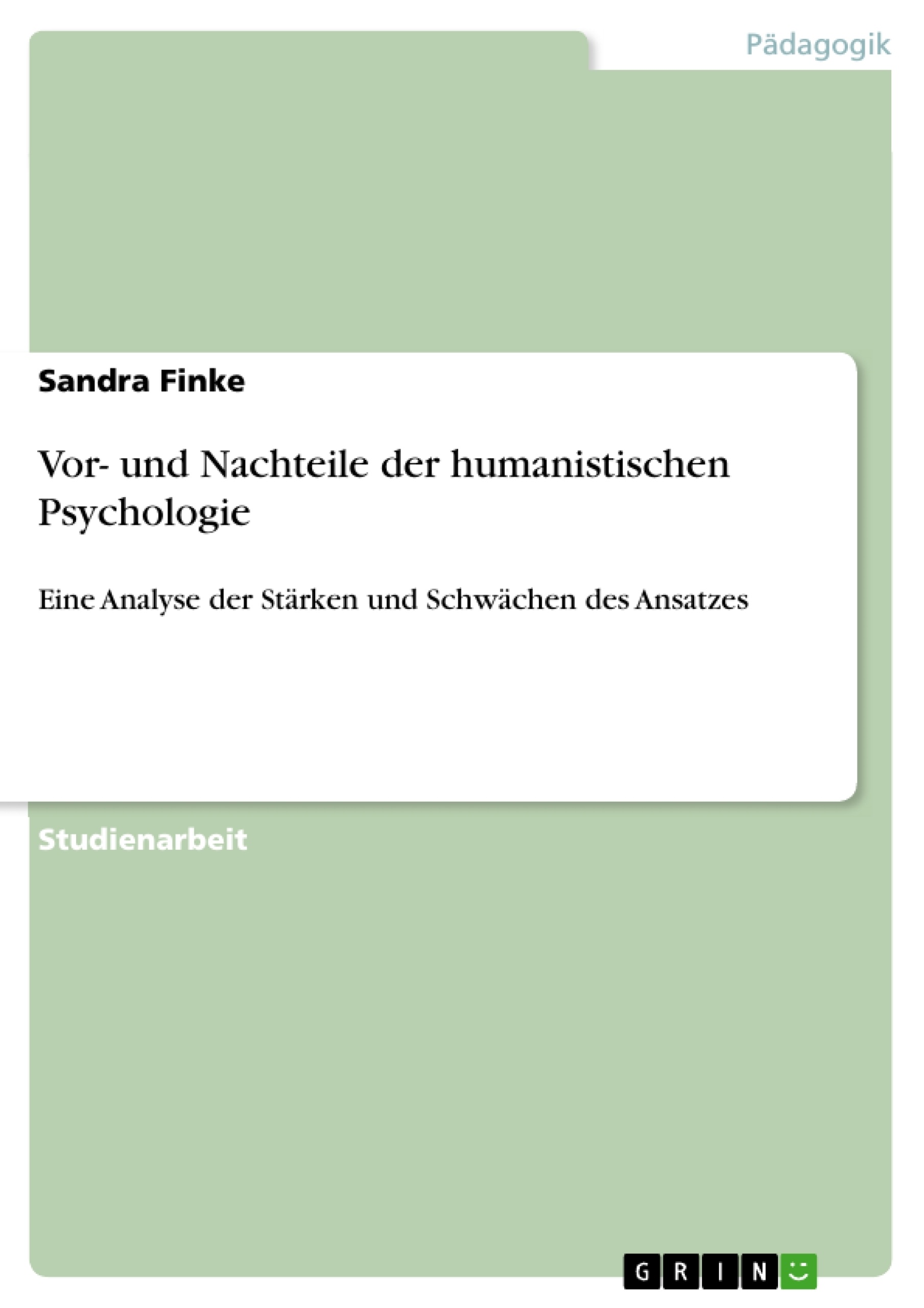Die 50er Jahre waren gekennzeichnet durch die Sorgen über die Probleme, die die zunehmende Industrialisierung noch mit sich bringen würde. Die Bürger der USA waren verunsichert über die sowjetische Konfrontation und sahen die Vormachtstellung der USA in Frage gestellt.
Viele Psychologen waren enttäuscht von der behavioristischen Entwicklung in der Psychologie und machten sich Sorgen über die psychische Situation der Zivilbevölkerung. In diesem Kontext schloss sich langsam eine Gruppe Menschen- die zukünftigen humanistischen Psychologen- zusammen, „um gemeinsam Möglichkeiten zur Lösung der drängenden Zivilisationsprobleme zu suchen und der Verdinglichung des Menschen durch die akademische Psychologie wirkungsvoll entgegenzutreten“1. Die Humanistische Psychologie setzte es sich zum Ziel, der Entmenschlichung und der Vermassung des zwanzigsten Jahrhunderts entgegenzutreten. Als Begründer sind unter anderem die Psychologen Kurt Goldstein, Carl Rogers, Erich Fromm, Abraham Maslow, John Bugental, Ruth Cohn u.v.a. zu nennen. Der Begriff „Humanistische Psychologie“ wurde jedoch erst 1955 von Cantril und 1956 dann auch von Maslow verwendet. Eine eindeutige Definition von Humanistischer Psychologie findet sich in der Literatur nicht. Sie selbst verstehen sich nicht als eine soziale Bewegung innerhalb der Psychologie, sondern als eine Denkart mit dem Ziel die Psychologie als ganzes zu bewegen. Quitmann bezeichnet sie als eine Strömung eines Zeitgeistes oder eine Bewegung. In ihr finden sich die verschiedensten philosophischen Einflüsse, unter anderem vom Marxismus, vom Buddhismus oder auch von den Schriften des alten Testaments. Sie hat aber auch psychologische Ursprünge. Hier sind vor allem zwei Richtungen zu nennen: die Tiefenpsychologie und die Gestalt- oder Ganzheitspsychologie.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Entstehung und Grundannahmen
- Stärken und Schwächen des Ansatzes
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert die Humanistische Psychologie und untersucht ihre Stärken und Schwächen. Sie beleuchtet die Entstehung und Grundannahmen des Ansatzes und zeigt, welche Kritikpunkte an dieser Schule der Psychologie geäußert werden.
- Entstehung und Entwicklung der Humanistischen Psychologie im Kontext der 50er und 60er Jahre
- Die zentralen Grundannahmen der Humanistischen Psychologie, wie beispielsweise die Betonung der menschlichen Selbstverwirklichung
- Die Stärken des Ansatzes, wie beispielsweise seine Fokussierung auf die ganzheitliche Betrachtung des Menschen
- Die Kritikpunkte an der Humanistischen Psychologie, wie beispielsweise die Schwierigkeit, ihre Grundannahmen empirisch zu belegen
- Die Relevanz des Ansatzes in der heutigen Zeit
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Entstehung und die Relevanz der Humanistischen Psychologie in den 50er Jahren vor. Sie beleuchtet den historischen Kontext und die Beweggründe für die Entwicklung dieser Strömung in der Psychologie. Die Einleitung erläutert die Notwendigkeit einer Stärken-Schwächen-Analyse der Humanistischen Psychologie.
- Entstehung und Grundannahmen: Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehungsgeschichte der Humanistischen Psychologie und ihre wichtigsten Grundannahmen. Es zeigt die Abgrenzung vom Behaviorismus und die Hinwendung zum Menschen als Ganzem auf. Zudem werden die wichtigsten Vertreter der Humanistischen Psychologie und deren Denkansätze vorgestellt.
Schlüsselwörter
Humanistische Psychologie, Stärken, Schwächen, Entstehung, Grundannahmen, Selbstverwirklichung, Ganzheit, Kritik, empirische Überprüfung, Geschichte der Psychologie, Behaviorismus, Tiefenpsychologie, Gestaltpsychologie.
- Quote paper
- Sandra Finke (Author), 2006, Vor- und Nachteile der humanistischen Psychologie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/59372