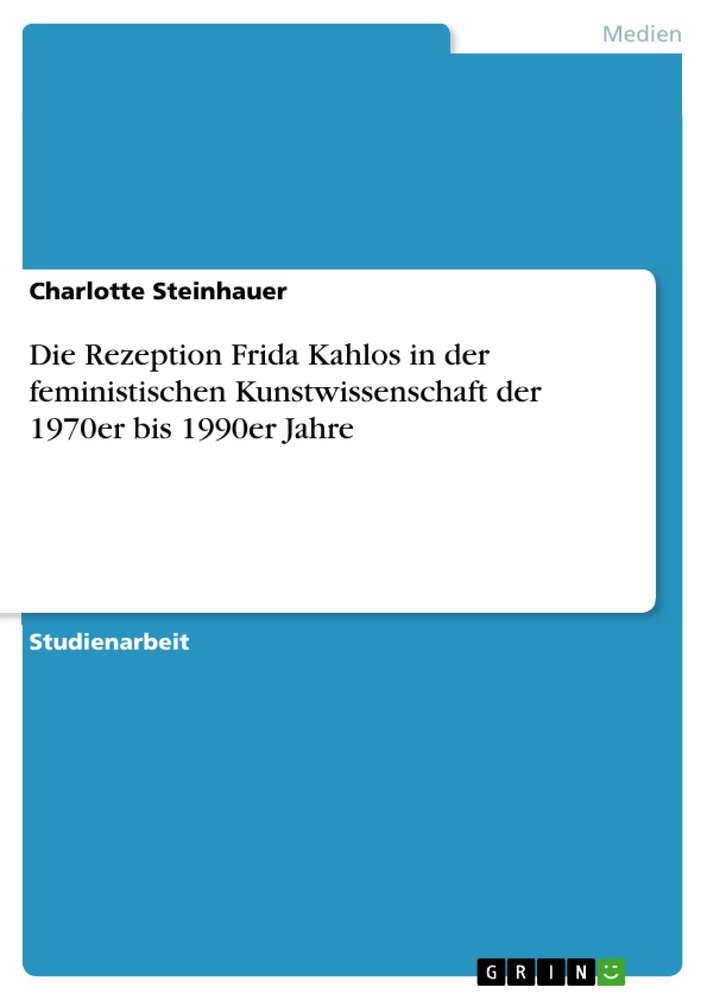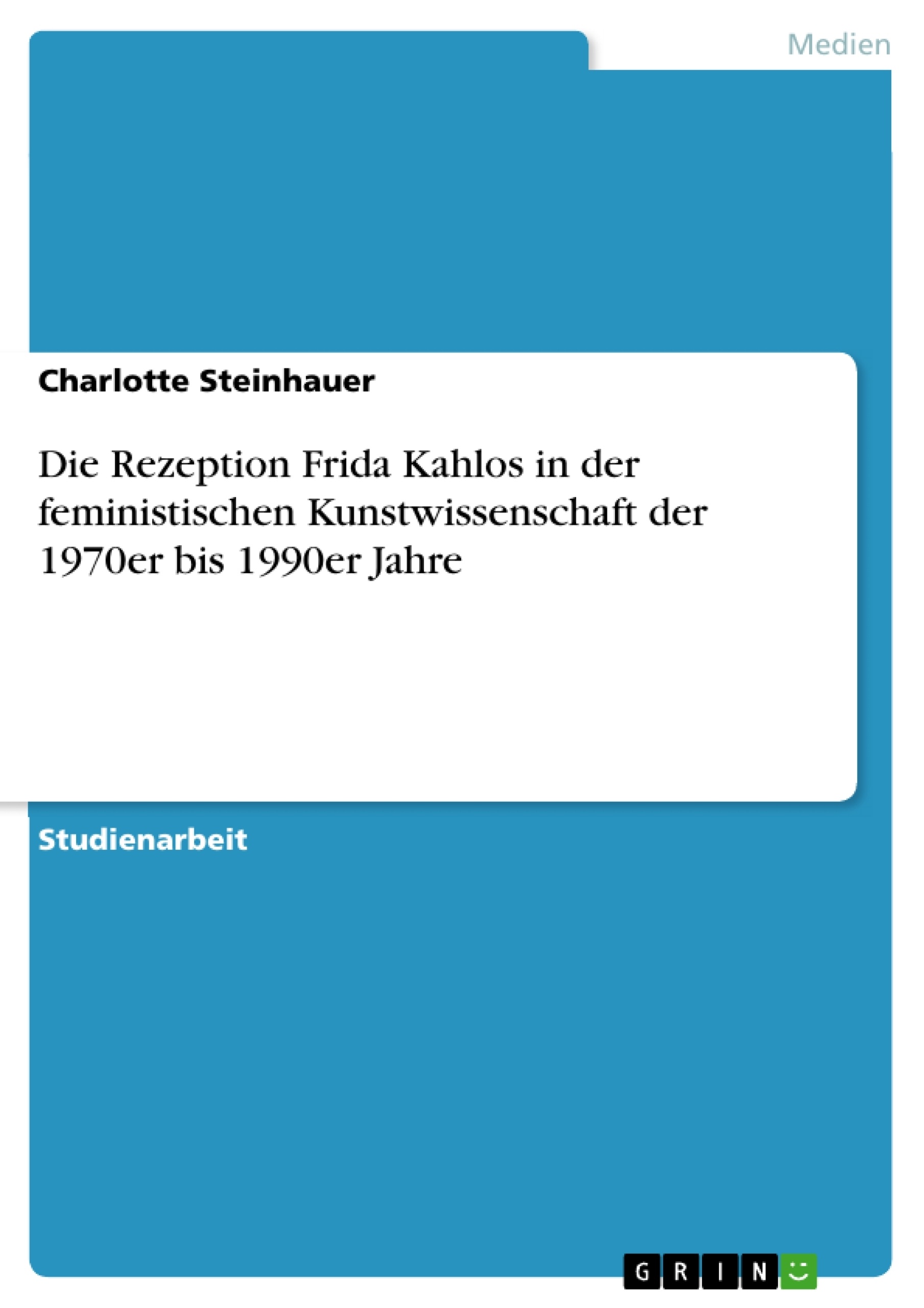Die Arbeit beschäftigt sich mit der Rezeption Frida Kahlos in der feministischen Kunstgeschichte und bezieht deren Ergebnisse auf das Phänomen des "Künstlermythos". Dabei wird die Paradoxie aufgezeigt, die zwischen dem männlich dominierten Bild des Künstlergenies und der Übernahme dieser Legende auf die feministischen Interpretationen besteht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Voraussetzungen der Rezeption
- Die diskursive Künstlerfigur
- Die Begründung des Künstlermythos
- Die frühen Quellen und ihr Beitrag zum Kahlo-Diskurs
- André Breton: Weiblichkeit und Mystik
- Betram Wolfe - Kunst und Leiden
- Der Kahlo-Diskurs im Zuge der feministischen Kunstgeschichtsforschung
- Die Entwicklung der feministischen Kunstgeschichtsschreibung im Zuge der feministischen Bewegung
- Die „Kraft des Weiblichen“ - Frida Kahlo in der feministischen Rezeption
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Rezeptionsgeschichte von Frida Kahlos Werk. Sie konzentriert sich dabei auf die Rolle des Künstlermythos und die Veränderung des Diskurses im Zuge der feministischen Kunstgeschichtsforschung. Die Arbeit verfolgt das Ziel, zu analysieren, inwiefern sich bestehende Motive der frühen Kahlo-Rezeption in den feministischen Texten wiederfinden und wie die neuen politischen und gesellschaftlichen Bedingungen den Diskurs beeinflusst haben.
- Der Künstlermythos als prägendes Element der Kunstgeschichte
- Die Rolle der frühen Texte von André Breton und Bertram Wolfe für die Entstehung des Kahlo-Diskurses
- Die feministische Kunstgeschichtsforschung und ihre Auseinandersetzung mit der Frage nach einer weiblichen Ästhetik
- Die Bedeutung der persönlichen Leidensgeschichte Frida Kahlos für die Rezeption ihres Werks
- Der Einfluss der surrealistischen Vorstellung von Weiblichkeit und Exotik auf die Interpretation von Kahlos Kunst
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die Relevanz der Rezeptionsgeschichte von Künstler*innen dar und erklärt, wie politische und gesellschaftliche Einflüsse die Interpretation von Werken beeinflussen. Sie stellt Frida Kahlo als Beispiel für die stetige Veränderung der Rezeption eines Werks und die Wichtigkeit des Diskurses vor.
Voraussetzungen der Rezeption
Dieses Kapitel erläutert die Entstehung einer diskursiven Künstlerfigur und die Folgen für die Rezeption. Es wird die Rolle des Künstlermythos in der Kunstgeschichte beleuchtet und die Bedeutung des Aufstiegs des Künstlers vom Handwerker zum Genie hervorgehoben.
Die frühen Quellen und ihr Beitrag zum Kahlo-Diskurs
Dieses Kapitel behandelt zwei maßgebliche Texte, die die Kahlo-Rezeption nachhaltig beeinflusst haben: André Bretons Essay über Frida Kahlo und Bertram Wolfes Artikel für Vogue. Es werden Bretons surrealistische Sichtweise auf Kahlos Werk und Wolfes Fokus auf ihre Leidensgeschichte und ihre Verbindung zu Diego Rivera analysiert.
Der Kahlo-Diskurs im Zuge der feministischen Kunstgeschichtsforschung
Dieses Kapitel beleuchtet die Entwicklung der feministischen Kunstgeschichtsforschung und ihre Einfluss auf die Rezeption von Frida Kahlos Werk. Es werden die Thesen verschiedener feministischer Autorinnen untersucht und ihre Interpretationen von Kahlos Kunst als Ausdruck weiblicher Sensibilität, kultureller Konstruktion von Geschlecht und persönlicher Leidensgeschichte vorgestellt.
Schlüsselwörter
Der Kahlo-Diskurs, Künstlermythos, feministische Kunstgeschichte, Weiblichkeit, Exotik, Leid, Surrealismus, Rezeptionsgeschichte, Diskursanalyse, Frida Kahlo, André Breton, Bertram Wolfe, Gloria Orenstein, Lucy Lippard, Whitney Chadwick, mexicanidad, Mutterschaft, Kinderlosigkeit, psycho-biografische Interpretationsweise.
- Quote paper
- Charlotte Steinhauer (Author), 2018, Die Rezeption Frida Kahlos in der feministischen Kunstwissenschaft der 1970er bis 1990er Jahre, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/591000