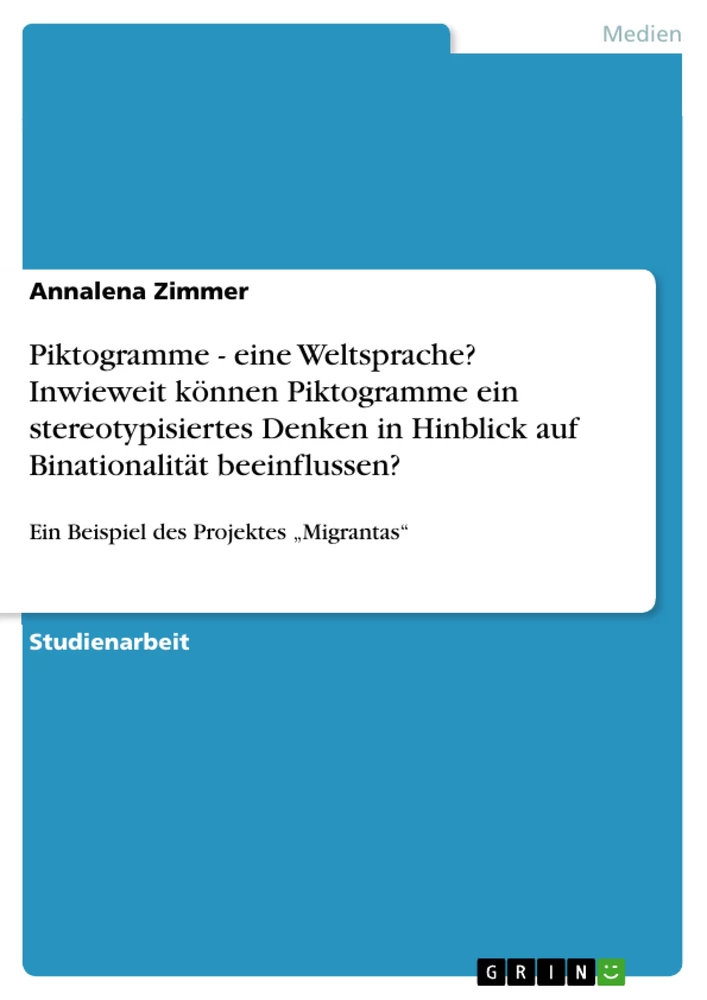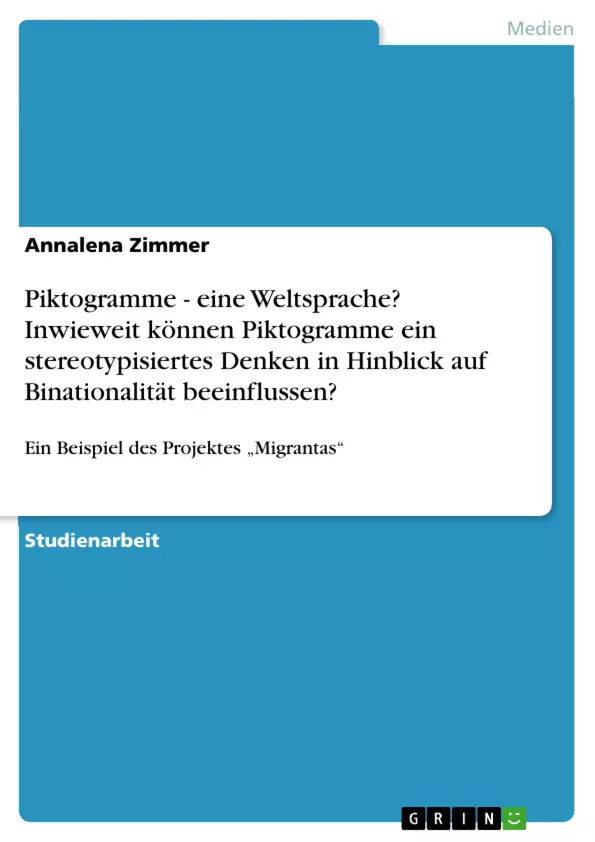Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Frage „Piktogramme - eine Weltsprache? Inwieweit können Piktogramme ein stereotypisiertes Denken in Hinblick auf Binationalität beeinflussen? Ein Beispiel des Projektes „Migrantas“. Dabei wird zunächst aufgeführt, wer oder was grundlegend als „fremd“ gilt, inwiefern dabei die Identitätsbildung eine Rolle spielt und welche Rolle die soziale Gruppe innerhalb dieses Prozesses einnimmt. Zudem wird unter diesem Aspekt der Begriff „Binationalität“ aufgeführt, da dieser ein elementares Gefühl von Menschlichkeit versprachlicht.
In einem darauf folgenden Schritt wird gezeigt, in welchem Rahmen Vorurteile und stereotypisiertes Denken von Bedeutung sind, denn wo Angst vor dem „Fremden“ herrscht, können auch Vorurteile und ein stereotypisiertes Denken bzw. Handeln an Überhand gewinnen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Wer ist fremd?
- 1.1 Identitätsbildung
- 1.2 Soziale Gruppen
- 1.3 Binationalität
- 2. Vorurteile und stereotypisiertes Denken
- 2.1 Definition
- 2.2 Auswirkungen
- 3. Piktogramme
- 3.1 Definition
- 3.2 Funktionen
- 4. Projekt „Migrantas“
- 4.1 Gründung und Idee
- 4.2 Vorgehensweise
- 4.3 Ziele
- 5. Theoretische Grundlage
- 6. Analyse
- 7. Ergebnis
- 8. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einfluss von Piktogrammen auf stereotypisiertes Denken im Kontext von Binationalität, am Beispiel des Projekts „Migrantas“. Die Arbeit beleuchtet zunächst das Konzept von „Fremdheit“, die Rolle der Identitätsbildung und sozialer Gruppen, und definiert den Begriff der Binationalität. Anschließend werden Vorurteile und stereotypisiertes Denken im Zusammenhang mit „Fremdheit“ diskutiert. Die Arbeit analysiert die Funktion von Piktogrammen und untersucht, wie diese stereotypisiertes Denken beeinflussen können.
- Das Konzept von „Fremdheit“ und seine Auswirkungen
- Die Rolle der Identitätsbildung und sozialer Gruppen
- Der Einfluss von Vorurteilen und stereotypisiertem Denken
- Die Funktion und Bedeutung von Piktogrammen
- Eine Analyse des Projekts „Migrantas“
Zusammenfassung der Kapitel
1. Wer ist fremd?: Dieses Kapitel erörtert den vielschichtigen Begriff der Fremdheit. Es beginnt mit der These, dass Fremdheit eine Bereicherung darstellen kann, relativiert dies jedoch durch die Gegenüberstellung von Begriffen wie Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Das Kapitel untersucht die Ursprünge des Gefühls der Fremdheit, indem es die Rolle des Unbekannten, des individuellen Hintergrunds und kultureller Unterschiede beleuchtet. Angst und Faszination als mögliche Reaktionen auf das Fremde werden ebenfalls thematisiert. Die Komplexität des Gefühls der Fremdheit und seine Ambivalenz bilden den zentralen Punkt dieses einführenden Kapitels.
1.1 Identitätsbildung: Die Identitätsbildung wird unter Bezugnahme auf George Herbert Meads Theorie des „I“, „Me“ und „Self“ erläutert. Das Kapitel betont die Bedeutung von Interaktion und Kommunikation für die Entwicklung der Identität und verdeutlicht die Herausforderungen, die sich für Migranten ergeben, wenn von ihnen eine klare Identitätsfestlegung erwartet wird, die für sie selbst möglicherweise nicht eindeutig ist. Der Fokus liegt auf der sozialen Konstruktion der Identität und den damit verbundenen Erwartungen der Gesellschaft.
1.2 Soziale Gruppen: Dieses Kapitel befasst sich mit der Rolle sozialer Gruppen bei der Identitätsbildung. Es wird die Bedeutung der Zugehörigkeit zu einer Gruppe für das Selbstkonzept hervorgehoben und die Funktion von sozialen Gruppen als Bezugspunkt für die Selbstreflexion und den Vergleich der eigenen Weltanschauung mit der anderer betont. Es wird darauf hingewiesen, dass soziale Gruppen nicht homogen sind, sondern durch ein gemeinsames Zugehörigkeitsgefühl und ähnliche Werte verbunden sind.
1.3 Binationalität: Das Kapitel definiert den Begriff der Binationalität als Ausdruck der Zwiespältigkeit, die aus der Frage nach der Zugehörigkeit entsteht. Die Komplexität dieses Begriffs und seine Anwendung auf verschiedene Personengruppen werden angesprochen, womit die Vielschichtigkeit der Identitätsfindung in binationalen Kontexten im Fokus steht.
Schlüsselwörter
Piktogramme, stereotypisiertes Denken, Binationalität, Identitätsbildung, soziale Gruppen, Vorurteile, Fremdheit, Projekt Migrantas, Semiotik, Interkulturalität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse von Piktogrammen und stereotypisiertem Denken im Kontext von Binationalität
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit untersucht den Einfluss von Piktogrammen auf stereotypisiertes Denken, insbesondere im Kontext von Binationalität. Sie analysiert das Projekt „Migrantas“ als Fallbeispiel.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in acht Kapitel: 1. Wer ist fremd? (inkl. Unterkapitel zu Identitätsbildung, sozialen Gruppen und Binationalität), 2. Vorurteile und stereotypisiertes Denken, 3. Piktogramme, 4. Projekt „Migrantas“, 5. Theoretische Grundlage, 6. Analyse, 7. Ergebnis und 8. Fazit.
Was sind die zentralen Themen der Arbeit?
Die zentralen Themen sind das Konzept der Fremdheit, Identitätsbildung und die Rolle sozialer Gruppen, Vorurteile und stereotypisiertes Denken, die Funktion von Piktogrammen und eine detaillierte Analyse des Projekts „Migrantas“.
Wie wird der Begriff „Fremdheit“ in der Arbeit behandelt?
Das Kapitel „Wer ist fremd?“ beleuchtet die Vielschichtigkeit des Begriffs „Fremdheit“, die Ambivalenz zwischen Angst und Faszination und die Rolle des Unbekannten, des individuellen Hintergrunds und kultureller Unterschiede. Rassismus und Fremdenfeindlichkeit werden als Gegenpole betrachtet.
Welche Rolle spielt die Identitätsbildung?
Die Identitätsbildung wird anhand von Meads Theorie des „I“, „Me“ und „Self“ erläutert. Die Arbeit betont die Herausforderungen für Migranten, die mit einer eindeutigen Identitätsfestlegung konfrontiert werden, welche für sie selbst nicht immer eindeutig ist.
Wie werden soziale Gruppen in der Arbeit berücksichtigt?
Die Arbeit hebt die Bedeutung sozialer Gruppen für die Identitätsbildung und Selbstreflexion hervor. Es wird betont, dass soziale Gruppen nicht homogen sind, sondern durch gemeinsame Zugehörigkeit und ähnliche Werte verbunden sind.
Was versteht die Arbeit unter Binationalität?
Binationalität wird als Ausdruck der Zwiespältigkeit definiert, die aus der Frage nach der Zugehörigkeit entsteht. Die Komplexität des Begriffs und seine Anwendung auf verschiedene Personengruppen werden hervorgehoben.
Welche Rolle spielen Piktogramme in der Arbeit?
Die Arbeit analysiert die Funktion von Piktogrammen und untersucht, wie diese stereotypisiertes Denken beeinflussen können. Die Bedeutung von Piktogrammen im Kontext von Interkulturalität wird thematisiert.
Was ist das Projekt „Migrantas“?
Das Projekt „Migrantas“ dient als Fallbeispiel, um die Auswirkungen von Piktogrammen auf stereotypisiertes Denken zu untersuchen. Die Arbeit beschreibt die Gründung, die Vorgehensweise und die Ziele des Projekts.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Piktogramme, stereotypisiertes Denken, Binationalität, Identitätsbildung, soziale Gruppen, Vorurteile, Fremdheit, Projekt Migrantas, Semiotik, Interkulturalität.
- Citation du texte
- Annalena Zimmer (Auteur), 2016, Piktogramme - eine Weltsprache? Inwieweit können Piktogramme ein stereotypisiertes Denken in Hinblick auf Binationalität beeinflussen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/590688