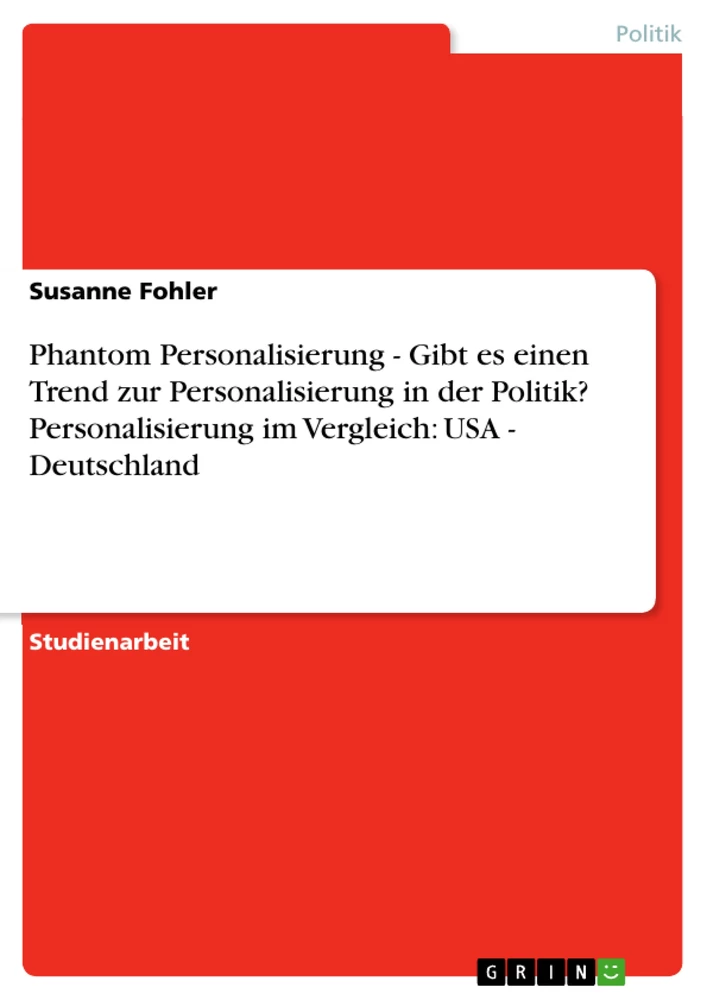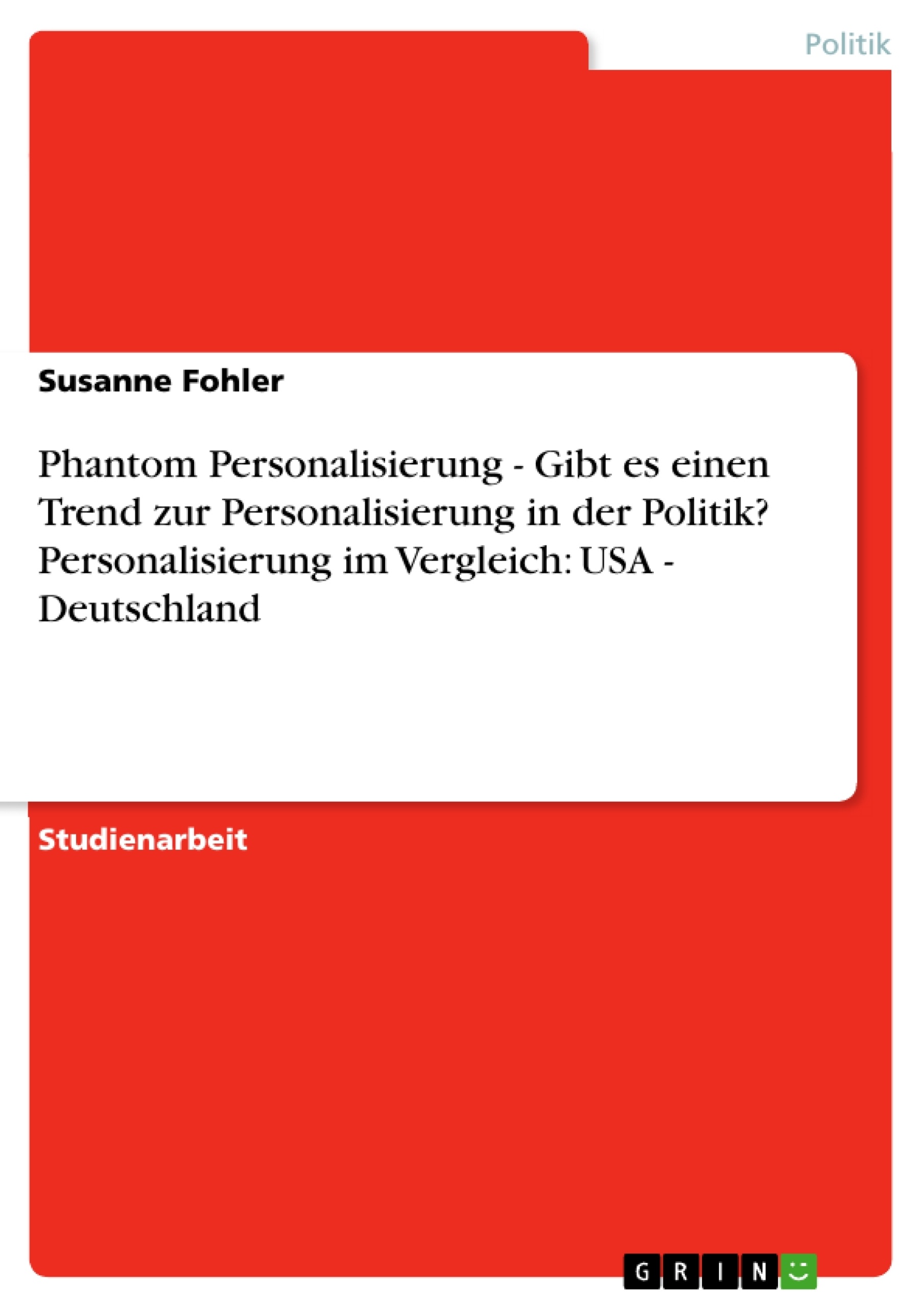Die neunziger Jahre brachten in mehreren westlichen Demokratien das Ende einer konservativen Regierungsära. In den Vereinigten Staaten wurde 1992 der Demokrat Bill Clinton nach 12 Jahren republikanischer Präsidentschaft zum Präsidenten gewählt. In Großbritannien errang New Labour mit Tony Blair nach 18 Jahren konservativer Regierung einen erdrutschartigen Sieg. In Deutschland beendete die SPD nach 16 Jahren Helmut Kohl-Regierung die Vorherrschaft von CDU/CSU. Mit Gerhard Schröder erreichte die SPD zum zweiten Mal seit Bestehen der Bundesrepublik mehr Stimmen als die Union.
Alle drei Wahlsiege waren gewaltig und alle drei waren zumindest auch Folge gelungener professioneller und personalisierter Wahlkampagnen. Alle drei Spitzenkandidaten galten als mediengewandt und telegen, und präsentierten sich als Modernisierer. Ihre Kampagnen zielten vor allem auf die Akquisition der Wechselwähler. Die Parallelität der Ereignisse sorgte für ähnliche Erklärungen des Wahlausgangs: die Wähler wollten nicht nur einen Regierungs-, sondern auch einen Politikwechsel. Jedes der drei Duelle (Clinton gegen Bush, Blair gegen Major, Schröder gegen Kohl) wird als Bestätigung für die in den letzten Jahren immer wieder postulierte "Personalisierung der Politik" herangezogen (Brettschneider 2002, 13f; Klein/Ohr 2000, S. 199f).
Unter Personalisierung von Politik werden zwei Dimensionen gefasst. Zum einen stehen immer stärker die Kandidaten und immer weniger die Parteien im Mittelpunkt der Wahlkampagnen und im Mittelpunkt der Medienberichterstattung. Wahlkampf wird immer mehr auf Personen zugeschnitten: der Kandidat wird zur Hauptbotschaft der Partei. Diese Dimension der Personalisierung wird auch als allgemeine oder globale Personalisierung bezeichnet (Lass 1995, 10). Zum anderen werden persönliche Charakteristika der Kandidaten wichtiger als politische Positionen (Klein/Ohr 2000, 2001, 94). Letzteres wird auch als spezifische Personalisierung bezeichnet (Lass 1995, 10).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretischer Rahmen: Warum Personalisierung?
- Institutionelle Rahmenbedingungen
- Sozialer Wandel: Dealignment, Wechselwähler, Komplexität
- Massenmedien: Zur Rolle des Fernsehens
- Empirischer Teil
- Personalisierung der Wahlkampfführung
- Personalisierung der Medienberichterstattung
- Personalisierung des Wählerverhaltens
- Zusammenfassung
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit vergleicht das Phänomen der Personalisierung in US-amerikanischen und deutschen Wahlkämpfen. Sie untersucht, ob eine Zunahme der Personalisierung von Wahlkampfstrategien und -verhalten festzustellen ist, ob der Grad der Personalisierung in den USA höher ist als in Deutschland und welche Rolle dieser Trend – falls existent – in den sich seit 1990 verändernden Wahlkämpfen spielt.
- Vergleich der Personalisierung von Wahlkampfstrategien in den USA und Deutschland
- Analyse des Einflusses institutioneller Rahmenbedingungen auf die Personalisierung
- Untersuchung des Zusammenhangs zwischen sozialem Wandel (z.B. Wechselwähler) und Personalisierung
- Bewertung der Rolle der Massenmedien, insbesondere des Fernsehens, bei der Personalisierung
- Auswertung empirischer Studien zu den verschiedenen Dimensionen der Personalisierung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die These auf, dass die Wahlsiege von Clinton, Blair und Schröder zumindest teilweise auf erfolgreiche, personalisierte Wahlkampagnen zurückzuführen sind. Sie führt die beiden Dimensionen der Personalisierung ein: die globale Personalisierung (Fokus auf Kandidaten statt Parteien) und die spezifische Personalisierung (Bedeutung persönlicher Charakteristika). Die Arbeit fragt nach einem möglichen Trend zur zunehmenden Personalisierung und deren Ausprägung im Vergleich zwischen den USA und Deutschland.
Theoretischer Rahmen: Warum Personalisierung?: Dieses Kapitel untersucht die institutionellen Rahmenbedingungen in den USA und Deutschland im Hinblick auf ihre Förderung der Personalisierung. Es diskutiert den Einfluss des amerikanischen Präsidialsystems im Vergleich zum deutschen System. Weiterhin werden Erklärungsansätze für die zunehmende Personalisierung erörtert, wie die wachsende Komplexität des politischen Geschehens und der Anstieg der Wechselwähler. Schließlich wird die bedeutende Rolle des Fernsehens als Medium bei der Personalisierung beleuchtet, inklusive der Analyse früherer Beispiele von Personalisierung im Wahlkampf.
Empirischer Teil: Dieser Teil wertet empirische Studien zum Thema Personalisierung aus, gegliedert nach den drei Dimensionen der Personalisierung nach Brettschneider (2002): Personalisierung der Wahlkampfführung, Personalisierung der Medienberichterstattung und Personalisierung des Wählerverhaltens. Für jede Dimension werden die Ergebnisse relevanter Studien vorgestellt, um ein umfassendes Bild der empirischen Befunde zu liefern.
Schlüsselwörter
Personalisierung, Wahlkampf, Medien, USA, Deutschland, Wahlverhalten, Institutionen, Sozialer Wandel, Wechselwähler, Fernsehen, Medienberichterstattung, Wahlkampfstrategien, Präsidialsystem.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Personalisierung in US-amerikanischen und deutschen Wahlkämpfen
Was ist das Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht das Phänomen der Personalisierung in US-amerikanischen und deutschen Wahlkämpfen. Sie vergleicht den Grad der Personalisierung in beiden Ländern und analysiert deren Einfluss auf den Wahlkampfverlauf seit 1990.
Welche Aspekte der Personalisierung werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet die Personalisierung auf drei Ebenen: die Personalisierung der Wahlkampfstrategien, die Personalisierung der Medienberichterstattung und die Personalisierung des Wählerverhaltens. Dabei wird zwischen globaler Personalisierung (Fokus auf Kandidaten statt Parteien) und spezifischer Personalisierung (Bedeutung persönlicher Charakteristika) unterschieden.
Welche Forschungsfragen werden behandelt?
Die zentralen Forschungsfragen sind: Gibt es eine Zunahme der Personalisierung von Wahlkampfstrategien und -verhalten? Ist der Grad der Personalisierung in den USA höher als in Deutschland? Welche Rolle spielt dieser Trend in den sich verändernden Wahlkämpfen?
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verwendet einen komparativen Ansatz, der US-amerikanische und deutsche Wahlkämpfe vergleicht. Der empirische Teil stützt sich auf die Auswertung bestehender empirischer Studien zu den verschiedenen Dimensionen der Personalisierung nach Brettschneider (2002).
Welche Faktoren beeinflussen die Personalisierung?
Die Arbeit untersucht den Einfluss institutioneller Rahmenbedingungen (z.B. Präsidialsystem vs. parlamentarisches System), den Einfluss des sozialen Wandels (z.B. Dealignment, Wechselwähler, Komplexität des politischen Geschehens) und die Rolle der Massenmedien, insbesondere des Fernsehens.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen theoretischen Rahmen, einen empirischen Teil, eine Zusammenfassung und ein Resümee. Der theoretische Rahmen beleuchtet die Gründe für Personalisierung, während der empirische Teil die Ergebnisse relevanter Studien präsentiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Personalisierung, Wahlkampf, Medien, USA, Deutschland, Wahlverhalten, Institutionen, Sozialer Wandel, Wechselwähler, Fernsehen, Medienberichterstattung, Wahlkampfstrategien, Präsidialsystem.
Was ist die zentrale These der Arbeit?
Die Arbeit geht von der These aus, dass die Wahlsiege von Clinton, Blair und Schröder zumindest teilweise auf erfolgreiche, personalisierte Wahlkampagnen zurückzuführen sind. Sie untersucht, ob ein Trend zu zunehmender Personalisierung besteht und wie dieser sich in den USA und Deutschland ausprägt.
- Quote paper
- Susanne Fohler (Author), 2006, Phantom Personalisierung - Gibt es einen Trend zur Personalisierung in der Politik? Personalisierung im Vergleich: USA - Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/58809