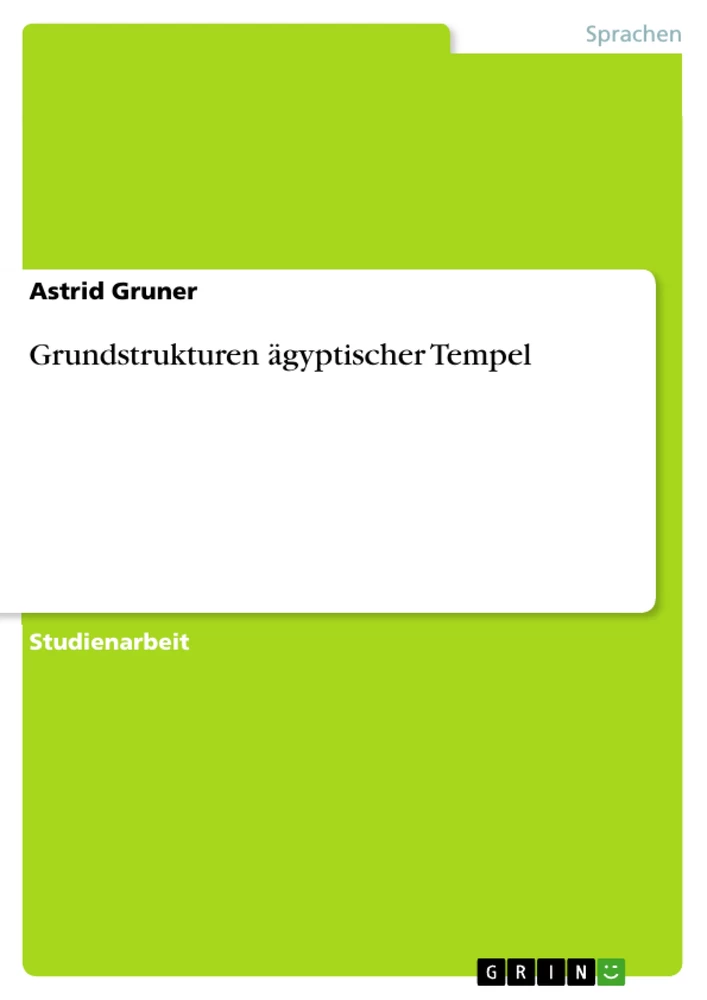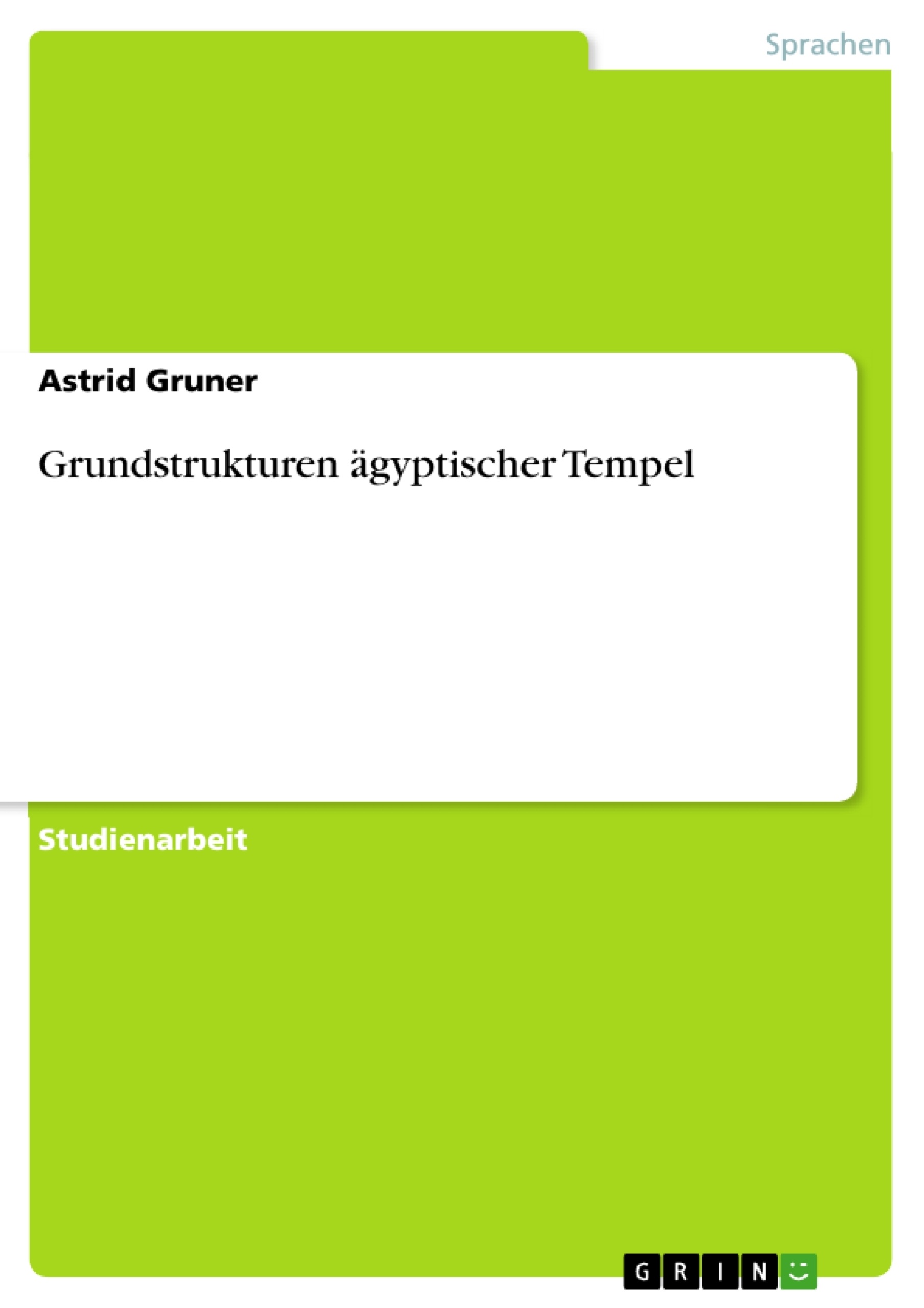Beschreibungen der einzelnen Tempel Ägyptens gibt es heute in vielfältiger und detaillierter Form. Doch diese Arbeit wird sich mit den Grundstrukturen der Tempel beschäftigen. Mit den typischen Merkmalen, die alle miteinander verbinden. Dabei soll das bereits im Referat Vorgetragene vertieft, an einzelnen Beispielen erläutert und mit Abbildungen veranschaulicht werden. Unter einem Tempel verstehen wir Menschen des 21. Jahrhunderts ein sakrales Bauwerk. Das taten auch die Ägypter, doch für sie war es mehr als das. Sie sahen es als Abbild der Welt, des Kosmos und als Wohnung, für die von ihnen verehrten Götter. Dabei hatte der Tempel zwei Funktionen: Die der Götterwohnung (ḥwt-nr) und die des Wirtschaftsbetriebes (pr). Diese Doppelfunktion wird auch noch in ihrer Bedeutung abgestuft, da die Götterwohnung neben den Gräbern die einzigen Gebäude in Ägypten waren, die aus Stein erbaut wurden. Der Wirtschaftsbetrieb, der die Götterwohnung umgebende Gebäudeteil, wird aus Ziegeln errichtet.1Der Bedeutungsunterschied wird noch deutlicher im Vergleich zu den einfachen Wohnhäusern, die aus Lehm und Holz gefertigt wurden. Wie so vieles im Alten Ägypten geht auch der Tempelbau auf einen Mythos, in diesem Fall den Gründungsmythos zurück. Dieser besagt, dass aus dem Urmeer, dem Nun, eine kleine Lehminsel auftauchte und ein halbgöttliches Wesen ein vom Wasser angetriebenes Stück Schilfrohr in diese hineinsteckte. Auf diesem entstandenen „Pfosten“ ließ sich in der damals herrschenden Dunkelheit ein Falke nieder, wodurch dieser Ort zu einer „heiligen Stätte“ wurde. Um ihn von der profanen Welt abzuschirmen, wurde er mit einem einfachen Schilfzaun eingefriedet. Bei absinkendem Wasser wurde mehr Platz auf der Lehminsel freigegeben und es kamen weitere Kammern vor und neben dem Allerheiligsten, der Götterwohnung, hinzu. Von diesem nun entstandenen Tempel, mehr noch vom Allerheiligsten, erhofften sich die Ägypter die Gegenwart des residierenden Gottes, seine segnenden und vor allem fruchtbringenden und Leben erneuernden Kräfte. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Allgemeines
- Tempelentwicklung
- Vorzeitliche Tempelbauten
- Altes Reich
- Mittleres Reich
- Neues Reich
- 3. Zwischenzeit und Spätzeit
- Ptolemäer- und Römerzeit
- Tempelaufbau
- Pr - Der Äußere Tempelbereich
- ḥw.t-nor - Die Götterwohnung
- Dekoration, Bildprogramm und Bedeutung
- Tempeldeutung nach Jan Assmann
- Zusammenfassung
- Abbildungen
- Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Referat zielt darauf ab, die Grundstrukturen ägyptischer Tempel zu beleuchten und die typischen Merkmale zu analysieren, die alle Tempelbauten verbinden. Es werden einzelne Beispiele vorgestellt und mit Abbildungen veranschaulicht, um ein umfassendes Verständnis der Tempelarchitektur zu vermitteln.
- Entwicklung der Tempelarchitektur über verschiedene Epochen
- Der Einfluss des Gründungsmythos auf den Tempelbau
- Die Doppelfunktion des Tempels als Götterwohnung und Wirtschaftsbetrieb
- Die Bedeutung der Dekoration, des Bildprogramms und der rituellen Praktiken im Tempel
- Die Interpretation von Tempeln nach Jan Assmann
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Das Referat beschreibt den Fokus auf die Grundstrukturen ägyptischer Tempel und die typischen Merkmale, die alle verbinden.
- Allgemeines: Der Begriff "Tempel" im alten Ägypten umfasste mehr als nur ein sakrales Gebäude. Er repräsentierte die Welt und den Kosmos und diente als Wohnung für die Götter. Der Tempel hatte zwei Funktionen: die der Götterwohnung und die des Wirtschaftsbetriebs. Der Bedeutungsunterschied zeigt sich auch in der Materialwahl: Die Götterwohnung wurde aus Stein gebaut, der Wirtschaftsbereich aus Ziegeln. Der Text bezieht sich dabei auf den Gründungsmythos, der die Entstehung des ersten Tempels als "heiligen Ort" beschreibt, wo sich der Gott niederließ.
- Tempelentwicklung: Dieses Kapitel beleuchtet die verschiedenen Bauformen von Tempeln in den verschiedenen Epochen. Im Alten Reich dominierte der Pyramidentempel, im Mittleren und Neuen Reich der Umgangs- und Achsentempel. Ab der 3. Zwischenzeit bis Ende der Spätzeit gab es durch fremde Einflüsse keine klare Linie im Baustil. Ab der 30. Dynastie entwickelte sich der griechisch-römische Baustil.
- Vorzeitliche Tempelbauten: Das Kapitel beschreibt den frühesten Beweis für religiöse Strukturen in Afrika, gefunden in Nabta. Es diskutiert auch drei vorzeitliche Bautypen in Ägypten: den Pr-wr in Hierakonpolis, den Pr-nsr in Buto und die Sḥ-nor, die als "Götterhütte" bezeichnet wurde. Des Weiteren werden Grabanlagen in Abydos aus der Frühzeit beschrieben, die eine sakrale Funktion hatten.
- Altes Reich: Das Kapitel beschreibt die Entwicklung der Pyramidenanlage im Alten Reich, bestehend aus einem Taltempel, einem Aufweg und einem Totentempel. Im Vergleich zu den Heiligtümern der Götter entwickelten sich die königlichen Totentempel zu immer gewaltigeren Anlagen.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Fokusthemen des Referats sind: altägyptische Tempel, Tempelarchitektur, Götterwohnung, Wirtschaftsbetrieb, Gründungsmythos, Tempelentwicklung, vorzeitliche Tempelbauten, Pyramidentempel, Umgangstempel, Achsentempel, Dekoration, Bildprogramm, rituelle Praktiken, Jan Assmann.
- Quote paper
- Astrid Gruner (Author), 2006, Grundstrukturen ägyptischer Tempel, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/58661