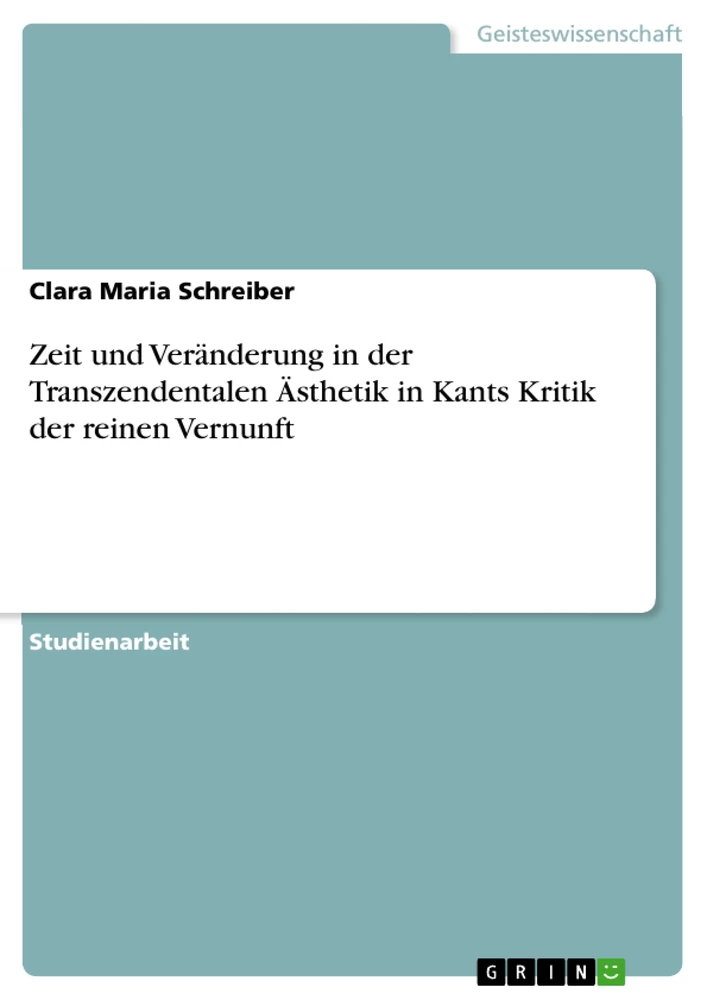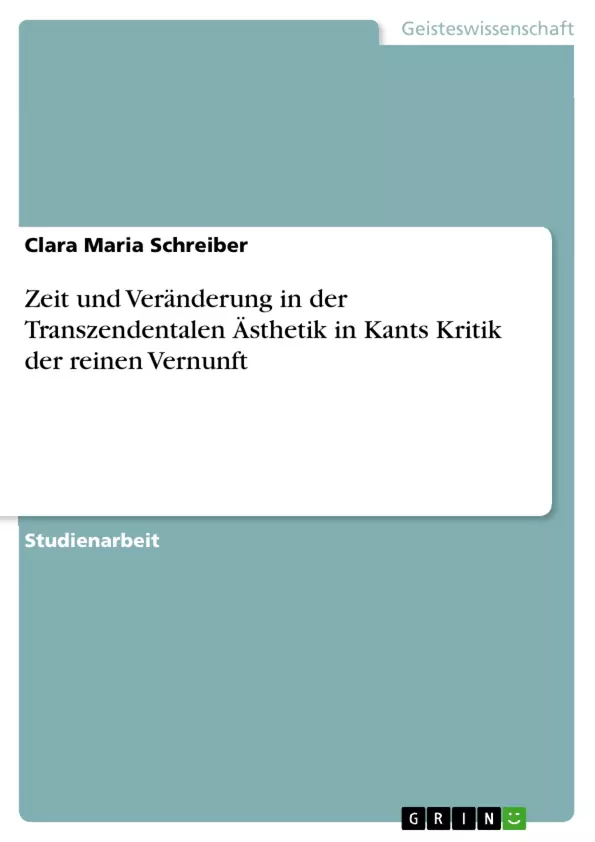Immanuel Kant (1724-1804) begründet mit seinem ersten Hauptwerk „Kritik der reinen Vernunft“ ein neues Denken in der theoretischen Philosophie. Die Metaphysik seiner Zeit befindet sich in einer Krise: Rationalismus und Empirismus stehen sich erbittert gegenüber. Keiner der Vertreter dieser philosophischen Strömungen vermag in Kants Augen die Fragen der Metaphysik - Fragen nach der Unsterblichkeit der Seele, nach der Existenz Gottes, nach der Freiheit etc. - hinreichend zu beantworten. Beide Wege sind für Kant problematisch. Den Rationalisten, deren Ansicht nach sämtliches Wissen der Menschen einzig und allein der Ratio, unabhängig von jeglicher Erfahrung entspringt, kommt Kant entgegen, indem er angeborene Erkenntnis-Bedingungen zugesteht. Den Empiristen, in deren Augen sämtliches Wissen einzig der Erfahrung entnommen wird, gesteht er zu, dass der Mensch einzelne Erkenntnis erst in Ansehung der Dinge um ihn herum gewinnt, allerdings nur mit Hilfe der Einordnung dieser in die Verstandeskategorien als Erkenntnis-Bedingungen. Kant konzipiert eine kritische Philosophie, die auf einer Zweistämmelehre basiert: Erkenntnis beginnt in seinen Augen zwar erst mit der Erfahrung,„wenn aber gleich alle unsere Erkenntnis mit der Erfahrung anhebt, so entspringt sie darum doch nicht eben alle aus der Erfahrung.“(KrV: B1) Neben den empirischen Erkenntnissen, muss es Erkenntnisse a priori geben, d. h. solche, die von aller Erfahrung unabhängig erlangt werden. Kennzeichen solcher Erkenntnisse a priori sind„Notwendigkeit und strenge Allgemeinheit“(KrV: B4), sie zeigen sich in Begriffen und Urteilen. So ist dem Begriff„Körper“notwendig und allgemein Ausgedehntheit, sprich Substanz, inhärent. Das Urteil„Alle Veränderung hat eine Ursache“könnte nicht als notwendig und allgemeingültig formuliert werden, würde es sich auf Erfahrung gründen und somit a posteriori getroffen sein - es könnte jederzeit auch durch Erfahrung widerlegt werden. Der Frage nach dem Umfang, dem Wert und der Gültigkeit der Erkenntnisse a priori ist für Kant die Frage,„wie denn der Verstand zu allen diesen Erkenntnissen a priori komme“(KrV: B7) vorangestellt. Dies muss der Grund, die erste Frage der Philosophie sein. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Zeit
- Die Apriorität der Zeit
- Die Notwendigkeit der Zeit
- Der Anschauungscharakter der Zeit
- Veränderung
- Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit Kants Konzept von Zeit und Veränderung in seiner „Kritik der reinen Vernunft“. Ziel ist es, Kants Argumentation zur Apriorität und Notwendigkeit der Zeit zu analysieren und ihre Bedeutung für die Erkenntnis von Veränderung aufzuzeigen.
- Apriorität der Zeit
- Notwendigkeit der Zeit
- Der Anschauungscharakter der Zeit
- Veränderung als Ausdruck der Zeit
- Bedeutung der Zeit für synthetische Urteile a priori
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt die Bedeutung von Kants „Kritik der reinen Vernunft“ für die theoretische Philosophie dar und beleuchtet die Kritik an den Positionen von Rationalismus und Empirismus. Anschließend wird die Problematik der synthetischen Urteile a priori erläutert und Kants Ansatz der „Transzendentalen Ästhetik“ vorgestellt.
- Die Zeit: Dieses Kapitel behandelt Kants Argumentation zur Apriorität der Zeit. Es werden die zentralen Punkte seiner Argumentation im 1. Zeitargument sowie mögliche Einwände und Interpretationen beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Begriffen der „Kritik der reinen Vernunft“, insbesondere mit den Themen Zeit, Veränderung, Apriorität, Anschauung, synthetische Urteile a priori und transzendentale Ästhetik. Weitere wichtige Begriffe sind Rationalismus, Empirismus, Erkenntnistheorie, Metaphysik und die Kritik an der traditionellen Metaphysik.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der "Transzendentalen Ästhetik" bei Kant?
Kant untersucht hier die reinen Formen der sinnlichen Anschauung – Raum und Zeit –, die jeder Erfahrung vorausgehen (a priori) und diese erst ermöglichen.
Warum betrachtet Kant Zeit als eine Anschauung a priori?
Für Kant ist Zeit nicht aus der Erfahrung abgeleitet, sondern eine notwendige Bedingung, um Veränderungen und das Nacheinander von Ereignissen überhaupt wahrnehmen zu können.
Welche Rolle spielt die Veränderung in Kants Theorie?
Veränderung ist nur durch die Vorstellung der Zeit möglich. Nur in der Zeit können sich widersprechende Bestimmungen (Sein und Nicht-Sein) in einem Objekt nacheinander existieren.
Was sind synthetische Urteile a priori?
Es sind Urteile, die unser Wissen erweitern (synthetisch), aber unabhängig von der Erfahrung (a priori) allgemeingültig und notwendig sind, wie etwa in der Mathematik oder reinen Naturwissenschaft.
Wie grenzt sich Kant von Rationalismus und Empirismus ab?
Kant verbindet beide: Erkenntnis beginnt mit der Erfahrung (Empirismus), benötigt aber angeborene Verstandeskategorien und Anschauungsformen (Rationalismus), um diese Erfahrung zu ordnen.
- Citar trabajo
- Clara Maria Schreiber (Autor), 2004, Zeit und Veränderung in der Transzendentalen Ästhetik in Kants Kritik der reinen Vernunft, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/58565