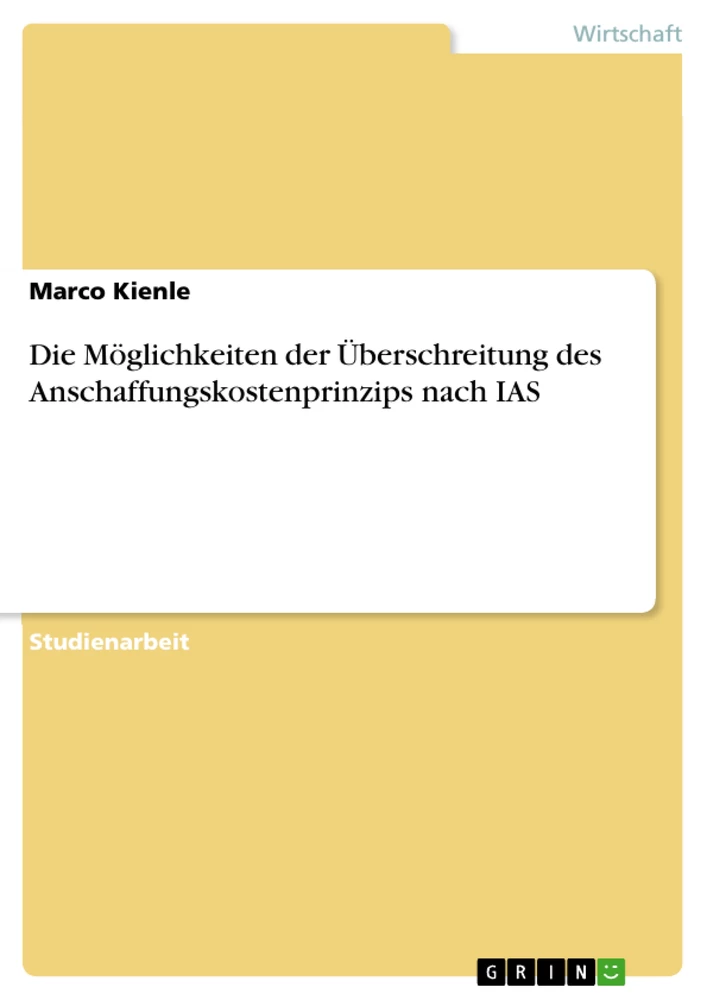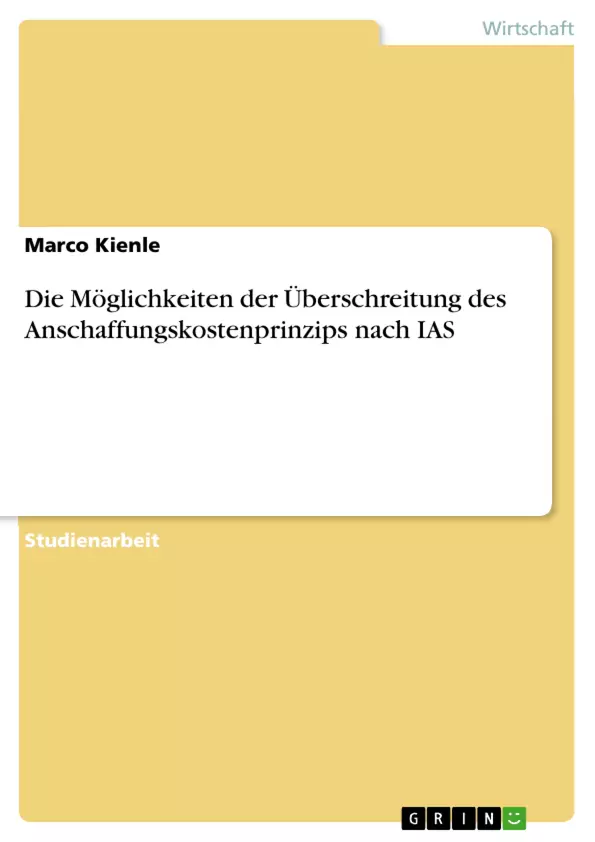„International orientierte Kapitalanleger erwarten von der externen Rechnungslegung eine informatorische Fundierung ihrer Anlageentscheidungen. Dazu müssen Jahresabschlüsse zwei Bedingungen erfüllen:
• Jahresabschlüsse haben (potentielle und aktuelle) Investoren über die (aktuelle und zukünftige) wirtschaftliche Lage des Unternehmens zu informieren.
• Jahresabschlüsse sollten international verständlich und vergleichbar sein.
Beide Bedingungen werden vom traditionellen deutschen HGB -Jahresabschluss nicht erfüllt.“
Durch die übermäßige Betonung des Gläubigerschutzes (insbesondere durch das Vorsichtsprinzip) liefert der HGB - Abschluss ein pessimistisch verzerrtes Bild der Wirklichkeit wieder. Wohingegen sich die Rechnungslegung nach IAS um eine objektive Darstellung der Vermögenslage bemüht.
Aus diesem Grund existiert bei den IAS die Möglichkeit über das Anschaffungskostenprinzip bei Vermögensgegenständen des Anlage- sowie des Umlaufvermögens hinauszugehen, was nach HGB-Rechnungslegung faktisch nicht möglich ist.
Im Folgenden werde ich zunächst die Anschaffungskosten sowohl nach HGB als auch nach IAS definieren, um dann einen kleinen Überblick aufzuzeigen, wie im HGB mit der Bewertung der Anschaffungskosten der Vermögensgegenstände verfahren wird. Schließlich werde ich ausgewählte Positionen des Anlage- sowie des Umlaufvermögens darstellen und aufzeigen, welche Möglichkeiten nach den IAS existieren um das Anschaffungskostenprinzip zu durchbrechen, aber auch kurz erwähnen bei welchen Möglichkeiten nach IAS die Anschaffungskosten die Obergrenze darstellen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Allgemeines über die IAS
- 1.2 Problemstellung
- 2. Definition der Anschaffungskosten nach HGB und IAS
- 2.1 Anschaffungskosten nach HGB
- 2.2 Anschaffungskosten nach IAS
- 3. Bewertung im HGB
- 4. Bewertung nach IAS
- 4.1 Sachanlagen
- 4.1.1 Bewertung bei Zugang
- 4.1.2 Folgebewertung
- 4.2 Immaterielle Vermögensgegenstände
- 4.2.1 Bewertung bei Zugang
- 4.2.2 Folgebewertung
- 4.3 Finanzinstrumente
- 4.3.1 Bewertung bei Zugang
- 4.3.2 Folgebewertung
- 4.4 Vorratsvermögen
- 4.4.1 Bewertung bei Zugang
- 4.4.2 Folgebewertung
- 5. Fazit
- 6. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Möglichkeiten, das Anschaffungskostenprinzip nach International Accounting Standards (IAS) zu überschreiten. Ziel ist es, die Unterschiede zwischen der deutschen Handelsbilanzierung (HGB) und den IAS hinsichtlich der Bewertung von Vermögensgegenständen aufzuzeigen und die Flexibilität der IAS im Vergleich zum HGB zu beleuchten.
- Definition und Vergleich der Anschaffungskosten nach HGB und IAS
- Bewertung von Vermögensgegenständen nach HGB
- Bewertung verschiedener Vermögensgegenstände (Sachanlagen, immaterielle Vermögensgegenstände, Finanzinstrumente, Vorratsvermögen) nach IAS
- Möglichkeiten der Überschreitung des Anschaffungskostenprinzips nach IAS
- Auswirkungen der IAS auf die Rechnungslegung und die Transparenz von Jahresabschlüssen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik ein und erläutert den Hintergrund der zunehmenden Bedeutung internationaler Rechnungslegungsstandards (IAS) im Zuge der Globalisierung und der Notwendigkeit für international vergleichbare Jahresabschlüsse. Es werden die Vorteile einer einheitlichen Rechnungslegung hervorgehoben und die Problemstellung des traditionellen HGB-Abschlusses im Hinblick auf die Anforderungen internationaler Kapitalanleger dargelegt. Der Fokus liegt auf der mangelnden Objektivität des HGB-Abschlusses aufgrund der Betonung des Gläubigerschutzes und dem daraus resultierenden Wunsch nach einer objektiveren Darstellung der Vermögenslage, wie sie die IAS ermöglichen.
2. Definition der Anschaffungskosten nach HGB und IAS: Dieses Kapitel definiert die Anschaffungskosten nach HGB und IAS und verdeutlicht die Unterschiede in den jeweiligen Definitionen. Es wird detailliert auf die einzelnen Bestandteile der Anschaffungskosten nach HGB eingegangen und ein Ermittlungsschema präsentiert. Diese präzise Darstellung bildet die Grundlage für den Vergleich der Bewertungsmethoden und zeigt bereits anfängliche Unterschiede zwischen beiden Systemen auf. Der Leser erhält ein tiefgreifendes Verständnis der Terminologie und der jeweiligen Berechnungsweisen.
3. Bewertung im HGB: Dieses Kapitel beschreibt die Bewertung von Vermögensgegenständen nach den Regeln des Handelsgesetzbuchs (HGB). Es analysiert die strengen Vorgaben des HGB und die eingeschränkten Möglichkeiten, vom Anschaffungskostenprinzip abzuweichen. Durch den Vergleich mit dem nachfolgenden Kapitel über die IAS-Bewertung wird die Starrheit des HGB-Systems deutlich. Die detaillierte Erläuterung der HGB-Bewertung schafft einen klaren Kontrast zum flexibleren Ansatz der IAS.
4. Bewertung nach IAS: Dieses Kapitel beschreibt detailliert die Bewertung verschiedener Vermögensgegenstände (Sachanlagen, immaterielle Vermögensgegenstände, Finanzinstrumente und Vorratsvermögen) nach IAS. Es untersucht die Möglichkeiten, das Anschaffungskostenprinzip zu überschreiten und beleuchtet die unterschiedlichen Bewertungsmethoden, die unter IAS zulässig sind. Der Fokus liegt auf der Flexibilität und den Wahlmöglichkeiten, die die IAS bieten, im Gegensatz zur restriktiven HGB-Rechnungslegung. Für jeden genannten Vermögensgegenstand werden die Bewertungsmethoden bei Zugang und die Folgebewertung erläutert.
Schlüsselwörter
Anschaffungskostenprinzip, IAS, HGB, Bewertung, Vermögensgegenstände, Sachanlagen, immaterielle Vermögensgegenstände, Finanzinstrumente, Vorratsvermögen, internationale Rechnungslegung, Globalisierung, Kapitalmarkt.
Häufig gestellte Fragen zu: Vergleich der Bewertung von Vermögensgegenständen nach HGB und IAS
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Die Arbeit vergleicht die Bewertung von Vermögensgegenständen nach den Regeln des Handelsgesetzbuchs (HGB) und den International Accounting Standards (IAS). Der Fokus liegt auf den Unterschieden in der Anwendung des Anschaffungskostenprinzips und der Flexibilität der IAS im Vergleich zum HGB.
Welche Vermögensgegenstände werden betrachtet?
Die Arbeit untersucht die Bewertung von Sachanlagen, immateriellen Vermögensgegenständen, Finanzinstrumenten und Vorratsvermögen unter HGB und IAS.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel ist es, die Unterschiede zwischen der Bewertung von Vermögensgegenständen nach HGB und IAS aufzuzeigen und die Flexibilität der IAS im Vergleich zum strengeren HGB-System zu beleuchten. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den Möglichkeiten, das Anschaffungskostenprinzip nach IAS zu überschreiten.
Wie werden die Anschaffungskosten nach HGB und IAS definiert?
Die Arbeit definiert die Anschaffungskosten nach HGB und IAS und hebt die Unterschiede zwischen den Definitionen hervor. Es wird ein detailliertes Ermittlungsschema für die Anschaffungskosten nach HGB vorgestellt.
Wie werden Vermögensgegenstände nach HGB bewertet?
Die Arbeit beschreibt die Bewertung von Vermögensgegenständen nach HGB, wobei die strengen Vorgaben und die eingeschränkten Möglichkeiten, vom Anschaffungskostenprinzip abzuweichen, analysiert werden.
Wie werden Vermögensgegenstände nach IAS bewertet?
Die Arbeit beschreibt detailliert die Bewertung verschiedener Vermögensgegenstände nach IAS, einschließlich der Möglichkeiten, das Anschaffungskostenprinzip zu überschreiten. Für jeden Vermögensgegenstand werden die Bewertungsmethoden bei Zugang und die Folgebewertung erläutert.
Welche Bewertungsmethoden sind nach IAS zulässig?
Die Arbeit beleuchtet die verschiedenen Bewertungsmethoden, die unter IAS zulässig sind, und betont die Flexibilität und Wahlmöglichkeiten im Vergleich zur restriktiven HGB-Rechnungslegung.
Welche Auswirkungen haben die IAS auf die Rechnungslegung?
Die Arbeit diskutiert die Auswirkungen der IAS auf die Rechnungslegung und die Transparenz von Jahresabschlüssen, insbesondere im Kontext der Globalisierung und der Anforderungen internationaler Kapitalanleger.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Anschaffungskostenprinzip, IAS, HGB, Bewertung, Vermögensgegenstände, Sachanlagen, immaterielle Vermögensgegenstände, Finanzinstrumente, Vorratsvermögen, internationale Rechnungslegung, Globalisierung, Kapitalmarkt.
Gibt es eine Zusammenfassung der Kapitel?
Ja, die Arbeit enthält eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel (Einleitung, Definition der Anschaffungskosten, Bewertung nach HGB, Bewertung nach IAS, Fazit).
Welche Vorteile bietet die einheitliche Rechnungslegung nach IAS?
Die Arbeit hebt die Vorteile einer einheitlichen Rechnungslegung nach IAS hervor, insbesondere die verbesserte Vergleichbarkeit von Jahresabschlüssen und die Erfüllung der Anforderungen internationaler Kapitalanleger.
- Arbeit zitieren
- Marco Kienle (Autor:in), 2003, Die Möglichkeiten der Überschreitung des Anschaffungskostenprinzips nach IAS , München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/58432