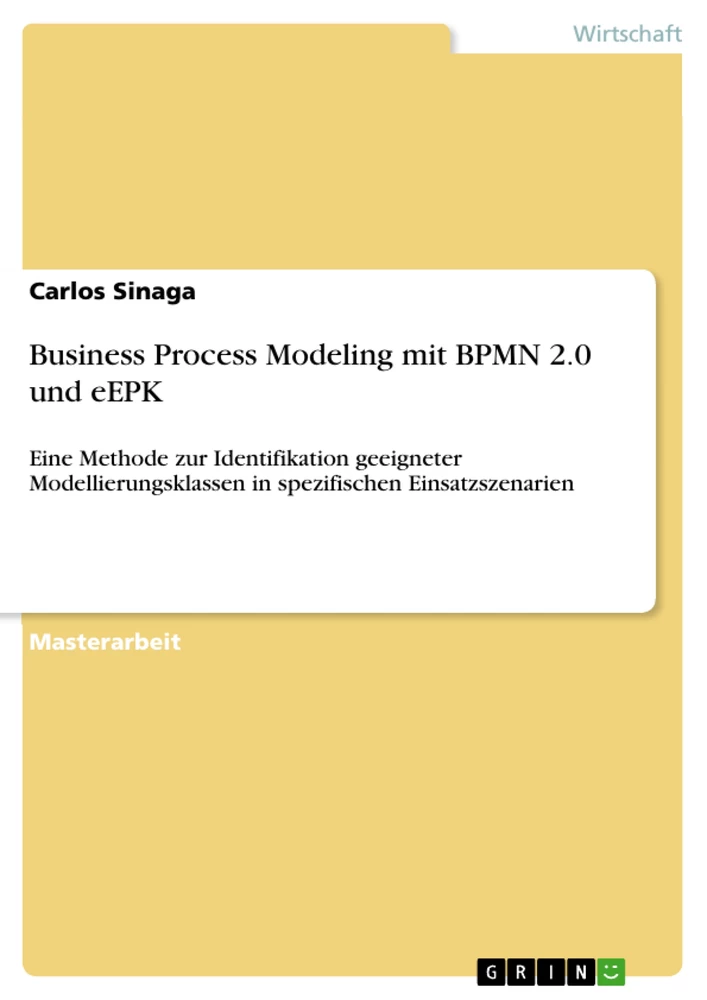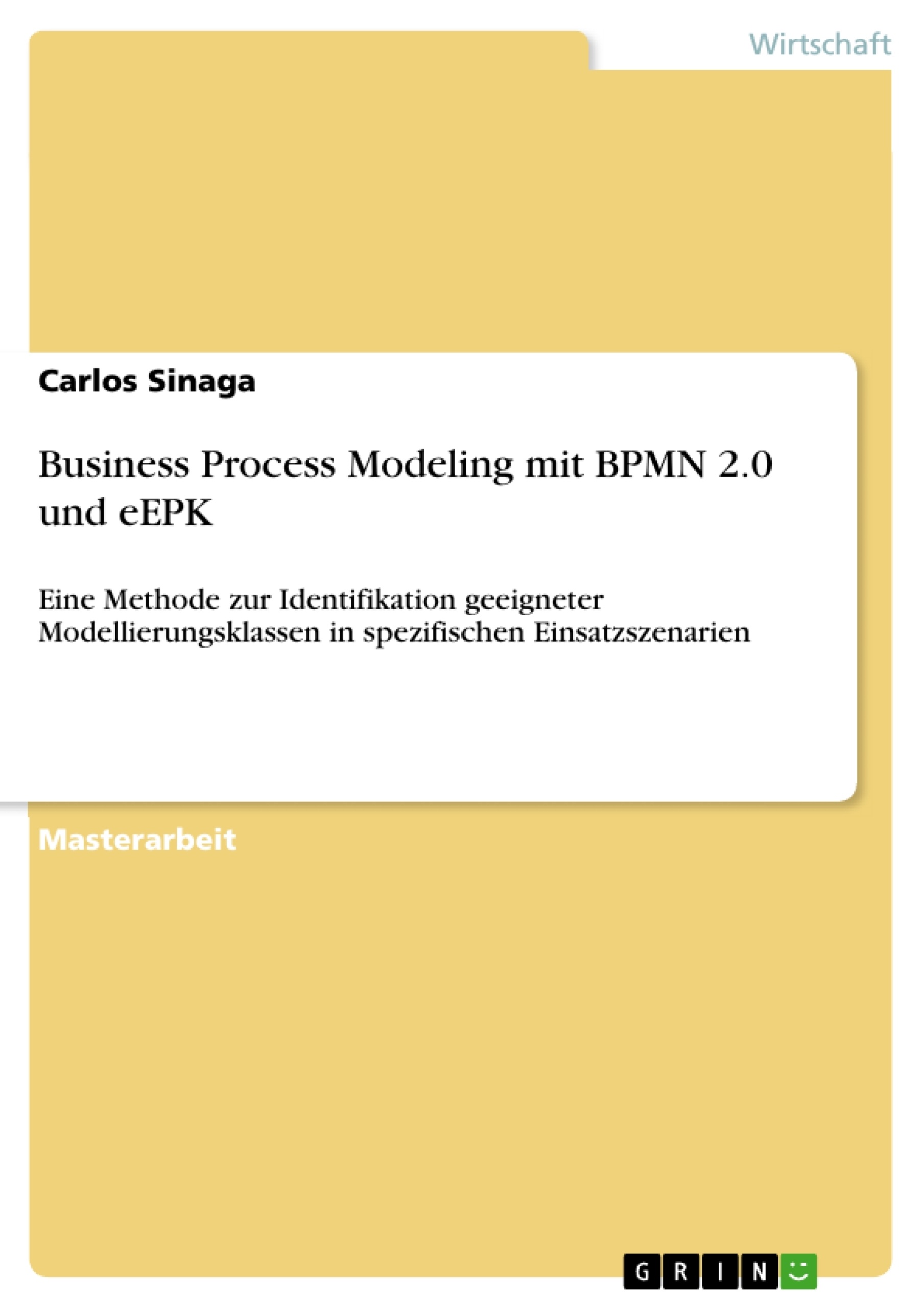Das Ziel der Arbeit ist eine systematische Erstellung von Geschäftsprozessmodellen mit den genannten Notationen in Abhängigkeit der Anforderungen spezifischer Szenarien.
In Anlehnung an Becker et al. wird mit dieser Zielsetzung ein methodischer Auftrag mit einem Erkenntnis- sowie einem Gestaltungsziel verfolgt. Das Erkenntnisziel ist jedoch eher nachrangig zu sehen, da kein vollständiges Verständnis der Modellierung mit BPMN 2.0 und eEPK, sondern nur ein grober Überblick vermittelt werden soll. Im Vordergrund steht hingegen das Gestaltungsziel, eine Methode zur systematischen Erstellung von Prozessmodellen in Abhängigkeit der Anforderungen spezifischer Einsatzszenarien zu entwickeln.
Die zentralen Forschungsfragen, die sich aus den beschriebenen Zielen ergeben, können wie folgt formuliert werden: Welche Modellierungsmöglichkeiten bieten BPMN 2.0 und eEPK und wie können diese unter Nutzung bestehender Ansätze systematisch differenziert werden? Welche Anforderungen an Geschäftsprozessmodelle können in spezifischen Einsatzszenarien bestehen und anhand welcher Kriterien können diese bewertet werden? Wie muss eine Methode zur systematischen Erstellung von Geschäftsprozessmodellen, in Abhängigkeit der Anforderungen spezifischer Einsatzszenarien, ausgestaltet sein?
Mit dem Forschungsziel geht die Grundhypothese dieser Arbeit einher, die wie folgt formuliert werden kann: Es ist möglich, in Abhängigkeit von bestimmten Kriterien Geschäftsprozessmodelle mit BPMN 2.0 und eEPK zu erstellen, die Anforderungen spezifischer Einsatzszenarien erfüllen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 1.1 Motivation
- 1.2 Problemstellung und Zielsetzung
- 1.3 Forschungsmethode und –verfahren
- 1.4 Aufbau der Arbeit
- 1.5 Unterstützung durch die CSC Deutschland Solutions GmbH
- 2. Grundlagen Business Process Modeling
- 2.1 Definitionen/Begriffsabgrenzungen
- 2.1.1 Prozess und Geschäftsprozess
- 2.1.2 Teilprozess
- 2.1.3 Vorgang, Aufgabe und Elementaraufgabe
- 2.1.4 Abgrenzung Geschäftsprozess und Workflow
- 2.1.5 Geschäftsprozessmodell
- 2.1.6 Business Process Modeling
- 2.1.7 Modellierungssprache und Notation
- 2.2 Klassifikation von Modellierungssprachen
- 2.2.1 Klassifikation nach Formalisierungsgrad
- 2.2.2 Klassifikation nach Art der Methode
- 3. BPMN 2.0 und eEPK im Detail
- 3.1 Anmerkung zum Kapitel
- 3.2 eEPK
- 3.2.1 Historie und Versionen von EPK
- 3.2.2 Symbole
- 3.2.3 Modellierung mit eEPK
- 3.3 BPMN 2.0
- 3.3.1 Historie und Versionen von BPMN
- 3.3.2 Symbole
- 3.3.3 Modellierung mit BPMN 2.0
- 3.4 BPMN 2.0 und eEPK im Vergleich
- 3.4.1 Anforderungen an Modellierungssprachen
- 3.4.2 Ableitung von Bewertungskriterien für Modellierungssprachen
- 3.4.3 Vergleich von BPMN 2.0 und eEPK anhand Bewertungskriterien
- 3.4.4 Zusammenfassung des Vergleichs
- 4. Differenzierung der Modellierungsmöglichkeiten von eEPK und BPMN 2.0: Konzeption von Modellierungsklassen
- 4.1 Bestehende Ansätze zur Differenzierung von Prozessmodellen und Modellierungsmöglichkeiten
- 4.1.1 Sichtenkonzepte zur Differenzierung von Prozessmodellen
- 4.1.2 Konzepte zur Differenzierung der Modellierungsmöglichkeiten von BPMN 2.0
- 4.1.3 Vergleich der Konzepte von Silver und Shapiro
- 4.2 Konzeption von Modellierungsklassen für BPMN 2.0 und eEPK
- 4.2.1 Anmerkung zum Kapitel
- 4.2.2 Definition „Modellierungsklasse“
- 4.2.3 Modellierungsklassen im Vergleich zu bestehenden Ansätzen
- 4.3 Modellierungsklasse eins im Detail: Prozessmodelle
- 4.3.1 Symbole
- 4.3.2 Modellierungsregeln
- 4.3.3 Nutzen von Modellierungsklasse eins
- 4.4 Modellierungsklasse zwei im Detail: Workflowmodelle I
- 4.4.1 Symbole
- 4.4.2 Modellierungsregeln
- 4.4.3 Nutzen von Modellierungsklasse zwei
- 4.5 Modellierungsklasse drei im Detail: Workflowmodelle II
- 4.5.1 Symbole
- 4.5.2 Modellierungsregeln
- 4.5.3 Nutzen von Modellierungsklasse drei
- 4.6 Abschließender Vergleich der Modellierungsklassen
- 5. Identifikation geeigneter Modellierungsklassen: Definition von Entscheidungskriterien
- 5.1 Anforderungen an Prozessmodelle: Grundsätze ordnungsmäßiger Modellierung
- 5.2 Ableitung von Entscheidungskriterien
- 5.3 Konzeption einer „Entscheidungsmatrix“
- 5.4 Anwendung der Entscheidungsmatrix
- 6. Evaluierung definierter Entscheidungskriterien anhand beispielhafter Einsatzszenarien aus Praxisprojekten
- 6.1 Definition „Einsatzszenario“
- 6.2 Ablauf der Evaluierung
- 6.3 Einsatzszenario eins: Modellierung eines Prozesses zur automatisierten Rechnungseingangsverarbeitung
- 6.3.1 Beschreibung des Einsatzszenarios
- 6.3.2 Identifikation einer geeigneten Modellierungsklasse
- 6.3.3 Modellierung des Geschäftsprozesses in Modellierungsklasse eins
- 6.3.4 Bewertung der Erfüllung spezifischer Anforderungen
- 6.4 Einsatzszenario zwei: Modellierung eines Prozesses zur Dauerauftragsbearbeitung
- 6.4.1 Beschreibung des Einsatzszenarios
- 6.4.2 Identifikation einer geeigneten Modellierungsklasse
- 6.4.3 Modellierung des Geschäftsprozesses in Modellierungsklasse zwei
- 6.4.4 Bewertung der Erfüllung spezifischer Anforderungen
- 7. Schlussbetrachtung
- 7.1 Zusammenfassung
- 7.2 Kritische Würdigung der Ergebnisse
- 7.3 Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Hauptziel dieser Arbeit ist die Entwicklung einer Methode zur systematischen Erstellung von Geschäftsprozessmodellen mit BPMN 2.0 und eEPK, die die spezifischen Anforderungen verschiedener Einsatzszenarien berücksichtigt. Die Methode soll gewährleisten, dass die Komplexität der Modelle dem jeweiligen Bedarf angemessen ist und weder über- noch unterdimensioniert sind.
- Differenzierung der Modellierungsmöglichkeiten von BPMN 2.0 und eEPK
- Definition von Entscheidungskriterien für die Auswahl geeigneter Modellierungsklassen
- Entwicklung einer Entscheidungsmatrix zur Auswahl der optimalen Modellierungsklasse
- Evaluierung der Methode anhand von Praxisbeispielen
- Kritische Reflexion der Methode und Ausblick auf zukünftige Forschungsarbeiten
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Dieses Kapitel führt in die Thematik des Business Process Modeling (BPM) ein, beschreibt die Motivation der Arbeit, die Problemstellung und die Forschungsziele. Es werden die zentralen Forschungsfragen formuliert und die Grundhypothese der Arbeit dargelegt. Die gewählte Forschungsmethode, eine konzeptionell-deduktive Analyse mit qualitativer Evaluation, wird detailliert beschrieben.
2. Grundlagen Business Process Modeling: Dieses Kapitel legt die grundlegenden Definitionen und Begrifflichkeiten fest, die für das Verständnis der Arbeit essentiell sind. Es werden Prozesse, Geschäftsprozesse, Teilprozesse, Vorgänge und Aufgaben definiert und voneinander abgegrenzt. Der Unterschied zwischen Geschäftsprozessen und Workflows wird erläutert. Schließlich werden Modellierungssprachen klassifiziert und die Eigenschaften von BPMN 2.0 und eEPK vorgestellt.
3. BPMN 2.0 und eEPK im Detail: Dieses Kapitel beschreibt detailliert die Modellierungsmöglichkeiten von BPMN 2.0 und eEPK. Es wird die Historie, die verwendeten Symbole und die Modellierungsregeln beider Sprachen erläutert. Ein Vergleich der beiden Sprachen anhand von Bewertungskriterien schließt das Kapitel ab, wobei die Substituierbarkeit beider Sprachen betont wird.
4. Differenzierung der Modellierungsmöglichkeiten von eEPK und BPMN 2.0: Konzeption von Modellierungsklassen: Dieses Kapitel analysiert bestehende Ansätze zur Differenzierung von Prozessmodellen und Modellierungsmöglichkeiten, insbesondere die Konzepte von Silver und Shapiro für BPMN 2.0. Auf dieser Basis werden drei übergreifende Modellierungsklassen (Prozessmodelle und Workflowmodelle I und II) für BPMN 2.0 und eEPK konzipiert, die sich durch die Menge der erlaubten Symbole und spezifische Modellierungsregeln unterscheiden.
5. Identifikation geeigneter Modellierungsklassen: Definition von Entscheidungskriterien: In diesem Kapitel werden Entscheidungskriterien abgeleitet, um die geeignete Modellierungsklasse für ein spezifisches Einsatzszenario zu identifizieren. Die "Grundsätze ordnungsmäßiger Modellierung (GoM)" dienen als Grundlage. Die Kriterien basieren auf Richtigkeit, Relevanz, Wirtschaftlichkeit und Klarheit. Eine Entscheidungsmatrix wird konzipiert, um die Kriterien systematisch anzuwenden.
6. Evaluierung definierter Entscheidungskriterien anhand beispielhafter Einsatzszenarien aus Praxisprojekten: Dieses Kapitel evaluiert die in Kapitel 5 entwickelte Methode anhand zweier fiktiver Einsatzszenarien (automatische Rechnungseingangsverarbeitung und Dauerauftragsbearbeitung). Für jedes Szenario wird die geeignete Modellierungsklasse mithilfe der Entscheidungsmatrix ermittelt, ein Prozessmodell erstellt und die Erfüllung der Anforderungen bewertet.
Schlüsselwörter
Business Process Modeling (BPM), BPMN 2.0, eEPK, Geschäftsprozessmodellierung, Prozessmodellierung, Workflowmodellierung, Modellierungsklassen, Entscheidungskriterien, Grundsätze ordnungsmäßiger Modellierung (GoM), Entscheidungsmatrix, Prozessanalyse, Softwareentwicklung, Methodenvergleich.
Häufig gestellte Fragen zum Dokument "Entwicklung einer Methode zur Auswahl geeigneter Modellierungsklassen für Geschäftsprozessmodelle mit BPMN 2.0 und eEPK"
Was ist das Hauptziel dieser Arbeit?
Das Hauptziel ist die Entwicklung einer Methode zur systematischen Erstellung von Geschäftsprozessmodellen mit BPMN 2.0 und eEPK, die die spezifischen Anforderungen verschiedener Einsatzszenarien berücksichtigt. Die Methode soll gewährleisten, dass die Komplexität der Modelle dem jeweiligen Bedarf angemessen ist und weder über- noch unterdimensioniert sind.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Differenzierung der Modellierungsmöglichkeiten von BPMN 2.0 und eEPK, die Definition von Entscheidungskriterien für die Auswahl geeigneter Modellierungsklassen, die Entwicklung einer Entscheidungsmatrix zur Auswahl der optimalen Modellierungsklasse, die Evaluierung der Methode anhand von Praxisbeispielen und die kritische Reflexion der Methode mit Ausblick auf zukünftige Forschungsarbeiten.
Welche Modellierungssprachen werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht die beiden Modellierungssprachen BPMN 2.0 und eEPK hinsichtlich ihrer Eignung für die Erstellung von Geschäftsprozessmodellen.
Wie werden die Modellierungsmöglichkeiten von BPMN 2.0 und eEPK differenziert?
Die Differenzierung erfolgt durch die Konzeption von drei Modellierungsklassen: Prozessmodelle und zwei Workflowmodellklassen (I und II). Diese Klassen unterscheiden sich durch die Menge der erlaubten Symbole und spezifische Modellierungsregeln.
Welche Entscheidungskriterien werden definiert?
Die Entscheidungskriterien basieren auf den Grundsätzen ordnungsmäßiger Modellierung (GoM) und berücksichtigen Aspekte wie Richtigkeit, Relevanz, Wirtschaftlichkeit und Klarheit der Modelle.
Wie wird die Auswahl der geeigneten Modellierungsklasse unterstützt?
Die Auswahl wird durch eine entwickelte Entscheidungsmatrix unterstützt, die die systematische Anwendung der definierten Entscheidungskriterien ermöglicht.
Wie wird die Methode evaluiert?
Die Methode wird anhand von zwei beispielhaften Einsatzszenarien aus Praxisprojekten evaluiert: die Modellierung eines Prozesses zur automatisierten Rechnungseingangsverarbeitung und die Modellierung eines Prozesses zur Dauerauftragsbearbeitung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Business Process Modeling (BPM), BPMN 2.0, eEPK, Geschäftsprozessmodellierung, Prozessmodellierung, Workflowmodellierung, Modellierungsklassen, Entscheidungskriterien, Grundsätze ordnungsmäßiger Modellierung (GoM), Entscheidungsmatrix, Prozessanalyse, Softwareentwicklung, Methodenvergleich.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst sieben Kapitel: Einführung, Grundlagen Business Process Modeling, BPMN 2.0 und eEPK im Detail, Differenzierung der Modellierungsmöglichkeiten, Identifikation geeigneter Modellierungsklassen, Evaluierung anhand von Beispielen und Schlussbetrachtung.
Wo finde ich detaillierte Informationen zu den einzelnen Kapiteln?
Eine detaillierte Zusammenfassung der einzelnen Kapitel ist im Abschnitt "Zusammenfassung der Kapitel" des Dokuments enthalten.
- Citar trabajo
- Carlos Sinaga (Autor), 2014, Business Process Modeling mit BPMN 2.0 und eEPK, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/583479