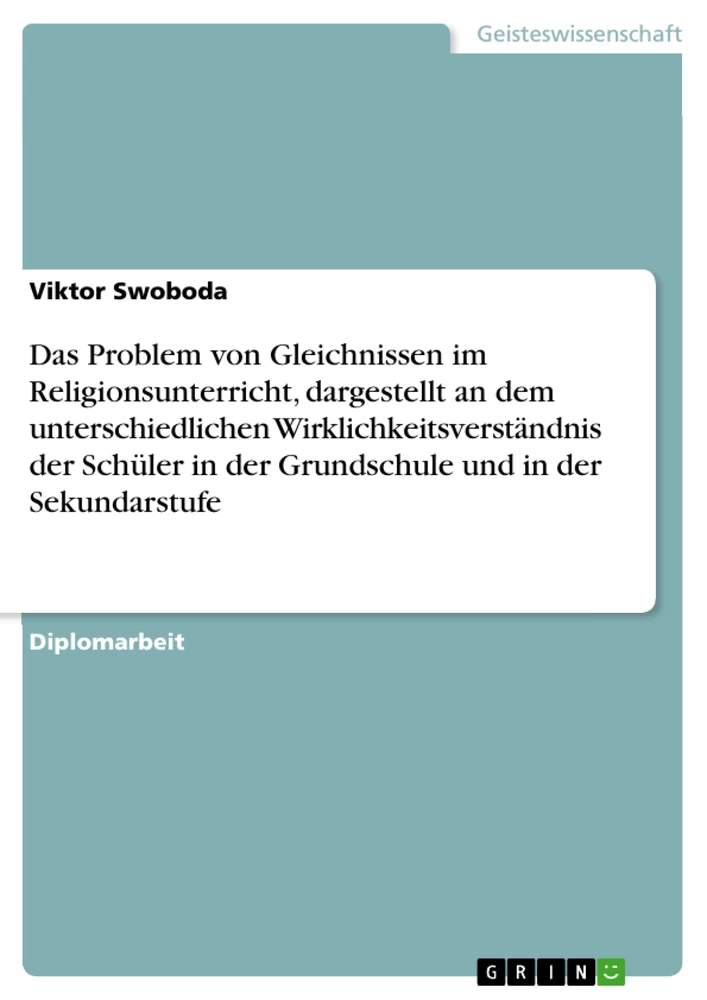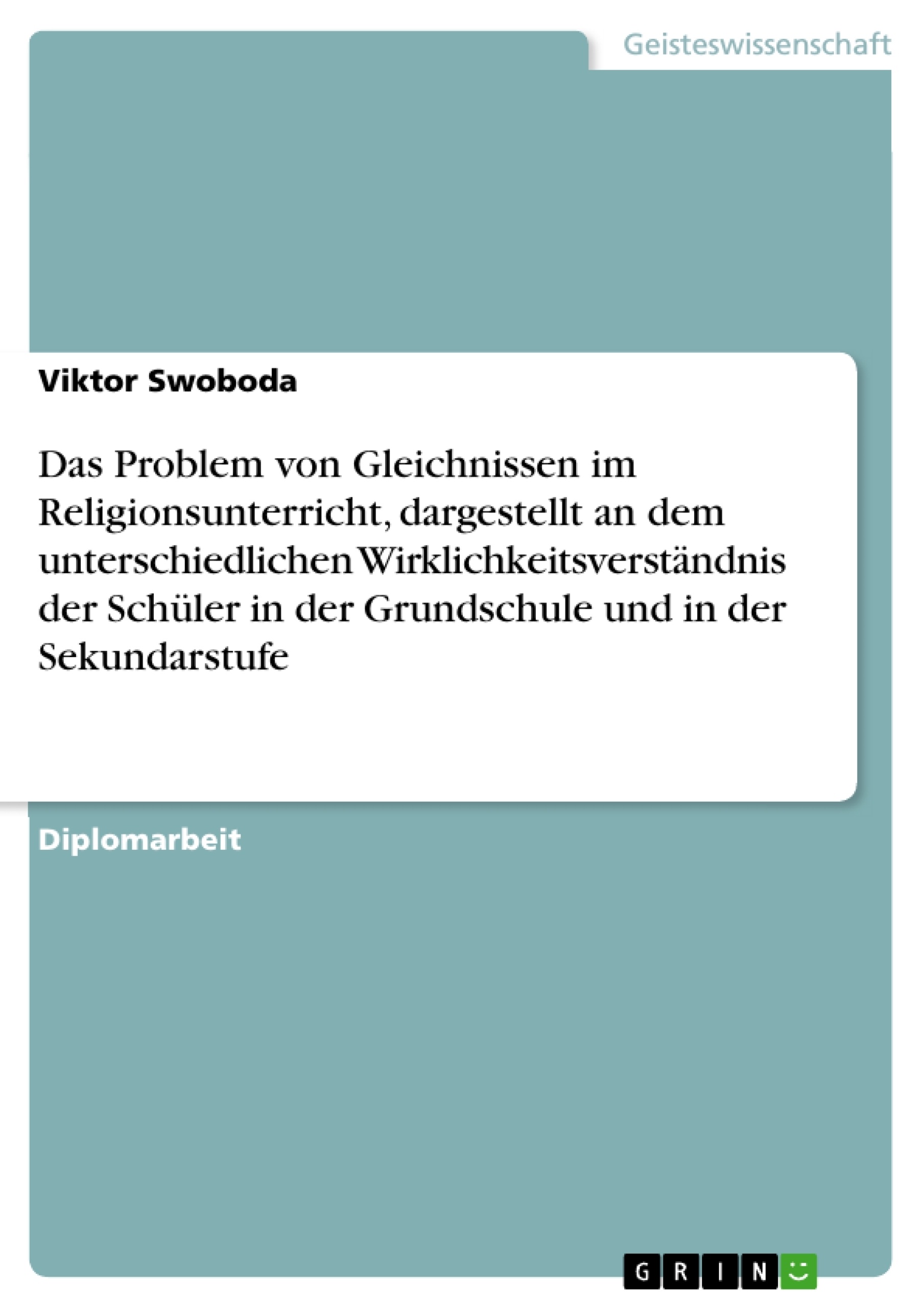Was haben Gleichnisforschung, Religionspädagogik und Entwicklungspsychologie gemeinsam? Was können die neutestamentlichen Gleichnisse im schulischen Religionsunterricht anbieten, vermitteln oder gar bewirken, und welche Rolle spielen in der Unterrichtsgestaltung die entwicklungspsychologischen Erkenntnisse? Darum soll es hier gehen, wobei die Schulkinder, in der Art, wie sie sich entwickeln, im Mittelpunkt stehen.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- 0. Einleitung
- 0.1 Ausgangsthese
- 0.2 Zielsetzung, Methodik und Abgrenzung
- 1. Altersspezifische Gesichtspunkte der Entwicklungspsychologie
- 1.1 Psychosoziale Entwicklung des Kindes von Kleinkind- bis Vorschulalter
- 1.2 Entwicklungsphasen der Schulzeit
- 1.2.1 Grundschule: Werksinn gegen Minderwertigkeitsgefühl
- 1.2.2 Sekundarstufe: Identität gegen Identitätsdiffusion
- 1.3 Die Entwicklung des Denkens nach Piaget
- 1.4 Das Problem des Übergangs von der Grund- in die Sekundarstufe
- 1.5 Entwicklungsstadien des metaphorischen Verstehens bei Schülern
- 1.6 Ergebnisse für die Praxis des Religionsunterrichts
- 2. Die Doppelstruktur von Gleichnissen
- 2.1 Exegese von Lukas 15
- 2.1.1 Rekonstruktion der ursprünglichen Gestalt
- 2.1.2 Gattungsbestimmung
- 2.1.3 Annäherung an die Sachhälfte
- 2.1.3.1 Zusammenhang mit der Thematik der „Gottesherrschaft“
- 2.1.3.2 Kontext der Situationsangabe (15,1-3)
- 2.1.3.3 Kontext der Gleichnisse im engeren Sinn (15,4-10)
- 2.2 Einzelexegese der Parabel vom verlorenen Sohn
- 2.2.1 Gattungsmerkmale
- 2.2.2 Inhaltliche Annäherung an die Sachhälfte
- 2.2.3 Bestimmung von Bildhälfte und Pointe
- 2.2.4 Erschließung der Sache aus dem Bild
- 2.3 Ergebnisse
- 3. Methodisch-didaktische Überlegungen vom Arbeiten mit Gleichnissen im Religionsunterricht
- 3.1 Inhaltliche Sinnmitte der Parabel
- 3.2 Elementare Erfahrungswelten von Parabelhörer und Schulkinder
- 3.2.1 Abschied vom Vaterhaus
- 3.2.2 Der Sohn wird ein Verlorener => Not
- 3.2.3 Umkehr des Verlorenen => Besinnung
- 3.2.4 Heimkehr und Freudenfest => Lösung
- 3.2.5 Motivierung zum Mitfeiern => positive Lebenseinstellung
- 3.3 Elementare Wahrheiten
- 3.4 Elementare Anfänge in Grund- und Orientierungsstufen
- 3.5 Elementare Anfänge in der Sekundarstufe
- 3.6 Ergebnisse
- 4. Literaturverzeichnis
- 4.1 Zur Entwicklungspsychologie
- 4.2 Zur Gleichnisforschung
- 4.3 Zur Religionspädagogik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht das Problem von Gleichnissen im Religionsunterricht und betrachtet dabei den unterschiedlichen Wirklichkeitsbegriff von Schülern in der Grundschule und in der Sekundarstufe. Ziel der Arbeit ist es, die Möglichkeiten und Herausforderungen der Verwendung von Gleichnissen im Religionsunterricht für unterschiedliche Altersgruppen zu beleuchten.
- Entwicklungspsychologische Aspekte und ihre Bedeutung für die Rezeption von Gleichnissen
- Die Doppelstruktur von Gleichnissen und ihre didaktische Bedeutung
- Methodisch-didaktische Überlegungen zum Arbeiten mit Gleichnissen im Religionsunterricht
- Der unterschiedliche Wirklichkeitsbegriff von Schülern in der Grundschule und in der Sekundarstufe
- Die Bedeutung von Gleichnissen für die Persönlichkeitsentwicklung von Schülern
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Ausgangsthese der Arbeit vor und beschreibt Zielsetzung, Methodik und Abgrenzung. Kapitel 1 beleuchtet die altersspezifischen Gesichtspunkte der Entwicklungspsychologie, die für das Verständnis der Rezeption von Gleichnissen relevant sind. Kapitel 2 widmet sich der Doppelstruktur von Gleichnissen und analysiert exemplarisch die Parabel vom verlorenen Sohn aus Lukas 15. Kapitel 3 befasst sich mit methodisch-didaktischen Überlegungen zum Arbeiten mit Gleichnissen im Religionsunterricht und berücksichtigt dabei die unterschiedlichen Erfahrungswelten von Grundschul- und Sekundarschülern.
Schlüsselwörter
Gleichnisse, Religionsunterricht, Entwicklungspsychologie, Grundschule, Sekundarstufe, Wirklichkeitsbegriff, Didaktik, Metaphern, Parabel, Lukas 15, Verlorener Sohn
- Quote paper
- Viktor Swoboda (Author), 2006, Das Problem von Gleichnissen im Religionsunterricht, dargestellt an dem unterschiedlichen Wirklichkeitsverständnis der Schüler in der Grundschule und in der Sekundarstufe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/57869