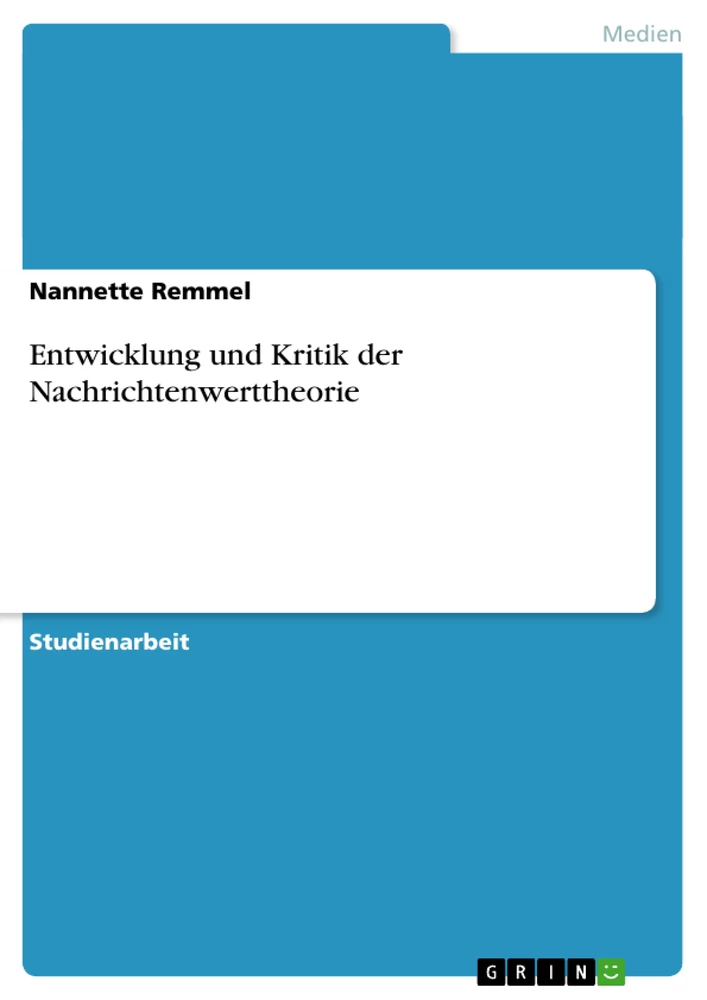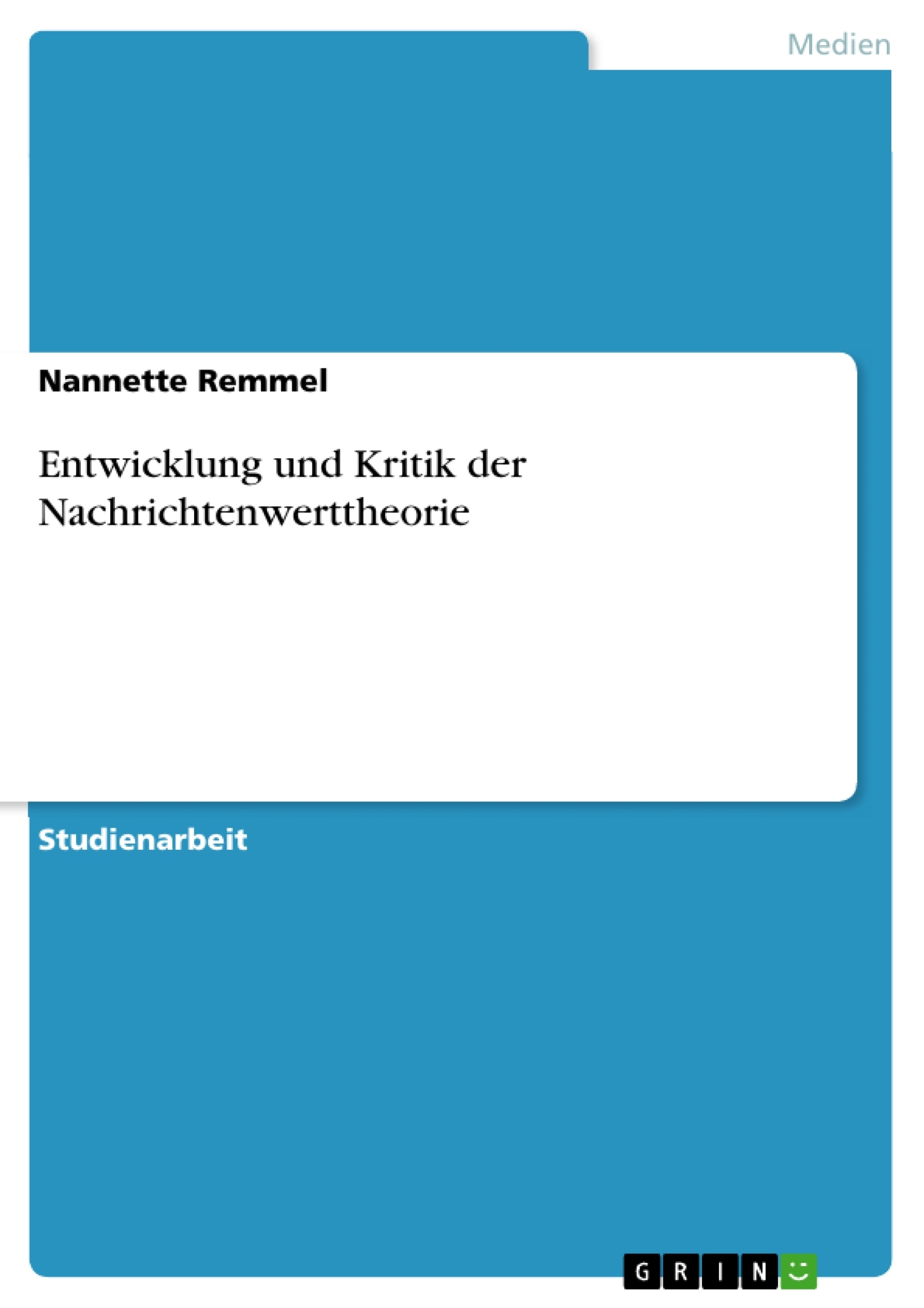In der vorliegenden Arbeit werden Entwicklung und Kritik der Nachrichtenwert-Theorie behandelt. Dies geschieht über die Darlegung von ,,einfachen" Überlegungen, differenzierten Theorien und Untersuchungen wichtiger Nachrichtenforscher sowie der Aufdeckung der jeweiligen Schwächen aufgrund derer sich immer wieder neue Ansätze entwickelten.
Besonderen Wert wird auf die Behandlung der folgenden Fragen gelegt, die auch Schwerpunktüberlegungen der verschiedenen Theoretiker und Analytiker waren:
Inwieweit die verschiedenen Ansätze der Nachrichtenwert-Theorie zur Klärung der Frage, ob die Medien die Realität ,,richtig" darstellen, beigetragen haben, wird dabei eine Frage dieser Arbeit sein. Kritik an der Vorstellung, die Medien präsentierten die Realität übte schon Walter Lippmann, als einer der ersten Theoretiker, der den Begriff Nachrichtenwert benutzte1. Im Folgenden wurde seine Idee des öfteren wieder aufgegriffen, wenn neue Ansätze zum Nachrichtenwert oder ganze Nachrichtenwert-Theorien entwickelt wurden.
Weiterhin ist es ja offensichtlich, dass Journalisten täglich dem Zwang der Selektion begegnen, d.h. sie müssen wählen, über welche Ereignisse oder welche Agenturmeldungen sie berichten wollen. Eine ganze Menge von Informationen erreicht sie täglich und sie sind es, die meist unter Zeitdruck entscheiden, welche Nachrichten publiziert werden. Ob es hierbei allgemeine objektive Merkmale dieser Ereignisse oder Meldungen gibt, die sie publikationswürdig machen, oder ob Nachrichten vielmehr aufgrund subjektiver Kriterien ausgewählt werden, wobei dann auch mögliche Intentionen der Journalisten eine Rolle spielen würden, ist eine zweite Fragestellung dieser Arbeit.
Für die Darstellung der einzelnen Kapitel sei noch angemerkt, dass aus Platzgründen nur die wichtigsten Theoretiker und Forscher und deren für die Fragestellungen dieser Arbeit relevanten Überlegungen beschrieben und diskutiert werden.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Walter Lippmann: Ursprung in den USA
- Einar Östgaard: Ursprung in Europa
- Endogene Faktoren
- Exogene Faktoren
- Hypothesen für die Massenmedienrealität
- Johan Galtung und Mari Holmboe Ruge: Die erste Nachrichtenwert-Theorie
- Frequenz
- Schwellenfaktor
- Eindeutigkeit
- Bedeutsamkeit
- Karl Erik Rosengren: Methodologische Kritik
- Winfried Schulz: Konstruktivistische Nachrichtenwert-Theorie
- Jürgen Wilke und Bernhard Rosenberger: Input-Output-Analyse
- Hans Mathias Kepplinger (und Joachim Friedrich Staab): Neuere Kritik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Entwicklung und Kritik der Nachrichtenwert-Theorie. Sie untersucht verschiedene Ansätze und Theorien wichtiger Nachrichtenforscher sowie deren Schwächen, die zur Entwicklung neuer Ansätze führten. Besonderes Augenmerk liegt auf der Frage, inwieweit die verschiedenen Ansätze zur Klärung der Frage beitragen, ob die Medien die Realität „richtig“ darstellen, sowie auf die Frage, ob Nachrichten aufgrund objektiver Merkmale oder subjektiver Kriterien ausgewählt werden. Die Arbeit analysiert die Selektionsprozesse von Journalisten und die Rolle von Nachrichtenwerten bei der Auswahl von Ereignissen.
- Entwicklung und Kritik der Nachrichtenwert-Theorie
- Objektive und subjektive Kriterien bei der Nachrichtenauswahl
- Die Rolle von Nachrichtenwerten und journalistischen Konventionen
- Die Frage, ob die Medien die Realität „richtig“ darstellen
- Analyse verschiedener Ansätze und Theorien wichtiger Nachrichtenforscher
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung präsentiert die Forschungsfrage und -ziele der Arbeit, wobei besonderes Gewicht auf die Frage gelegt wird, ob die Medien die Realität „richtig“ darstellen. Sie beleuchtet die Herausforderungen von Journalisten bei der Selektion von Nachrichten und die Rolle von subjektiven Kriterien in diesem Prozess. Das Kapitel 2 behandelt Walter Lippmanns Ansatz zur Nachrichtenwert-Theorie und seine Beschreibung von journalistischen Konventionen. Lippmanns Ansicht, dass Nachrichtenwerte von verschiedenen Faktoren wie Ungewöhnlichkeit, Bezug zu bereits eingeführten Themen und räumlicher Nähe beeinflusst werden, wird ausführlich dargestellt. Im Kapitel 3 wird Einar Östgaards Ansatz vorgestellt, der die Verzerrung des Nachrichtenflusses durch endogene und exogene Faktoren untersucht. Östgaard unterscheidet verschiedene Faktoren, die zu einer Diskontinuität in der Berichterstattung führen, wie beispielsweise die Tendenz zur Simplifikation und die Betonung von Sensationen. Kapitel 4 geht auf die Systematisierung und Differenzierung von Östgaards Überlegungen durch Johan Galtung und Mari Holmboe Ruge ein. Sie entwickelten zwölf Nachrichtenfaktoren, die den Nachrichtenwert bestimmen, wobei einige Faktoren als anthropologisch und andere als kulturell abhängig bezeichnet werden. Die Zusammenfassung der Kapitel endet mit der Darstellung der ersten vier Nachrichtenfaktoren nach Galtung und Ruge, wobei jeweils kurz die Bedeutung der Faktoren für die Nachrichtenauswahl erläutert wird.
Schlüsselwörter
Nachrichtenwert-Theorie, Medienrealität, Selektionsprozesse, Journalismus, Nachrichtenauswahl, objektive Merkmale, subjektive Kriterien, journalistische Konventionen, Nachrichtenfaktoren, Anthropologie, Kultur, Frequenz, Schwellenfaktor, Eindeutigkeit, Bedeutsamkeit, Walter Lippmann, Einar Östgaard, Johan Galtung, Mari Holmboe Ruge
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Kernfrage der Nachrichtenwerttheorie?
Die Theorie untersucht, warum bestimmte Ereignisse zu Nachrichten werden und andere nicht. Sie fragt nach den Kriterien (Nachrichtenfaktoren), die den "Nachrichtenwert" eines Ereignisses bestimmen.
Welche Rolle spielen Galtung und Ruge in der Nachrichtenforschung?
Johan Galtung und Mari Holmboe Ruge entwickelten die erste umfassende Systematisierung von zwölf Nachrichtenfaktoren (wie Frequenz, Eindeutigkeit oder Bedeutsamkeit), die die Selektion von Nachrichten beeinflussen.
Was kritisierte Walter Lippmann am Journalismus?
Lippmann wies früh darauf hin, dass Medien die Realität nicht eins zu eins abbilden, sondern durch journalistische Konventionen und Selektionsfilter eine "Pseudo-Realität" erschaffen.
Was sind endogene und exogene Faktoren nach Einar Östgaard?
Östgaard untersuchte die Verzerrung des Nachrichtenflusses durch interne mediale Prozesse (endogen) und äußere Einflüsse (exogen), die zu Phänomenen wie Simplifikation führen.
Wählen Journalisten Nachrichten objektiv aus?
Die Forschung zeigt, dass die Auswahl oft unter Zeitdruck und basierend auf subjektiven Kriterien sowie etablierten journalistischen Konventionen erfolgt, statt rein nach objektiven Merkmalen.
- Quote paper
- Nannette Remmel (Author), 2001, Entwicklung und Kritik der Nachrichtenwerttheorie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/5734