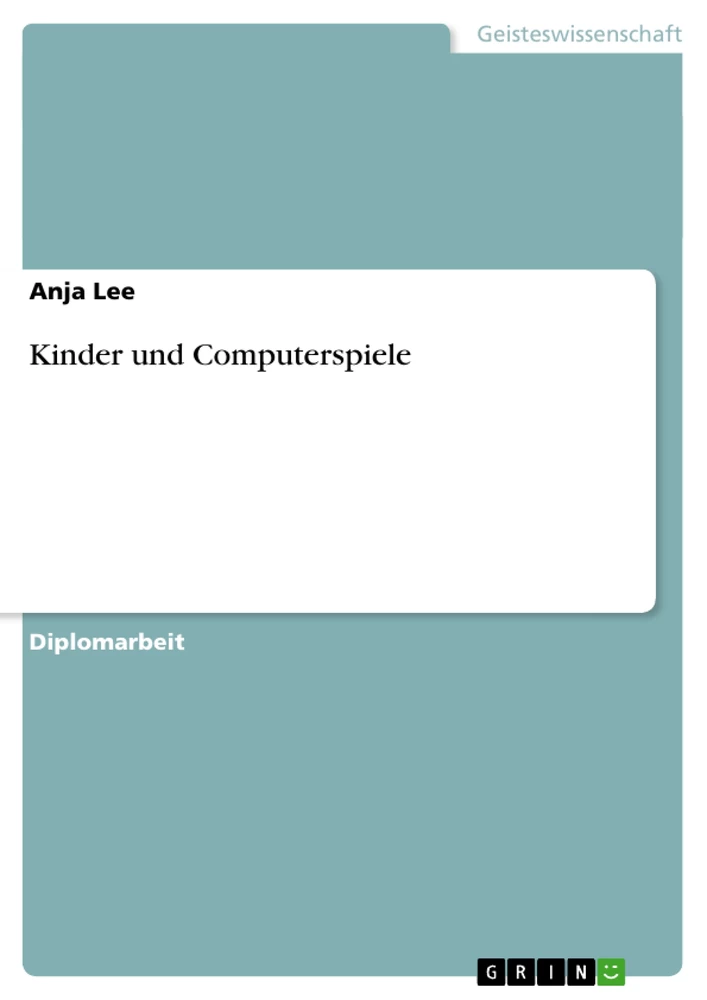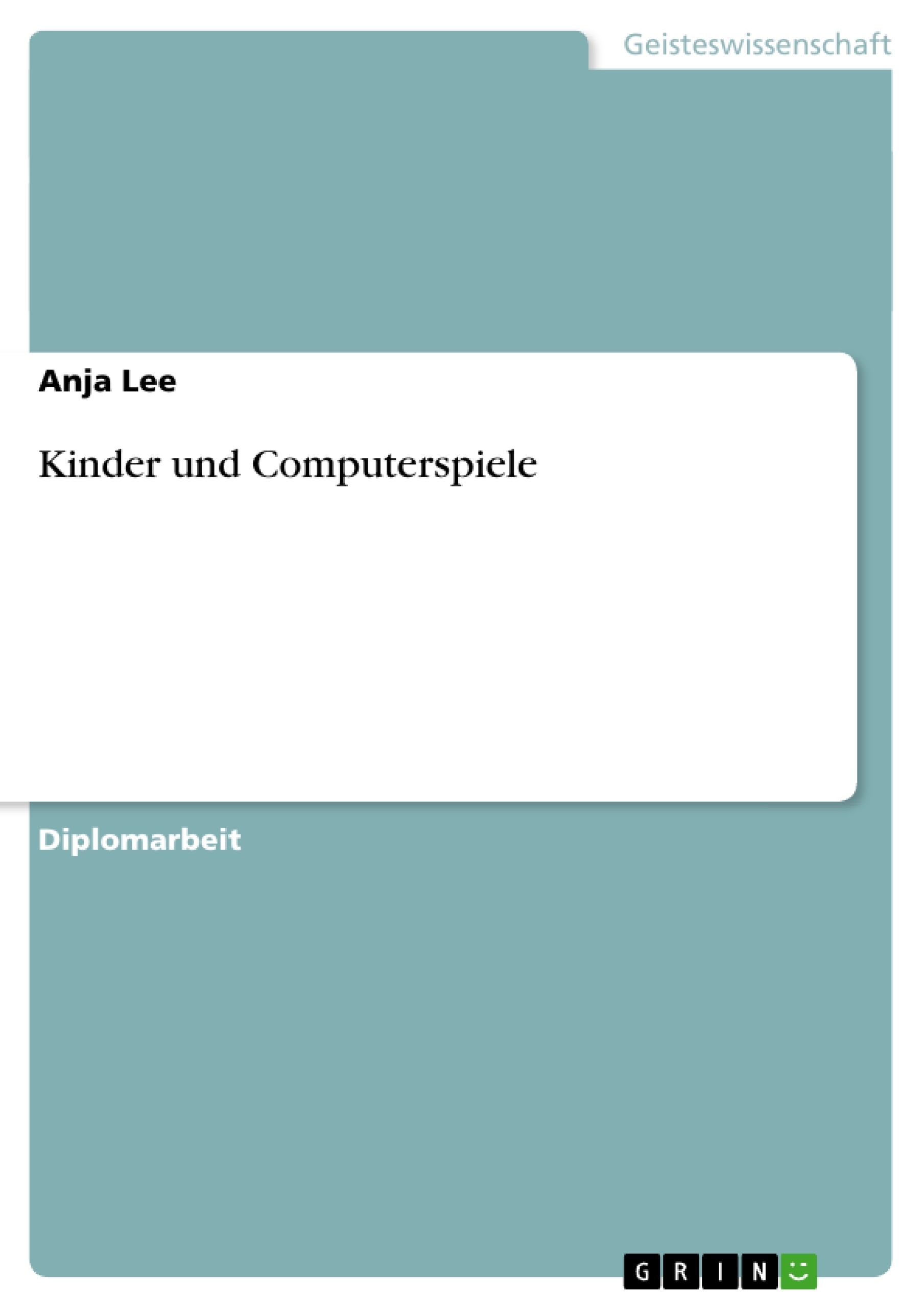Obwohl Computerspiele schon auf eine Geschichte von fast 30 Jahren zurückblicken können, zählen sie zu einem Mediengenre, welches den meisten Menschen eher fremd und in pädagogischer Hinsicht auch suspekt ist.
Selbst jüngere oder angehende Pädagogen, die selber eine Kindheit unter dem Einfluss von Radio, Hörspielen und dem umstrittenen Sozialisationsfaktor Fernsehen verbracht haben, haben große Vorbehalte und oftmals auch Vorurteile gegen dieses bei vielen Kindern und Jugendlichen beliebte Medium.
In vielen Diskussionen um das Pro und Contra der Computerspiele sowohl mit Eltern als auch mit Studentinnen und Pädagoginnen habe ich auch persönlich festgestellt, dass eine fundierte Kenntnis medienpädagogischer Grundlagen einerseits, aber andererseits auch das Wissen um aktuelle Entwicklungen wichtig und hilfreich sind, wenn es darum geht, beratend tätig zu sein oder wirksame Überzeugungsarbeit zum Thema leisten zu können, die besseres Verstehen und Einsicht bewirken kann.
Allein dieser Umstand erscheint für mich interessant genug, um das Thema Computerspiele einmal näher zu betrachten und den Vorbehalten, aber auch den ebenfalls existierenden Lobreden, auf den Grund zu gehen und mir vor dem Hintergrund medienpädagogischer Erkenntnisse und Überlegungen ein eigenes Bild von den Auswirkungen zu machen.
Prämisse war für mich hierbei, das Material so zusammenzutragen und aufzuarbeiten, dass jemand, der sich gerne zu diesem Thema informieren möchte, ein umfangreiches Angebot medienpädagogischer Überlegungen erhält. Darüber hinaus findet er Hinweise dazu, wie es möglich ist, mit Hilfe wichtiger Kriterien Spiele beurteilen zu können und letztendlich zu einem eigenen Ergebnis zu kommen und zu entscheiden, inwiefern er es als sinnvoll erachtet, Computerspiele in die pädagogische Arbeit zu integrieren.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Medienpädagogik
- Rückblick auf die Grundtendenzen der medienpädagogischen Debatte
- Aktuelle Bedeutung der Medienpädagogik
- Neue Aufgaben der Medienpädagogik
- Zentrale Fragen der Medienpädagogik
- Unterschiedliche Ansätze der Medienpädagogik
- Der bewahrpädagogische Ansatz
- Der behütend-pflegende Ansatz
- Der bedürfnisorientierte Ansatz
- Kritische Medienerziehung
- Handlungs- und kommunikationsorientierter Ansatz
- Integrative Medienerziehung
- Wahrnehmungsorientierte Medienpädagogik
- Abschließende Betrachtung der verschiedenen Ansätze
- Medienkompetenz
- Medien und kindliche Lebenswelten
- Was ist „Kindheit“?
- Geschichte der Kindheit am Beispiel der Ausführungen Ariés' und de Mauses
- Die 6-12 Jährigen in der „konkret-operationalen Phase“
- Entwicklungsstand und Computerspiele
- Medienkindheit seit Beginn des Fernsehens
- Die 50er Jahre
- Die 60er Jahre
- Die 70er Jahre
- Die 80er Jahre
- Die 90er Jahre
- 2000 bis heute
- Mediensozialisation
- Medien in den sozialökologischen Zonen der Kindheit
- Veränderte Grundvoraussetzungen der Generationen
- Auswirkungen des Generationsunterschiedes auf die pädagogische Einstellung
- Medienwirkungsansätze
- "Uses and Gratifications Approach"
- Wissens-Kluft-Ansatz
- Mediensozialisatorische Ansätze
- Alltags- und lebensweltliche Ansätze
- Fazit
- Was ist „Kindheit“?
- Computerspiele im Spiegel der Medienpädagogik
- Geschichte des Computers
- Entwicklung der Computerspiele
- Die Landschaft der Computerspiele
- Education, Edutainment, Entertainment
- Unterschiedliche Spielkategorien
- Computerspiele – PRO und CONTRA
- Suchtgefahr
- Computerspiele stumpfen ab und verhindern Kreativität
- Das Spielen am Computer setzt die Kinder unter Stress und Leistungsdruck
- Das Denken wird digitalisiert und Technikgläubigkeit gefördert
- Vereinsamung vor dem Computer und Verlust von Primärerfahrungen
- Computerspiele machen aggressiv und gewaltbereit und vermitteln Vorurteile und Klischees
- Computerspiele sind Schuld an schlechten Schulleistungen und Delinquenz
- Krieg, Gewalt und Computerspiele
- Krieg führen und Krieg spielen
- Krieg spielen als Verarbeitung
- Fazit
- Mädchen und Computerspiele
- Die Geschlechterrollen in Computerspielen
- Unterschiedliche Präferenzen
- Pädagogischer Nutzen
- „Computer machen Kinder schlau“
- Spielend lernen
- Fazit
- Die Beurteilung eines Computerspieles
- Allgemeine Überlegungen
- Kriterien verschiedener Institutionen
- Produktbezogene Beurteilungskriterien
- Pädagogische Beurteilungskriterien
- Unterschiedliche Aspekte der Spielbeurteilungen
- Wichtige Kriterien
- Beurteilungskriterien der Kinder
- Warum spielen Kinder?
- Welche Merkmale sind Kindern wichtig?
- Diskussion der Unterschiede
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung von Computerspielen im Kontext der Medienpädagogik, insbesondere für Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren. Ziel ist es, ein fundiertes Verständnis der verschiedenen medienpädagogischen Ansätze zu vermitteln und ihre Anwendbarkeit auf die Beurteilung von Computerspielen zu beleuchten. Die Arbeit soll darüber hinaus helfen, Vorurteile gegenüber Computerspielen abzubauen und eine differenzierte Betrachtungsweise zu fördern.
- Medienpädagogische Ansätze und ihre Relevanz für die Auseinandersetzung mit Computerspielen
- Entwicklungspsychologische Aspekte des Kindesalters (6-12 Jahre) im Umgang mit Medien
- Analyse der Vor- und Nachteile von Computerspielen
- Entwicklung und Geschichte von Computerspielen
- Kriterien zur pädagogischen Beurteilung von Computerspielen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung erläutert die Notwendigkeit einer fundierten Auseinandersetzung mit Computerspielen im Kontext der Medienpädagogik, insbesondere angesichts weit verbreiteter Vorurteile. Sie betont die Bedeutung medienpädagogischer Grundlagen und aktueller Entwicklungen für eine kompetente Beratung und Überzeugungsarbeit. Die Arbeit zielt darauf ab, ein umfassendes Angebot an medienpädagogischen Überlegungen zu liefern und Hilfestellung bei der Beurteilung von Computerspielen zu bieten.
Medienpädagogik: Dieses Kapitel liefert einen Überblick über die Geschichte und die aktuellen Herausforderungen der Medienpädagogik. Es werden verschiedene Ansätze der Medienpädagogik vorgestellt und diskutiert, um ein breites Verständnis für die theoretischen Grundlagen zu schaffen, die für die Analyse der Wirkung von Computerspielen auf Kinder unerlässlich sind.
Unterschiedliche Ansätze der Medienpädagogik: Dieses Kapitel beschreibt verschiedene Ansätze der Medienpädagogik detailliert, von bewahrenden bis hin zu handlungsorientierten und integrativen Ansätzen. Es analysiert die Stärken und Schwächen jedes Ansatzes und zeigt deren Relevanz für das Verständnis des Umgangs mit Medien im Allgemeinen und Computerspielen im Besonderen.
Medien und kindliche Lebenswelten: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Verständnis von Kindheit und der Entwicklungsphase von 6- bis 12-jährigen Kindern. Es verbindet den Entwicklungsstand dieser Altersgruppe mit den Anforderungen und Reizen von Computerspielen. Ein historischer Überblick über die Medienentwicklung in Deutschland seit den 1950er Jahren bildet die Grundlage für die Betrachtung der Mediensozialisation.
Computerspiele im Spiegel der Medienpädagogik: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Geschichte und Entwicklung von Computerspielen, analysiert die verschiedenen Spielkategorien und bewertet die Argumente für und gegen Computerspiele. Es untersucht kritische Aspekte wie Suchtgefahr, Gewalt und den Einfluss auf die soziale Entwicklung. Zusätzlich werden geschlechtsspezifische Unterschiede im Umgang mit Computerspielen berücksichtigt.
Pädagogischer Nutzen: Dieses Kapitel konzentriert sich auf den potentiellen pädagogischen Nutzen von Computerspielen. Es beleuchtet, wie Computerspiele zum Lernen beitragen können und argumentiert für den Einsatz von Computerspielen als pädagogisches Werkzeug unter bestimmten Voraussetzungen.
Die Beurteilung eines Computerspieles: Dieses Kapitel befasst sich mit verschiedenen Kriterien zur Beurteilung von Computerspielen. Es unterscheidet zwischen allgemeinen, produktbezogenen und pädagogischen Kriterien und berücksichtigt auch die Perspektive der Kinder selbst. Die unterschiedlichen Beurteilungsperspektiven werden diskutiert und verglichen.
Schlüsselwörter
Medienpädagogik, Computerspiele, Kinder (6-12 Jahre), Medienkompetenz, Mediensozialisation, Entwicklungspsychologie, pädagogische Beurteilung, Gewalt, Suchtprävention, Lernen, Edutainment.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Medienpädagogik und Computerspiele
Was ist der Hauptfokus dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Bedeutung von Computerspielen im Kontext der Medienpädagogik, insbesondere für Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren. Sie analysiert verschiedene medienpädagogische Ansätze und deren Anwendbarkeit auf die Beurteilung von Computerspielen, um Vorurteile abzubauen und eine differenzierte Betrachtungsweise zu fördern.
Welche medienpädagogischen Ansätze werden behandelt?
Die Arbeit beschreibt verschiedene Ansätze der Medienpädagogik detailliert, darunter bewahrpädagogische, behütend-pflegende, bedürfnisorientierte, kritische, handlungs- und kommunikationsorientierte, integrative und wahrnehmungsorientierte Ansätze. Die Stärken und Schwächen jedes Ansatzes werden analysiert und deren Relevanz für den Umgang mit Medien und Computerspielen im Besonderen aufgezeigt.
Wie wird die Entwicklungspsychologie von 6- bis 12-jährigen Kindern berücksichtigt?
Die Arbeit betrachtet den Entwicklungsstand von 6- bis 12-jährigen Kindern in der „konkret-operationalen Phase“ und setzt diesen in Beziehung zu den Anforderungen und Reizen von Computerspielen. Ein historischer Überblick über die Medienentwicklung seit den 1950er Jahren bildet die Grundlage für die Betrachtung der Mediensozialisation in dieser Altersgruppe.
Welche Vor- und Nachteile von Computerspielen werden diskutiert?
Die Arbeit analysiert sowohl die potenziellen positiven Aspekte von Computerspielen (z.B. Lernen, Edutainment) als auch die kritischen Aspekte wie Suchtgefahr, Gewalt, Einfluss auf die soziale Entwicklung, und den Einfluss auf die Schulleistungen. Geschlechtsspezifische Unterschiede im Umgang mit Computerspielen werden ebenfalls berücksichtigt.
Welche Kriterien zur Beurteilung von Computerspielen werden vorgestellt?
Die Arbeit präsentiert verschiedene Kriterien zur Beurteilung von Computerspielen, darunter allgemeine, produktbezogene und pädagogische Kriterien. Sie berücksichtigt auch die Perspektive der Kinder selbst und diskutiert die Unterschiede zwischen den verschiedenen Beurteilungsperspektiven.
Wie wird die Geschichte der Computerspiele behandelt?
Die Arbeit beinhaltet einen Überblick über die Geschichte der Computerspiele, von der Entwicklung des Computers bis hin zur heutigen Vielfalt an Spielkategorien. Die Entwicklung der Computerspiele wird im Kontext der gesellschaftlichen und technischen Entwicklungen betrachtet.
Welche Rolle spielt die Medienkompetenz?
Die Arbeit unterstreicht die Bedeutung von Medienkompetenz im Umgang mit Computerspielen und betont die Notwendigkeit einer fundierten Auseinandersetzung mit den verschiedenen Aspekten der Medienpädagogik, um Kinder optimal zu unterstützen und zu beraten.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit zielt darauf ab, ein umfassendes Verständnis für die verschiedenen medienpädagogischen Ansätze im Kontext von Computerspielen zu vermitteln und eine differenzierte Betrachtungsweise zu fördern. Sie soll helfen, Vorurteile gegenüber Computerspielen abzubauen und eine fundierte Grundlage für die Beurteilung von Computerspielen zu liefern. Ein Resümee fasst die wichtigsten Ergebnisse zusammen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt?
Medienpädagogik, Computerspiele, Kinder (6-12 Jahre), Medienkompetenz, Mediensozialisation, Entwicklungspsychologie, pädagogische Beurteilung, Gewalt, Suchtprävention, Lernen, Edutainment.
- Quote paper
- Anja Lee (Author), 2002, Kinder und Computerspiele, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/5676