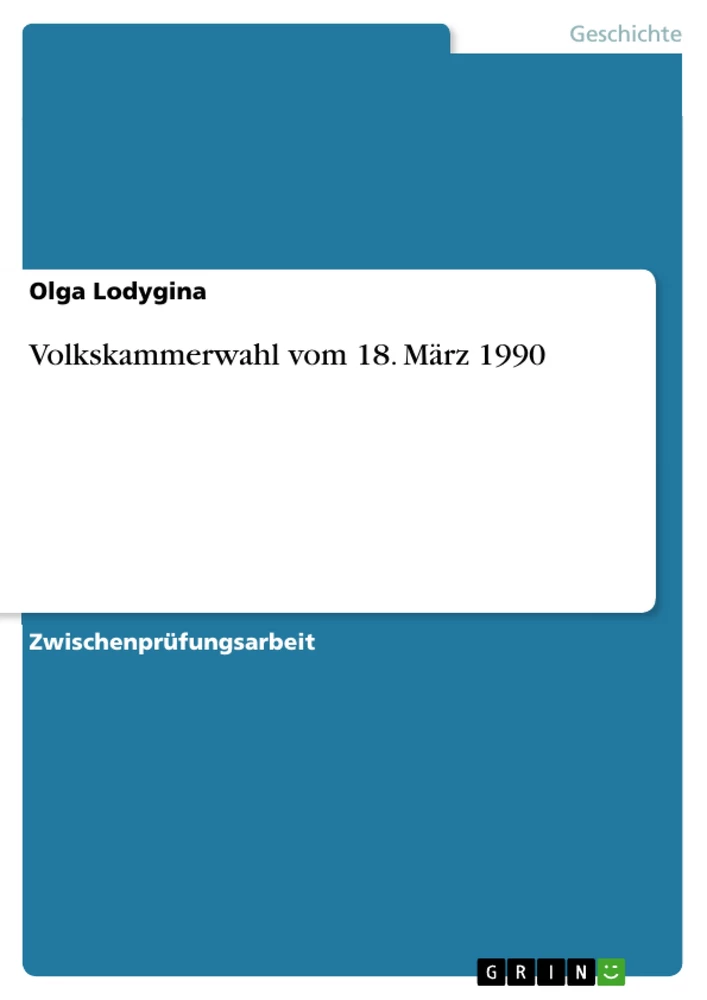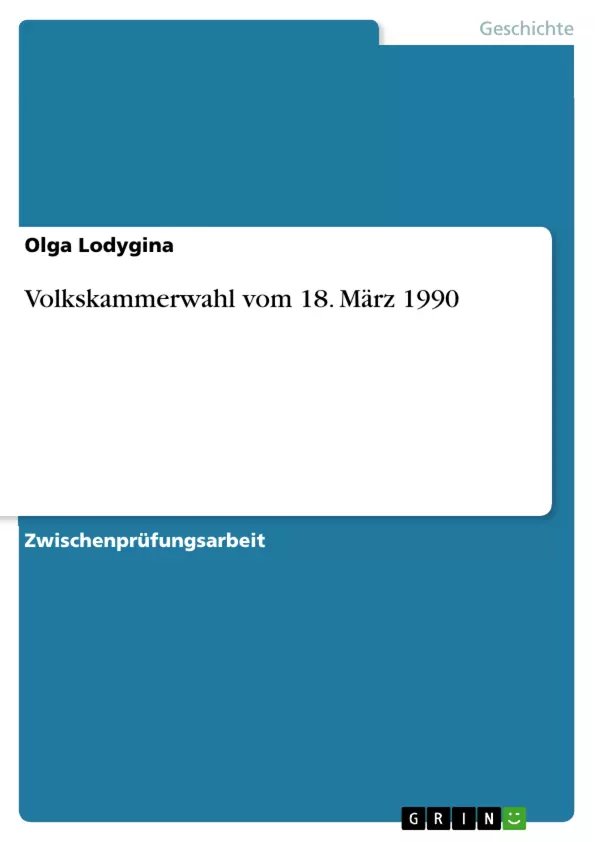1990 war das letzte Jahr der Deutschen Demokratischen Republik. Seit dem Fall der Berliner Mauer am 9. November 1989 war alles schnell gegangen. Die Geschwindigkeit der grundlegenden politischen Veränderungen wurde von der DDR-Bevölkerung und ihrem Willen bestimmt. Die scheinbar stabile Herrschaft der SED mit dem vermeintlich einheitlichen Gefüge von Partei, Staat und Gesellschaft hatte der revolutionären Volksbewegung nichts entgegenzusetzen.
Nach dem Sturz der SED-Herrschaft ging es zunächst darum, die Voraussetzungen für ein demokratisches Staatswesen zu schaffen. Das alte Parteiensystem der DDR war formal ein Mehrheitsparteiensystem unter Vormachtstellung der SED. Die SED beteiligte auch andere Parteien an der Machtausübung: die CDU, die LDPD, die DBD und die NDPD, die formal im Gremium alle wichtigen politischen Entscheidungen beraten und verabschieden sollten. Allmählich entwickelte sich der Demokratische Block jedoch zu einem reinen Vollzugsorgan der SED-Politik. Vom politischen Entscheidungsprozess waren die Blockparteien ausgeschlossen. Sie alle erkannten die führende Rolle der SED an. Für die SED waren sie ein scheinpluralistisches Instrument zur Machtsicherung .
Ende 1989 löste das sozialistische Parteiensystem auf. Die Blockparteien trennten sich von der SED und bildeten eigenständige Organisationen. Sie entwickelten sich auch untereinander zu Konkurrenten. Alte Parteien der Opposition konstituierten und profilierten sich programmatisch, organisatorisch und personell als Bewegungen und Parteien, die sich für einen allmählichen Selbstreinigungsprozess entschieden. Nach und nach entstand eine grundlegend neue Parteienlandschaft.
Die ersten demokratischen Wahlen zur Volkskammer fanden am 18. März 1990 statt. Sie sollten das durch die Veränderungen entstandene Machtvakuum ausfüllen sowie eine demokratisch legitimierte Volksvertretung und eine handlungsfähige Regierung hervorbringen, die als rechtmäßige Partner zusammen mit Bundestag und Bundesregierung den Prozess der Vereinigung gestallten konnten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Politische Situation Oktober 1989 bis März 1990
- Der Vertrauensverlust von Millionen Bürgern gegenüber der politischen Führung des Landes
- Die spontane und schnelle Bewegung, die sich in Demonstrationen sammelte
- Der Anfang revolutionärer Umwälzung, deren Charakter und Ziele durch das Volk geprägt waren
- Volkskammerwahl vom 18. März 1990
- Die Entstehung des Parteiensystems in der DDR. Der Wahlkampf
- Programmatische Konzepte
- Das Wahlergebnis vom 18. März
- Das Wahlgesetz für die Volkskammer
- Zusammenfassung
- Anhang
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Volkskammerwahl vom 18. März 1990 in der DDR. Sie analysiert die politischen und gesellschaftlichen Umbrüche in der DDR im Vorfeld der Wahl sowie die Entstehung des neuen Parteiensystems. Die Arbeit beleuchtet die Rahmenbedingungen, den Verlauf und die Ergebnisse der Wahl sowie die programmatischen Konzepte der beteiligten Parteien.
- Der Zusammenbruch des sozialistischen Parteiensystems in der DDR
- Die Entstehung eines neuen Parteiensystems und der freie Wahlkampf
- Die Bedeutung der Volkskammerwahl für den Vereinigungsprozess
- Die Ergebnisse der Wahl und die Bedeutung für die politische Landschaft in der DDR
- Die Herausforderungen und Chancen der neu entstandenen politischen Strukturen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beschreibt die politische Situation in der DDR von Oktober 1989 bis März 1990. Es analysiert die Ursachen für den Vertrauensverlust in die SED-Führung, die Entstehung der Bürgerbewegung und die Auswirkungen der Öffnung der Grenzübergänge zur Bundesrepublik Deutschland und nach West-Berlin am 9. November 1989.
Das zweite Kapitel beleuchtet die Volkskammerwahl vom 18. März 1990. Es analysiert die Entstehung des neuen Parteiensystems, den Wahlkampf und die programmatischen Konzepte der beteiligten Parteien. Der Schwerpunkt liegt auf den Veränderungen im politischen Leben der DDR und den Herausforderungen, die sich durch den Übergang zu einem demokratischen System stellten.
Das dritte Kapitel behandelt das Wahlergebnis vom 18. März 1990 und analysiert die Bedeutung der Wahl für den Vereinigungsprozess. Es geht auf das Wahlgesetz für die Volkskammer ein und beschreibt die Auswirkungen der Wahl auf die politische Landschaft in der DDR.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit Themen wie dem Zusammenbruch des Sozialismus in der DDR, der Entstehung eines neuen Parteiensystems, der Volkskammerwahl 1990, dem Wahlkampf, den programmatischen Konzepten der Parteien, den Wahlergebnissen und der Bedeutung der Wahl für den Vereinigungsprozess.
Häufig gestellte Fragen
Warum war die Volkskammerwahl am 18. März 1990 historisch so bedeutend?
Es war die erste und einzige freie und demokratische Wahl in der Geschichte der DDR, die den Weg für die deutsche Wiedervereinigung ebnete.
Was passierte mit den ehemaligen „Blockparteien“ der DDR?
Die Blockparteien (wie CDU und LDPD) lösten sich Ende 1989 von der Vorherrschaft der SED, bildeten eigenständige Organisationen und entwickelten sich zu demokratischen Wettbewerbern.
Wer gewann die Volkskammerwahl 1990?
Die „Allianz für Deutschland“ (ein Bündnis aus CDU, DA und DSU) ging als klarer Sieger aus der Wahl hervor, was ein deutliches Votum für eine schnelle Wiedervereinigung war.
Wie veränderte sich die Parteienlandschaft in der DDR vor der Wahl?
Nach dem Sturz der SED-Herrschaft entstanden zahlreiche neue Bürgerbewegungen und Parteien, die das politische Machtvakuum füllten und für demokratische Reformen eintraten.
Welches Ziel verfolgte die neue Volkskammer-Regierung?
Die Regierung sollte als demokratisch legitimierter Partner zusammen mit der Bundesregierung den Prozess der Vereinigung gestalten.
- Arbeit zitieren
- Olga Lodygina (Autor:in), 2006, Volkskammerwahl vom 18. März 1990, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/56664