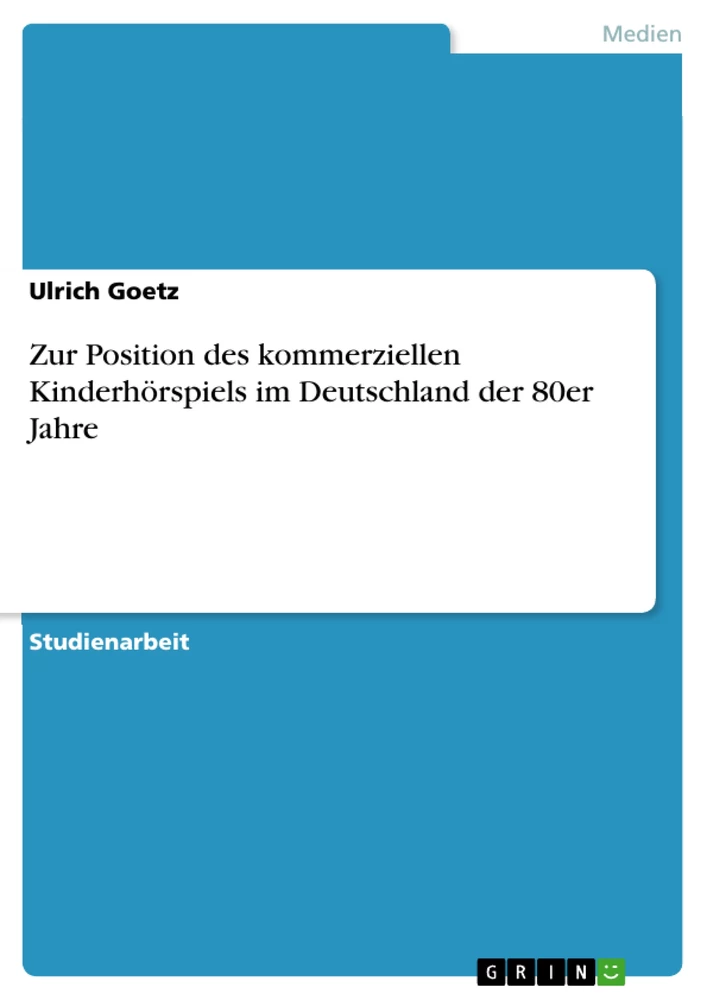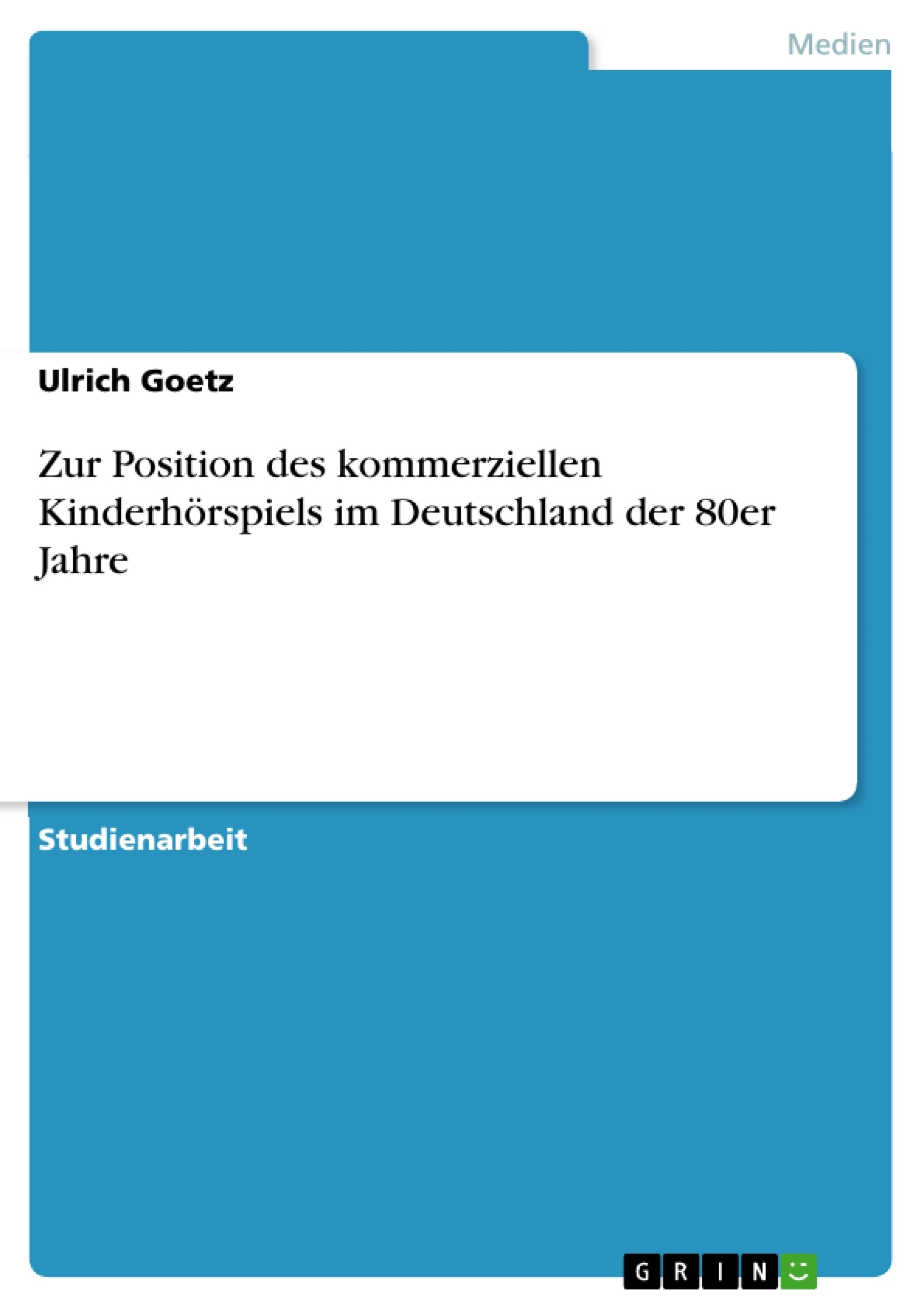Eine wissenschaftliche Untersuchung des deutschen Hörspiels zeichnet sich traditionell durch zwei grundlegende Prämissen aus: Erstens, daß das Hörspiel eine Tonkunst sei, welches primär von Radiomachern für Radiohörer konzipiert werde. Zweitens, daß das eigens für Kinder produzierte Hörspiel unter pädagogischen Gesichtspunkten untersucht werden müsse.
Ulrich Goetz versucht, hier einen radikalen Paradigmenwechsel zu vollziehen. Er stützt sich dabei primär auf Annette Bastians These, der zufolge das kommerzielle Kinderhörspiel jene deutschen Kinder, welche zwischen 1975 und 1985 geboren wurden, entscheidend geprägt habe. Das Ziel dieser Arbeit besteht somit nicht in einer abstrakten Theoriebildung. Ulrich Goetz versucht vielmehr, eine logisch nachvollziehbare Positionsbestimmung des kommerziellen Kinderhörspiels in Deutschland zu liefern. Um den Rahmen einer Hausarbeit nicht zu sprengen, beschränkt er sich dabei auf den Zeitrahmen der 80er Jahre.
Das Ziel dieser Hausarbeit besteht NICHT darin, einen Vergleich "Pro oder Kontra öffentlich-rechtliches Kinderhörspiel" aufzustellen. Goetz beschäftigt sich in der ersten Hälfte dieser Untersuchung allein deshalb mit der Position des öffentlich-rechtlichen Kinderhörspiels, um es präzise von seinem kommerziellen Pendant abgrenzen zu können.
Der Autor hat im Anhang dieser Arbeit ein Interview mit Jörgpeter Ahlers (Redaktionsleiter "Radio für Kinder“ beim NDR seit 1990) beigefügt, welches den Zusammenhang zwischen öffentlich-rechtlichem und kommerziellem Kinderhörspiel stärker thematisiert. Ferner hat er eine Liste von Internetverweisen erstellt, welche es dem interessierten Leser ermöglichen soll, seine Kenntnisse zu der Thematik dieser Arbeit zu erweitern und zu vertiefen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Das Hörspiel: Versuch einer Definition
- Das Hörspiel und sein Verhältnis zu neuen Medien
- Das Hörspiel als Kinderformat im deutschen Rundfunk
- Zum pädagogischen Anspruch von Kinderhörspielen
- Die Major Companies der kommerziellen Kinderhörspiele
- Das "Zeitfenster" der 80er Jahre
- Der "Kultfaktor"
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Position des kommerziellen Kinderhörspiels in Deutschland in den 1980er Jahren. Sie wendet sich von traditionellen Ansätzen ab, die das Hörspiel primär als Tonkunst des Rundfunks und Kinderhörspiele unter pädagogischen Aspekten betrachten. Stattdessen konzentriert sie sich auf den Einfluss kommerzieller Kinderhörspiele auf die Generation der „Kassettenkinder“ (geboren zwischen 1975 und 1985), basierend auf der These von Annette Bastian. Die Arbeit zielt auf eine logisch nachvollziehbare Positionsbestimmung des kommerziellen Kinderhörspiels im genannten Zeitraum, ohne Vollständigkeit anzustreben.
- Definition und Abgrenzung des Hörspiels
- Das kommerzielle Kinderhörspiel im Kontext neuer Medien der 80er Jahre
- Der Einfluss kommerzieller Produktionen auf Kinder
- Pädagogische Aspekte und deren Relevanz
- Die Rolle der "Major Companies"
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die These von Annette Bastian vor, die besagt, dass kommerzielle Kinderhörspiele die Generation der zwischen 1975 und 1985 Geborenen maßgeblich geprägt haben. Die Arbeit beabsichtigt, diese These zu untersuchen und eine Positionsbestimmung des kommerziellen Kinderhörspiels in den 1980er Jahren zu liefern, wobei der Fokus auf Tonkassetten als Verbreitungsmedium liegt. Die Limitationen der Arbeit, wie die Unmöglichkeit der vollständigen Erfassung aller Veröffentlichungen, werden transparent gemacht. Ein Vergleich zwischen öffentlich-rechtlichem und kommerziellem Kinderhörspiel wird explizit ausgeschlossen, das öffentlich-rechtliche Hörspiel dient lediglich der Abgrenzung. Das beigefügte Interview mit Jörgpeter Ahlers sowie die Linkliste im Anhang sollen die Untersuchung ergänzen.
Hauptteil (1.1. Das Hörspiel: Versuch einer Definition): Dieses Kapitel beleuchtet den schwierigen Prozess der Definition eines Hörspiels. Es stützt sich auf Karsts Definition, die das Hörspiel als ein Spiel definiert, das ausschließlich durch Hörbares realisiert wird und ein gleichberechtigtes Neben- und Übereinander von Ton, Geräusch, Wort und Stimme aufweist. Die Abhängigkeit von technischen Rahmenbedingungen, die unscharfe Abgrenzung zum Feature und die Bedeutung der Ästhetik jenseits technischer Perfektion werden diskutiert. Karsts Betonung auf die öffentliche Zugänglichkeit des Materials für Selbsterfahrung, Artikulationsschulung und Medienkunde wird ebenfalls hervorgehoben. Die Grenzen der Definition werden durch die Entwicklungen der 80er Jahre wie die Einführung von Stereoton verdeutlicht.
Schlüsselwörter
Kommerzielles Kinderhörspiel, Kassettenkinder, 1980er Jahre, Tonkassette, Pädagogik, öffentliche-rechtliches Hörspiel, Medien, Kultur, Major Companies, Jörgpeter Ahlers, Radio für Kinder.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Kommerzielle Kinderhörspiele der 1980er Jahre in Deutschland
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung kommerzieller Kinderhörspiele in Deutschland in den 1980er Jahren, insbesondere ihren Einfluss auf die „Kassettenkinder“ (Geburtsjahrgänge 1975-1985). Sie weicht von traditionellen Betrachtungsweisen ab, die sich auf den Rundfunk und pädagogische Aspekte konzentrieren, und fokussiert stattdessen auf die kommerzielle Seite des Phänomens.
Welche These wird untersucht?
Die Arbeit basiert auf der These von Annette Bastian, wonach kommerzielle Kinderhörspiele die Generation der Kassettenkinder maßgeblich geprägt haben. Die Arbeit zielt darauf ab, diese These zu überprüfen und die Position dieser Hörspiele im Kontext der 1980er Jahre zu bestimmen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition und Abgrenzung des Hörspiels, den Einfluss kommerzieller Kinderhörspiele im Kontext neuer Medien der 80er Jahre, den Einfluss dieser Produktionen auf Kinder, pädagogische Aspekte und deren Relevanz sowie die Rolle der großen Produktionsfirmen ("Major Companies").
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen Hauptteil und ein Fazit. Der Hauptteil untersucht verschiedene Aspekte des kommerziellen Kinderhörspiels, beginnend mit einer Definition des Hörspiels selbst und der Betrachtung im Kontext der 80er Jahre. Es werden die "Major Companies", der "Kultfaktor" und das "Zeitfenster" der 80er Jahre beleuchtet. Die Einleitung stellt die These und den Forschungsansatz vor, während das Fazit die Ergebnisse zusammenfasst.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf verschiedene Quellen. Ein explizit genanntes Beispiel ist ein Interview mit Jörgpeter Ahlers. Weitere Quellen sind in der Linkliste im Anhang enthalten (diese sind im vorliegenden HTML-Auszug nicht enthalten).
Wie wird das Hörspiel definiert?
Die Arbeit bezieht sich auf Karsts Definition des Hörspiels als ein Spiel, das ausschließlich durch Hörbares realisiert wird und ein gleichberechtigtes Neben- und Übereinander von Ton, Geräusch, Wort und Stimme aufweist. Die Schwierigkeiten bei der Definition werden angesichts der technischen Entwicklungen der 80er Jahre (z.B. Stereoton) hervorgehoben.
Welche Einschränkungen hat die Arbeit?
Die Arbeit räumt ein, dass eine vollständige Erfassung aller Veröffentlichungen im untersuchten Zeitraum unmöglich ist. Ein Vergleich zwischen öffentlich-rechtlichem und kommerziellem Kinderhörspiel wird explizit ausgeschlossen; öffentlich-rechtliche Hörspiele dienen lediglich der Abgrenzung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Kommerzielles Kinderhörspiel, Kassettenkinder, 1980er Jahre, Tonkassette, Pädagogik, öffentlich-rechtliches Hörspiel, Medien, Kultur, Major Companies, Jörgpeter Ahlers, Radio für Kinder.
- Quote paper
- Ulrich Goetz (Author), 2005, Zur Position des kommerziellen Kinderhörspiels im Deutschland der 80er Jahre, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/56564