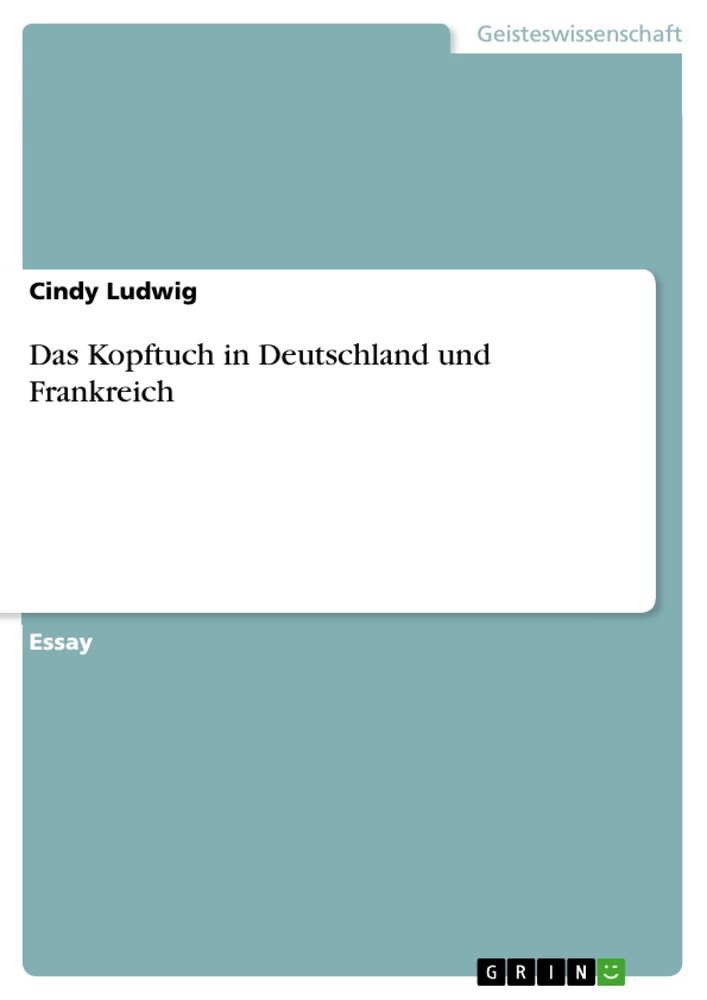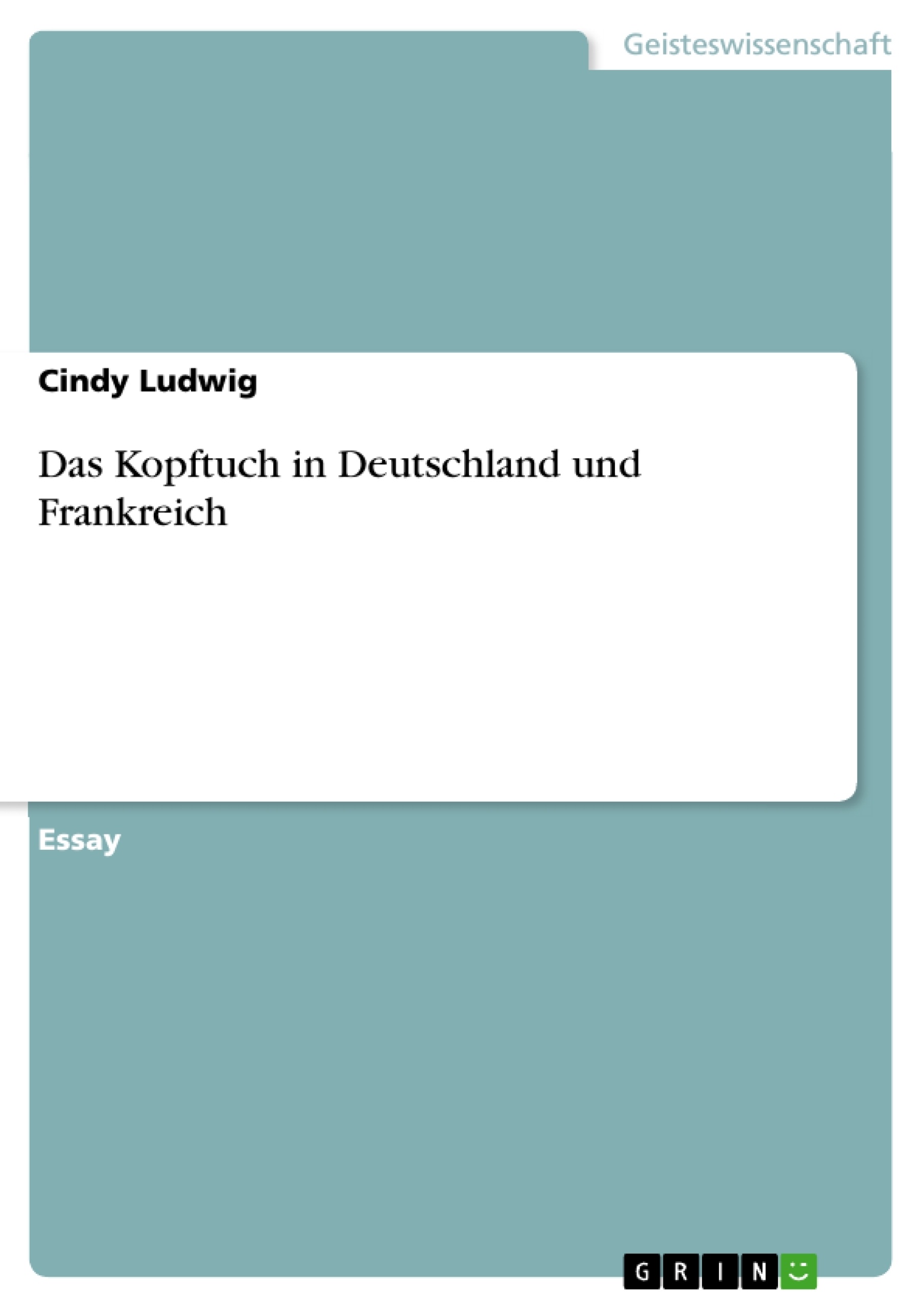Eine Kopfbedeckung - sie diente wohl ihrem Erfinder zunächst nur als Schutz vor den Witterungseinflüssen der Natur. Aber schon lange benutzen Könige, Päpste und andere führende Personen Kopfbedeckungen, um sich und Ihre Funktion auch optisch herauszustellen bzw. sich zu „erhöhen“. Gruppen von Menschen verwenden Kopfbedeckungen mit uniformen Charakter, allerdings mit unterschiedlichsten Zielen. Zu nennen sind hier exemplarisch Ziele wie Gleichschaltung der einzelnen Individuen, Machtgewinn bzw. Machterhalt durch einen mit einhergehenden Gruppenzwang. Religiös motivierte Kopfbedeckungen bedienen sich u.a. auch einer gewissen Symbolik. In dieser Hinsicht unterscheiden sie sich in keiner Weise von Symbolen, wie sie in allen Ideologien verwendet werden. Letztendlich zeigen sie öffentlich, dass sich ihr Träger mit gewissen Regeln, Werten und Zielen identifiziert. Das einzelne Individuum unterwirft sich gewissen Einschränkungen, um nicht anarchisch dem Gesetz des Stärkeren zu unterliegen. - Oder aber eine „Mehrheit“ benutzt Symbole, um Randgruppen auszugrenzen, wie zum Beispiel die Häftlingskleidung oder den Judenstern im dritten Reich.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Regeln im Islam contra Werteverlust
- Entwicklung in Deutschland
- Kopftuch und internationale Demokratie
- Die Situation in Frankreich
- Parallelgesellschaft
- Resümee
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit untersucht die Debatte um das Kopftuch in Deutschland und Frankreich und beleuchtet die Hintergründe und die komplexen Konfliktlinien. Ziel ist es, die verschiedenen Perspektiven auf das Kopftuch als Symbol, als Ausdruck von religiöser Identifikation und als potentielles Zeichen von Unterdrückung zu beleuchten.
- Die Rolle des Kopftuchs im Islam und seine verschiedenen Bedeutungen
- Die Debatte um das Kopftuch in Deutschland und Frankreich im Kontext der Religionsfreiheit und der Integration
- Der Einfluss von Medien und Politik auf die öffentliche Wahrnehmung des Kopftuchs
- Die Spannungen zwischen dem Individualismus und dem Kollektivismus in Bezug auf das Kopftuch
- Die Frage der Integration und des Zusammenlebens in multikulturellen Gesellschaften im Kontext des Kopftuchstreits
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Kopftuchs ein und beleuchtet dessen historische Entwicklung als Symbol und seine verschiedenen Bedeutungen.
- Regeln im Islam contra Werteverlust: Dieses Kapitel analysiert die religiösen Hintergründe des Kopftuchs im Islam und stellt sie in Bezug zu den Werten und Normen der westlichen Gesellschaften. Die Bedeutung der Kleiderordnung im Islam und die Rolle des Kopftuchs als Symbol von Religiosität und Weiblichkeit werden beleuchtet.
- Entwicklung in Deutschland: Das Kapitel beschreibt die Entwicklung des Kopftuchstreits in Deutschland am Beispiel der Klage der Lehrerin Fereshta Ludin. Es untersucht die rechtlichen und gesellschaftlichen Aspekte der Debatte und die unterschiedlichen Positionen von Politik, Bildungseinrichtungen und der Zivilgesellschaft.
- Kopftuch und internationale Demokratie: Dieses Kapitel analysiert die Rolle des Kopftuchs im Kontext der internationalen Demokratie und der Religionsfreiheit. Es beleuchtet verschiedene Argumente, die für und gegen das Tragen des Kopftuchs in öffentlichen Bereichen vorgebracht werden, und untersucht die Spannungen zwischen dem Recht auf freie Religionsausübung und dem Recht auf Gleichheit und Nichtdiskriminierung.
Schlüsselwörter
Kopftuch, Islam, Religionsfreiheit, Integration, Kultur, Identität, Demokratie, Toleranz, Gleichheit, Diskriminierung, Feminismus, Unterdrückung, Pluralismus, Europa, Deutschland, Frankreich, Medien, Politik, Zivilgesellschaft, Recht, Bildung, Schule, Identität, Macht, Symbol, Tradition.
- Quote paper
- Cindy Ludwig (Author), 2006, Das Kopftuch in Deutschland und Frankreich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/56331