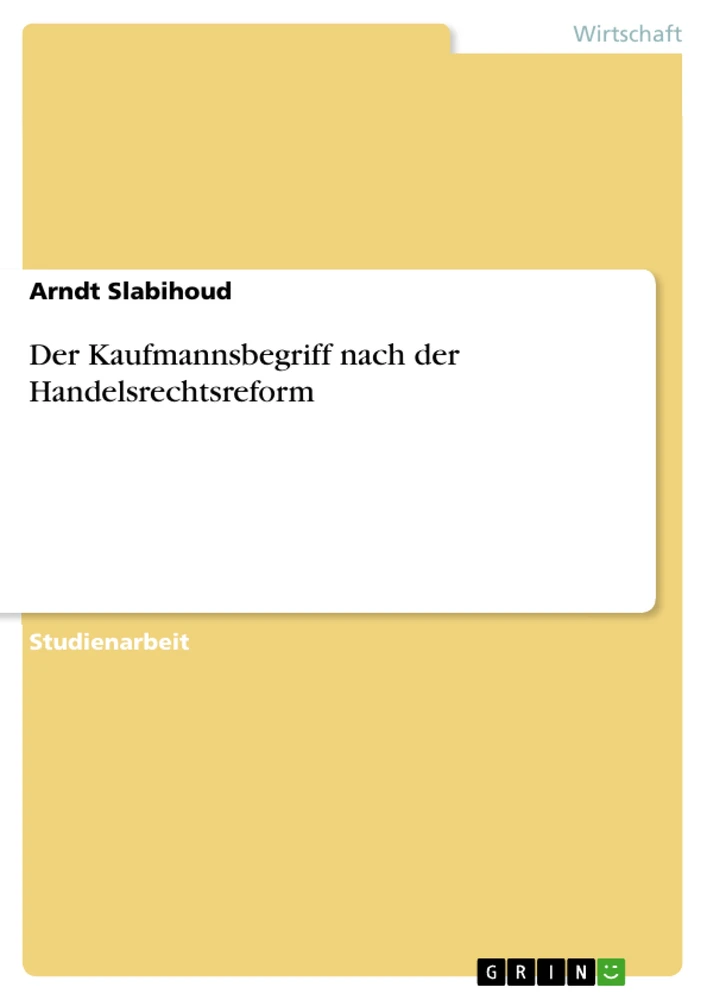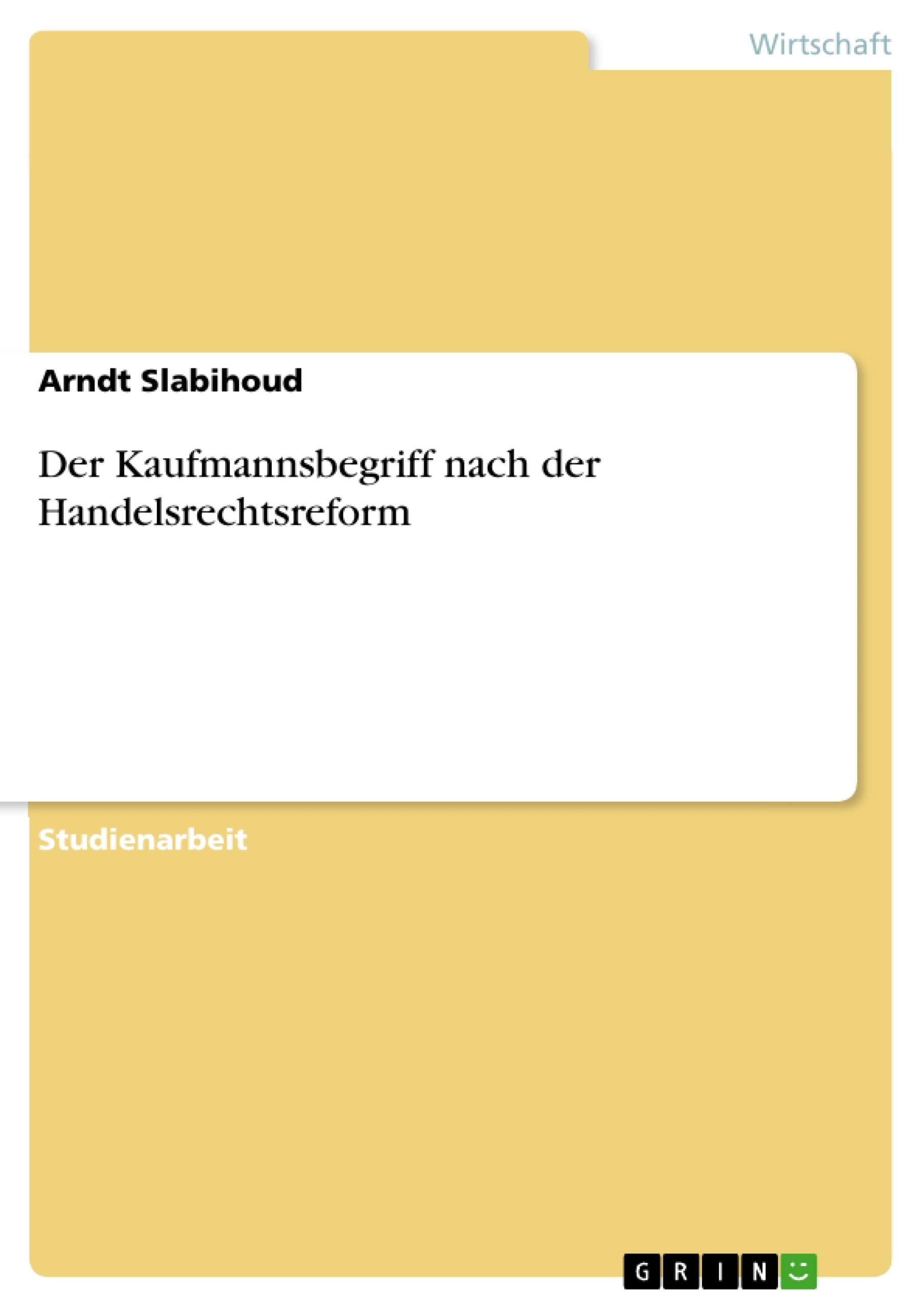Nach seinem Artikel 28 ist am 1.Juli 1998 das Gesetz zur Neuregelung des Kaufmanns- und Firmenrechts zur Änderung handels- und gesellschaftsrechtlicher Vorschriften (Handelsrechtsreformgesetz-HRefG) in Kraft getreten.
Grundlegende Ziele der Reform sind die Liberalisierung des Firmenrechts, die Modernisierung des Kaufmannsbegriffs und verschiedene Neuregelungen im Recht der Personenhandelsgesellschaften.
Das bisher geltende Handels- und Gesellschaftsrecht sollte zugunsten einer größeren Handlungsfreiheit der Unternehmen einer Deregulierung und Vereinfachung unterzogen werden, um möglichen Nachteilen im europäischen Wettbewerb entgegenzuwirken.
Das Zentrum des Handelsrechtsreformgesetzes bildet die Neukonzeption des Kaufmannsbegriffes nach den §§ 1 bis 4 HGB. Der bisherige Begriff des Kaufmanns, der im wesentlichen bereits aus der Ur-Fassung des HGB`s vom 1.1.1990 stammte und schon seit langem als unzeitgemäß und in seiner Abgrenzung als überkomplex betrachtet wurde, wurde nun zum ersten Mal richtig verändert. Dieses Reformvorhaben ist bereits seit Ende des Jahres 1991 in der Diskussion als der Deutsche Industrie- und Handelstag (DIHT) an das Bundesministerium der Justiz (BMJ) mit der Forderung herantrat, das Handelsrecht zu vereinfachen.
Aufgrund eines Beschlusses der 63. Justizministerkonferenz im Mai 1992 wurde im September eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Handelsrecht und Handelsregister“ unter dem Vorsitz des BMJ geschaffen. Nach Vorlegung eines Zwischenberichtes im März 1994 gegenüber der Konferenz der Justizministerinnen und -minister wurde am 18.7. 1996 schließlich ein Referentenentwurf des BMJ vorgestellt. Die Einzelheiten dieser Konzeption blieben auch nach Beschlussempfehlung des Rechtsauschusses gegenüber dem Regierungsentwurf vom April 1997 unverändert, so daß letztlich der Bundestag am 3.4.1998 nach Abschluß seiner Beratungen der Gesetzesvorlage in den Ausschüssen das Handelsrechtsreformgesetz verabschiedet hat.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Reformbedürftigkeit des Kaufmannsbegriffs im bisherigen Handelsrecht
- Rechtliche Bedeutung
- Kurzdarstellung
- Nachteile
- Der Kaufmannsbegriff im neuen Handelsrecht
- Neudefinierung
- Eintragungsoption für Kleingewerbetreibende
- Auswirkungen auf die Handelsgesellschaften
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Reform des Kaufmannsbegriffs im deutschen Handelsrecht, die mit dem Handelsrechtsreformgesetz (HRefG) im Juli 1998 in Kraft trat. Die Arbeit analysiert die Gründe für die Reformbedürftigkeit des alten Begriffs, beleuchtet die Neuregelungen und deren Auswirkungen auf Unternehmen und das Handelsregister.
- Reformbedürftigkeit des bisherigen Kaufmannsbegriffs
- Neudefinierung des Kaufmannsbegriffs im HRefG
- Auswirkungen der Reform auf Handelsgesellschaften
- Eintragungsoption für Kleingewerbetreibende
- Rechtliche Bedeutung des Kaufmannsbegriffs
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Handelsrechtsreformgesetz (HRefG) ein, welches am 1. Juli 1998 in Kraft trat und grundlegende Ziele wie die Liberalisierung des Firmenrechts und die Modernisierung des Kaufmannsbegriffs verfolgt. Die Reform zielt auf eine Deregulierung und Vereinfachung des Handelsrechts, um die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen im europäischen Kontext zu stärken. Besonderes Augenmerk liegt auf der Neukonzeption des Kaufmannsbegriffs in den §§ 1 bis 4 HGB, der als überkomplex und unzeitgemäß galt und erstmals grundlegend verändert wurde. Die Entstehungsgeschichte der Reform, beginnend mit Forderungen des DIHT an das BMJ, wird kurz skizziert, einschließlich der Arbeit der Bund-Länder-Arbeitsgruppe und des Gesetzgebungsprozesses.
Reformbedürftigkeit des Kaufmannsbegriffs im bisherigen Handelsrecht: Dieses Kapitel analysiert die rechtliche Bedeutung des Kaufmannsbegriffs im alten Handelsrecht. Die Anwendbarkeit handelsrechtlicher Vorschriften hängt entscheidend von der Kaufmannseigenschaft mindestens einer beteiligten Person ab. Das Kapitel erläutert, wie die Kaufmannseigenschaft den Zugang zum Handelsregister, die Führung einer Firma, die Erteilung von Prokura und die Anwendung besonderer Regeln für Arbeitsverhältnisse beeinflusst. Gleichzeitig werden die Nachteile für Gewerbetreibende im Rechtsverkehr im Detail dargestellt, beispielsweise hinsichtlich der Formfreiheit bei Bürgschaften, Zinsregelungen, gutgläubigem Erwerb und der Rügepflicht. Die komplizierte Unterscheidung zwischen „Mußkaufmann“ und „Kannkaufmann“ wird als zentraler Kritikpunkt des alten Systems hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Kaufmannsbegriff, Handelsrecht, Handelsrechtsreformgesetz (HRefG), Handelsregister, Unternehmen, Gewerbetreibende, Liberalisierung, Deregulierung, Mußkaufmann, Kannkaufmann, Personenhandelsgesellschaften, Firma, Prokura.
Häufig gestellte Fragen zur Seminararbeit: Reform des Kaufmannsbegriffs im deutschen Handelsrecht
Was ist der Gegenstand der Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die Reform des Kaufmannsbegriffs im deutschen Handelsrecht, die mit dem Handelsrechtsreformgesetz (HRefG) von 1998 in Kraft trat. Sie analysiert die Gründe für die Reformbedürftigkeit des alten Begriffs, die Neuregelungen und deren Auswirkungen auf Unternehmen und das Handelsregister.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit deckt folgende Themen ab: die Reformbedürftigkeit des bisherigen Kaufmannsbegriffs, die Neudefinierung im HRefG, die Auswirkungen der Reform auf Handelsgesellschaften, die Eintragungsoption für Kleingewerbetreibende und die rechtliche Bedeutung des Kaufmannsbegriffs. Die Einleitung beschreibt das HRefG und dessen Ziele (Liberalisierung des Firmenrechts, Modernisierung des Kaufmannsbegriffs). Ein Kapitel analysiert die Nachteile des alten Systems, insbesondere die komplexe Unterscheidung zwischen „Mußkaufmann“ und „Kannkaufmann“.
Warum war eine Reform des Kaufmannsbegriffs notwendig?
Der alte Kaufmannsbegriff galt als überkomplex und unzeitgemäß. Die Seminararbeit erläutert die Nachteile für Gewerbetreibende im Rechtsverkehr, wie z.B. hinsichtlich der Formfreiheit bei Bürgschaften, Zinsregelungen, gutgläubigem Erwerb und der Rügepflicht. Die komplizierte Unterscheidung zwischen „Mußkaufmann“ und „Kannkaufmann“ wird als zentraler Kritikpunkt hervorgehoben.
Was beinhaltet die Reform des Kaufmannsbegriffs?
Die Reform umfasste eine Neudefinierung des Kaufmannsbegriffs in den §§ 1 bis 4 HGB. Die Arbeit beleuchtet die Neuregelungen und deren Auswirkungen, insbesondere auf Handelsgesellschaften und die Eintragungsoption für Kleingewerbetreibende. Ein Fokus liegt auf der Deregulierung und Vereinfachung des Handelsrechts zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen.
Welche Auswirkungen hat die Reform auf Handelsgesellschaften und Gewerbetreibende?
Die Seminararbeit analysiert die Auswirkungen der Reform auf Handelsgesellschaften und beleuchtet die neue Eintragungsoption für Kleingewerbetreibende. Die Arbeit zeigt auf, wie die Kaufmannseigenschaft den Zugang zum Handelsregister, die Führung einer Firma, die Erteilung von Prokura und die Anwendung besonderer Regeln für Arbeitsverhältnisse beeinflusst.
Welche Schlüsselbegriffe sind für das Verständnis der Seminararbeit relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Kaufmannsbegriff, Handelsrecht, Handelsrechtsreformgesetz (HRefG), Handelsregister, Unternehmen, Gewerbetreibende, Liberalisierung, Deregulierung, Mußkaufmann, Kannkaufmann, Personenhandelsgesellschaften, Firma, Prokura.
Welche Quellen werden in der Seminararbeit verwendet?
Die Seminararbeit enthält ein Literaturverzeichnis (im bereitgestellten HTML-Code nicht vollständig enthalten). Es wird auf einschlägige Literatur und Gesetzestexte zum Handelsrecht verwiesen.
Wo finde ich die Kapitelzusammenfassungen?
Die Seminararbeit bietet Kapitelzusammenfassungen, die die Kernaussagen der einzelnen Kapitel (Einleitung und Reformbedürftigkeit des Kaufmannsbegriffs) knapp und prägnant zusammenfassen. Diese Zusammenfassungen bieten einen schnellen Überblick über den Inhalt der Arbeit.
- Quote paper
- Arndt Slabihoud (Author), 1998, Der Kaufmannsbegriff nach der Handelsrechtsreform, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/55928