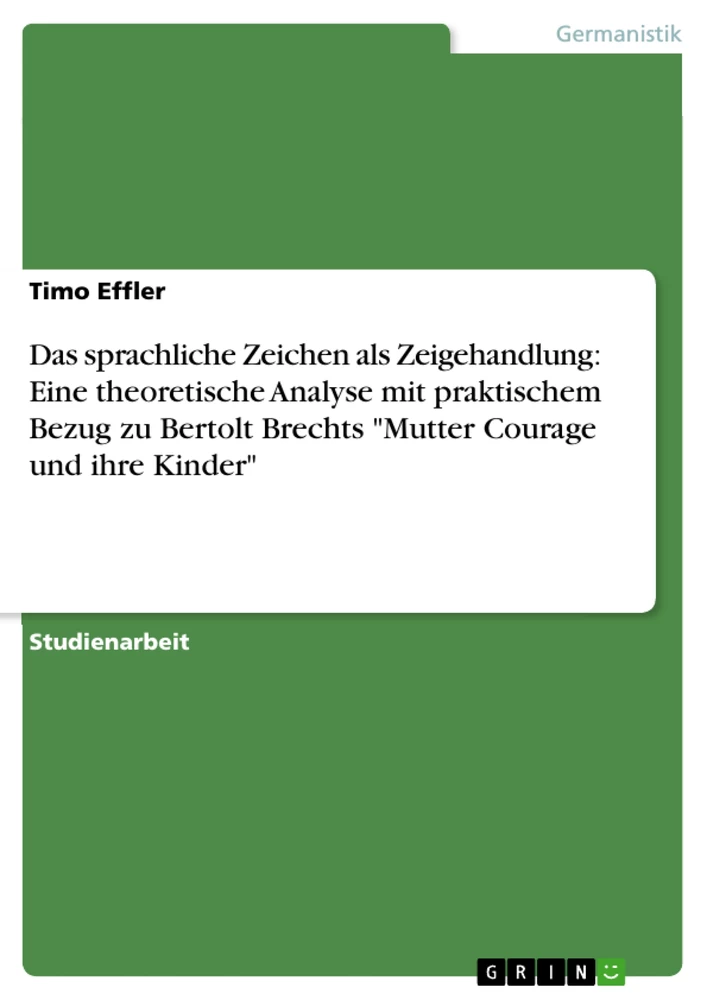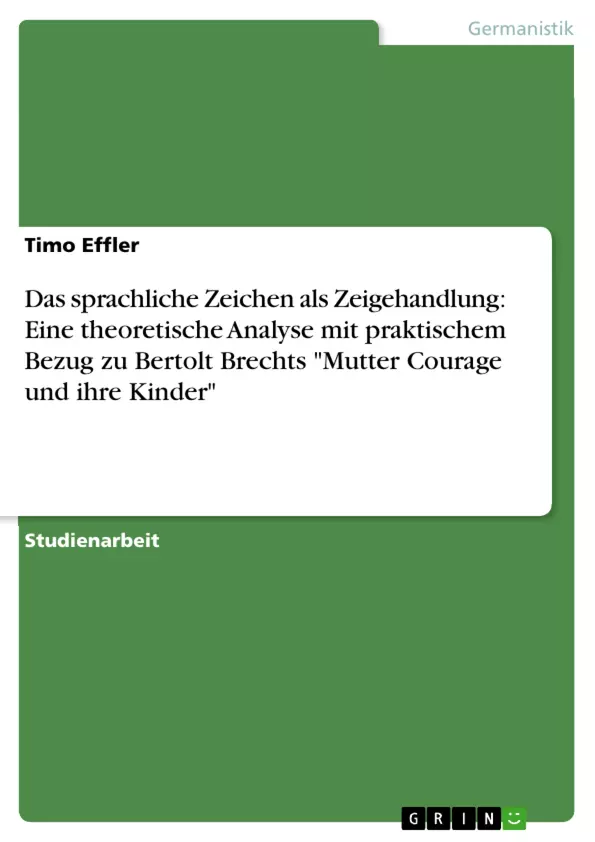Solange es Literatur gibt, wird über die Wirkungsabsicht der produzierten Texte diskutiert. Jeder Leser versucht hinter den Zeilen, die er liest, hinter der Geschichte, die er miterlebt, eine Botschaft zu entschlüsseln, die bald chiffriert und versteckt und kaum erkennbar im Hintergrund bleibt, bald völlig offensichtlich als Plakat dem Leser vor Augen geführt wird. Der Leser sucht den direkten Draht zum Autor, möchte seine Gedanken direkt erfahren, doch der Text, den er liest, die Inszenierung, die er sieht, stellt zwar eine Brücke dar, da sie das einzige Verbindungsglied zwischen dem Autor, der dieses literarische Zeichen sendet, und dem Leser bzw. Zuschauer, der es empfängt, ist, steht aber auch für ein unüberwindbares Hindernis, da das literarische Zeichen zwar als Vermittler zwischen Leser und Autor fungiert, dessen Ideen genau abzubilden jedoch nicht imstande ist.
Deswegen wird häufig heftig debattiert, was der Autor eines Textes aussagen möchte. Wie kann es dazu kommen? Offensichtlich deuten verschiedene Leser den gleichen Text individuell. Diese Hausarbeit möchte zunächst theoretisch untersuchen, wodurch Möglichkeiten zur unterschiedlichen Interpretation eines Textes auftreten können und ins Zentrum der Auseinandersetzung soll das linguistische Phänomen gestellt werden, von dem die Wirkungsabsicht eines Autors abzuleiten ist, die Zeigehandlung. Ein besonderes Augenmerk soll auch der von einer Zeigehandlung ausgehenden Handlungsaufforderung an den Leser gewidmet werden. Diesen Begriffen wird sich im Laufe dieser Ausführungen schrittweise angenährt, indem die verschiedenen Prozesse, die bei der Rezeption eines Textes auftreten, nachvollzogen werden. Um nicht allzu sehr in der Theorie zu verharren, wird stets der Bezug auf einen literarischen Text gesucht. Hier erschien es sehr passend, „Mutter Courage und ihre Kinder“ von Bertolt Brecht zu wählen, da diesem Autor eine recht offensichtliche Aussageabsicht unterstellt werden kann: Er wollte durch seine Werke im Leser eine pazifistische und sozialistische politische Einstellung hervorrufen. Wie diese durch Zeigehandlungen bewirkten Handlungsaufforderungen beim Leser bzw. Zuschauer angekommen sind und wie es zu eventuell auftretenden Missverständnissen kommen konnte, wird ebenso untersucht werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Ein Text als Zeichen?
- 2. Die Handlungsdefinition vom Kamlah/Lorenzen
- 3. Handeln und verstehen: Handlungen als Exemplare von Handlungsschemata
- 4. Sprechakttheorie und Drama
- 5. Der Begriff der Zeigehandlung in sprachlichem und nicht sprachlichem Kontext
- 6. Peirce: Interpretant, Abduktion
- 7. Die Rezeption von „Mutter Courage und ihre Kinder“ bei Publikum und Presse
- 8. Wann „funktioniert“ eine Zeigehandlung in einem literarischen Text: Ein Modell
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Wirkungsabsicht literarischer Texte, insbesondere die Rolle der Zeigehandlung in der Kommunikation zwischen Autor und Rezipient. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie unterschiedliche Interpretationen eines Textes entstehen und wie die Handlungsaufforderung des Autors beim Leser ankommt. Die Arbeit analysiert das sprachliche Zeichen anhand des Organonmodells von Karl Bühler und bezieht sich exemplarisch auf Bertolt Brechts „Mutter Courage und ihre Kinder“.
- Das sprachliche Zeichen als Zeigehandlung
- Interpretationsspielräume und Missverständnisse in der Kommunikation
- Die Rolle des Autors, des Textes und des Rezipienten
- Handlungsaufforderung und appellativer Charakter des Textes
- Anwendung der Theorie auf Brechts „Mutter Courage und ihre Kinder“
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Wirkungsabsicht literarischer Texte ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem Verständnis von Zeigehandlungen im Kontext der Rezeption. Sie begründet die Wahl von Brechts „Mutter Courage und ihre Kinder“ als Fallbeispiel aufgrund der vermeintlich klaren pazifistischen und sozialistischen Botschaft des Autors. Die Arbeit kündigt eine schrittweise Annäherung an die Thematik an, wobei die theoretischen Überlegungen stets mit Bezug auf den literarischen Text verbunden werden.
1. Ein Text als Zeichen?: Dieses Kapitel diskutiert die Charakterisierung eines literarischen Textes als Zeichen und greift dazu auf Karl Bühlers Organonmodell der Sprache zurück. Es analysiert die Komponenten des Modells (Sender, Zeichen, Empfänger, Appell) im Kontext des literarischen Werkes und zeigt, wie ein Text als symbolische Darstellung von Gegenständen und Sachverhalten verstanden werden kann. Die Frage nach der Eindeutigkeit der Zeichen und der Möglichkeit von Missverständnissen wird bereits hier angesprochen.
2. Die Handlungsdefinition vom Kamlah/Lorenzen (und folgende Kapitel): [Anmerkung: Aufgrund der fehlenden weiteren Textauszüge, können die Kapitelzusammenfassungen für Kapitel 2-8 nicht erstellt werden. Um diese Sektion zu vervollständigen, ist der vollständige Text erforderlich.]
Schlüsselwörter
Zeigehandlung, Sprachliches Zeichen, Interpretationsmöglichkeiten, Handlungsaufforderung, Appell, Rezeption, Literatur, Drama, Bertolt Brecht, Mutter Courage und ihre Kinder, Organonmodell, Karl Bühler.
Häufig gestellte Fragen zu: Wirkungsabsicht literarischer Texte - Eine Analyse der Zeigehandlung anhand von Brechts "Mutter Courage und ihre Kinder"
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Wirkungsabsicht literarischer Texte, insbesondere die Rolle der Zeigehandlung in der Kommunikation zwischen Autor und Rezipient. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie unterschiedliche Interpretationen eines Textes entstehen und wie die Handlungsaufforderung des Autors beim Leser ankommt. Die Arbeit analysiert das sprachliche Zeichen anhand des Organonmodells von Karl Bühler und bezieht sich exemplarisch auf Bertolt Brechts „Mutter Courage und ihre Kinder“.
Welche zentralen Themen werden behandelt?
Zentrale Themen sind das sprachliche Zeichen als Zeigehandlung, Interpretationsspielräume und Missverständnisse in der Kommunikation, die Rolle von Autor, Text und Rezipient, die Handlungsaufforderung und der appellative Charakter des Textes sowie die Anwendung der Theorie auf Brechts „Mutter Courage und ihre Kinder“.
Welches Modell wird zur Analyse des sprachlichen Zeichens verwendet?
Die Arbeit verwendet das Organonmodell von Karl Bühler zur Analyse des sprachlichen Zeichens im Kontext literarischer Texte. Dieses Modell betrachtet die Komponenten Sender, Zeichen, Empfänger und Appell.
Welche Rolle spielt Bertolt Brechts "Mutter Courage und ihre Kinder"?
Brechts „Mutter Courage und ihre Kinder“ dient als Fallbeispiel, um die theoretischen Überlegungen zur Zeigehandlung und Rezeption konkret zu veranschaulichen. Die vermeintlich klare Botschaft des Autors bietet einen interessanten Ausgangspunkt für die Analyse von Interpretationsspielräumen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit enthält eine Einleitung, ein Kapitel zur Charakterisierung eines literarischen Textes als Zeichen, ein Kapitel zur Handlungsdefinition von Kamlah/Lorenzen und weitere Kapitel (deren Inhalt aufgrund fehlender Textauszüge hier nicht zusammengefasst werden kann), sowie eine Schlussbemerkung.
Was sind die Schlüsselwörter der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Zeigehandlung, Sprachliches Zeichen, Interpretationsmöglichkeiten, Handlungsaufforderung, Appell, Rezeption, Literatur, Drama, Bertolt Brecht, Mutter Courage und ihre Kinder, Organonmodell, Karl Bühler.
Wie wird die Frage nach der Eindeutigkeit von Zeichen behandelt?
Die Frage nach der Eindeutigkeit von Zeichen und der Möglichkeit von Missverständnissen wird bereits im ersten Kapitel angesprochen und im Verlauf der Arbeit anhand des Beispieltextes weiter vertieft.
Welche Forschungsfrage steht im Mittelpunkt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Wie funktioniert die Zeigehandlung in einem literarischen Text und wie entsteht ein Verständnis (oder Missverständnis) beim Rezipienten?
- Citation du texte
- Timo Effler (Auteur), 2004, Das sprachliche Zeichen als Zeigehandlung: Eine theoretische Analyse mit praktischem Bezug zu Bertolt Brechts "Mutter Courage und ihre Kinder", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/55662