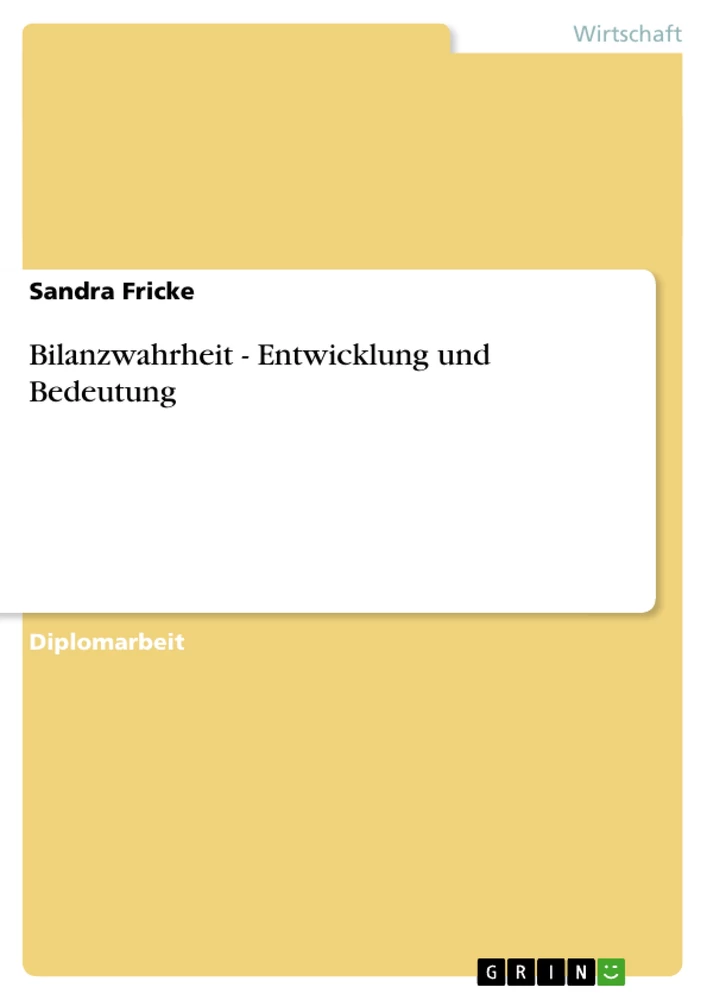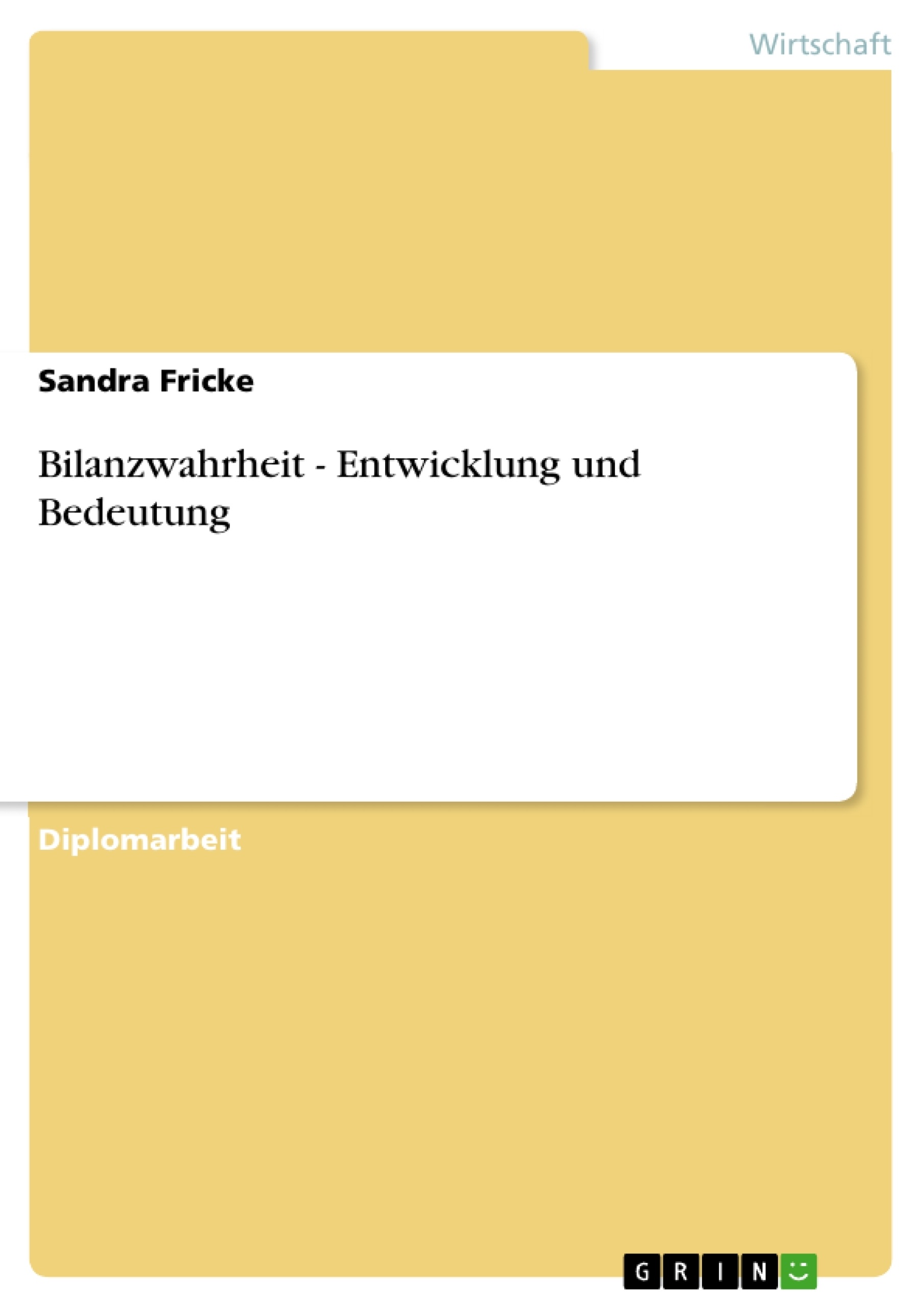Der Grundsatz der Bilanzwahrheit steht in einem Spannungsverhältnis zwischen den Wünschen der verschiedenen Jahresabschlussadressaten nach möglichst umfassenden und vor allem ungeschminkten Informationen über die Lage des Unternehmens und das Ausüben von Bilanzpolitik von der Unternehmerseite aus. Hauptanliegen der 4. und 7. EG-Richtlinie war es den Informationsgehalt des Jahresabschlusses zu erhöhen und diesen verlässlicher ,,wahrer bzw. true and fairer" zu gestalten. Simon schrieb in seinem Buch ,,Die Bilanzen der Aktiengesellschaften": ,,Bilanzwahrheit und Bilanzklarheit - dies können nur die Ziele bedeuten, auf die man hinarbeiten soll, die man aber vollständig nie erreichen wird". Das auf eine möglichst klare, durchsichtige Bilanz hinzuarbeiten ist, darüber besteht kein Zweifel, aber inwieweit man absolute bzw. relative Bilanzwahrheit erreichen kann oder will, wird im folgenden untersucht werden.
Fest steht, trotz der Generalklausel § 264 HGB birgt das aktuelle Recht noch immer eine Fülle von Möglichkeiten dem Grundsatz der Bilanzwahrheit zuwiderzuhandeln. Die Entscheidung des EuGH vom 14.9.1999 beinhaltet insoweit ein Novum, als Fragen des nationalen deutschen Bilanzsteuerrechts betroffen sind. Neben dem Grundsatz der Bilanzwahrheit und dem Grundsatz der Bilanzvorsicht stellt sich auch die Grundsatzfrage nach der Entscheidungskompetenz des EuGH in bilanzrechtlichen Fragestellungen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Problemstellung
- II. Der Begriff Wahrheit - eine Einführung
- 1. Wissen, was Wahrheit ist?
- 1.1. Die Korrespondenztheorie der Wahrheit
- 1.2. Die Evidenztheorie
- 1.3. Die Konsensustheorie
- 1.4. Die Redundanztheorie
- 2. Die gesellschaftlichen Grundwertungen im Bilanzrecht
- III. Bilanzwahrheit im Zusammenhang mit der Rechnungslegung
- 1. Zweckgerichtetheit der Bilanz in der Unternehmung
- 2. Allgemeine Grundsätze der Bilanzerstellung
- 2.1. Das System der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
- 2.2. Die GoB im Einzelnen
- 2.3. Der Grundsatz der Bilanzwahrheit
- IV. Historischer Abriss des Bilanzwahrheitsproblems
- 1. Auslegungen des Begriffes Bilanzwahrheit unter dem Gesichtspunkt verschiedener Theorien
- a) Der juristische Begriff von der Bilanzwahrheit
- b) Bilanzwahrheit nach statischer Auffassung
- c) Bilanzwahrheit in der organischen Bilanz
- d) Der dynamische Begriff der Bilanzwahrheit
- 2. Bilanzwahrheit in der Handelsbilanz der Aktiengesellschaft
- 2.1. Gesetzliche Verankerung der Bilanzwahrheit
- a) Der richtige Wert im Sinne des § 40 HGB 1896
- b) Leugnung der bindenden Kraft der allg. Bewertungsvorschrift
- c) Verbietet der § 40 nur eine zu günstige oder auch eine zu ungünstige Bilanzaufstellung
- 2.2. Zweck und Bewertungsvorschriften der Aktienbilanz
- 2.3. Das Problem der Bilanzwahrheit und stille Reserven
- a) Die stillen Reserven in der Bilanz der Aktiengesellschaft
- b) Über die Zulässigkeit stiller Reserven
- c) Zerstörung der Bilanzwahrheit durch unkontrollierbare stille Reserven
- d) Gründe für und gegen stille Reserven
- 3. Kann die Bilanz überhaupt wahr sein?
- V. Bilanzwahrheit de lege lata
- 1. Die Rechtslage de lege lata
- 2. Entstehungsgeschichte der Generalnorm
- 3. Die Generalnorm für den Jahresabschluß von Kapitalgesellschaften
- 3.1. Der Inhalt des true and fair view Gebots aus unterschiedlicher Sichtweise die wörtliche Auslegung
- 3.2. Der Begriffsinhalt aus britischer Sicht
- 3.3. Der Begriffsinhalt aus deutscher Sicht
- a) Vorrang der Generalnorm
- b) Vorrang der Einzelnormen
- c) Die sogenannte Abkopplungsthese nach Moxter
- d) Die Wahlrechtsproblematik bzw. Ermessensbeschränkung
- 3.4. Der Grundsatz der Materiality und sein Zusammenhang zum True and Fair View Gebot
- 4. True and Fair View oder Täuschung des Bilanzlesers
- a) Das Informationsinteresse an der VFE-Lage
- b) Verwässerung der Objektivierung
- 5. Sanktionen bei Nichtbeachtung der Bilanzwahrheit
- VI. Rechtsprechung auf Grundlage der Bilanzwahrheit
- 1. Sachverhalt im Rechtsstreit vom 14.9.1999 - Rs. C-275/97
- 2. Verpflichtung zur Bildung einer Pauschalrückstellung
- 3. Begründung zur Rückstellungshöhe
- VII. Bilanzwahrheit de lege ferenda
- 1. Ansätze zur internationalen Harmonisierung
- 1.1. Das Konzept des IAS
- a) Ziele und Funktionen
- b) Bilanzierungsgrundsätze
- 1.2. Das Konzept der US-GAAP
- a) Ziele und Funktionen
- b) Rechtsqualität der US-GAAP
- 1.3. Vorteile und Nachteile bzw. Kritik an US-GAAP, IAS und HGB
- 1.4. Kritik an der Harmonisierung
- 2. Möglichkeiten einer Angleichung nationaler Rechnungslegungsvorschriften
- a) Verbesserung der Übersichtlichkeit und Klarheit des Jahresabschlusses
- b) Nebenrechnungen
- c) Mehrfachbilanzen
- 3. Abschaffung des Maßgeblichkeitsprinzips
- 4. Empfehlung zur Verbesserung des Aussagegehalts der Rechnungslegung
- IV. Thesenförmige Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem komplexen Thema der Bilanzwahrheit im deutschen Bilanzrecht. Sie analysiert die verschiedenen Theorien und Konzepte, die zur Definition und Interpretation des Begriffs „Bilanzwahrheit“ beitragen. Darüber hinaus werden die historischen Entwicklungen des Begriffs sowie die aktuelle Rechtslage und zukünftige Herausforderungen im Kontext der internationalen Harmonisierung der Rechnungslegung beleuchtet.
- Definition und Entwicklung des Begriffs „Bilanzwahrheit“
- Analyse der verschiedenen Theorien und Konzepte zur Bilanzwahrheit
- Die Rechtslage und Rechtsprechung im Hinblick auf die Bilanzwahrheit
- Herausforderungen und Perspektiven der Bilanzwahrheit im Kontext der internationalen Harmonisierung
- Bedeutung und Auswirkungen der Bilanzwahrheit für die Stakeholder eines Unternehmens
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel I führt in die Problemstellung ein und erläutert die Relevanz des Themas Bilanzwahrheit. Kapitel II beleuchtet den Begriff Wahrheit im Allgemeinen und stellt verschiedene Theorien zur Definition von Wahrheit vor. In Kapitel III wird der Zusammenhang zwischen Bilanzwahrheit und der Rechnungslegung betrachtet, wobei insbesondere die Zweckgerichtetheit der Bilanz sowie die allgemeinen Grundsätze der Bilanzerstellung im Vordergrund stehen.
Kapitel IV gibt einen historischen Überblick über die Entwicklung des Bilanzwahrheitsproblems. Es werden verschiedene Auslegungen des Begriffs „Bilanzwahrheit“ aus unterschiedlichen Perspektiven vorgestellt. Kapitel V beschäftigt sich mit der aktuellen Rechtslage de lege lata, insbesondere mit der Entstehungsgeschichte der Generalnorm für den Jahresabschluss von Kapitalgesellschaften und der Bedeutung des true and fair view Gebots.
Kapitel VI beleuchtet die Rechtsprechung auf Grundlage der Bilanzwahrheit, wobei ein aktueller Rechtsstreit als Beispiel herangezogen wird. Kapitel VII befasst sich mit der Bilanzwahrheit de lege ferenda und analysiert Ansätze zur internationalen Harmonisierung der Rechnungslegung. Es werden die Konzepte des IAS und US-GAAP vorgestellt sowie die Vor- und Nachteile einer Harmonisierung diskutiert.
Schlüsselwörter
Bilanzwahrheit, Rechnungslegung, Bilanz, Wahrheit, Theorien, Rechtslage, Rechtsprechung, Harmonisierung, IAS, US-GAAP, HGB, Stakeholder, Unternehmensführung, Transparenz, Informationsqualität.
- Quote paper
- Sandra Fricke (Author), 2002, Bilanzwahrheit - Entwicklung und Bedeutung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/5555