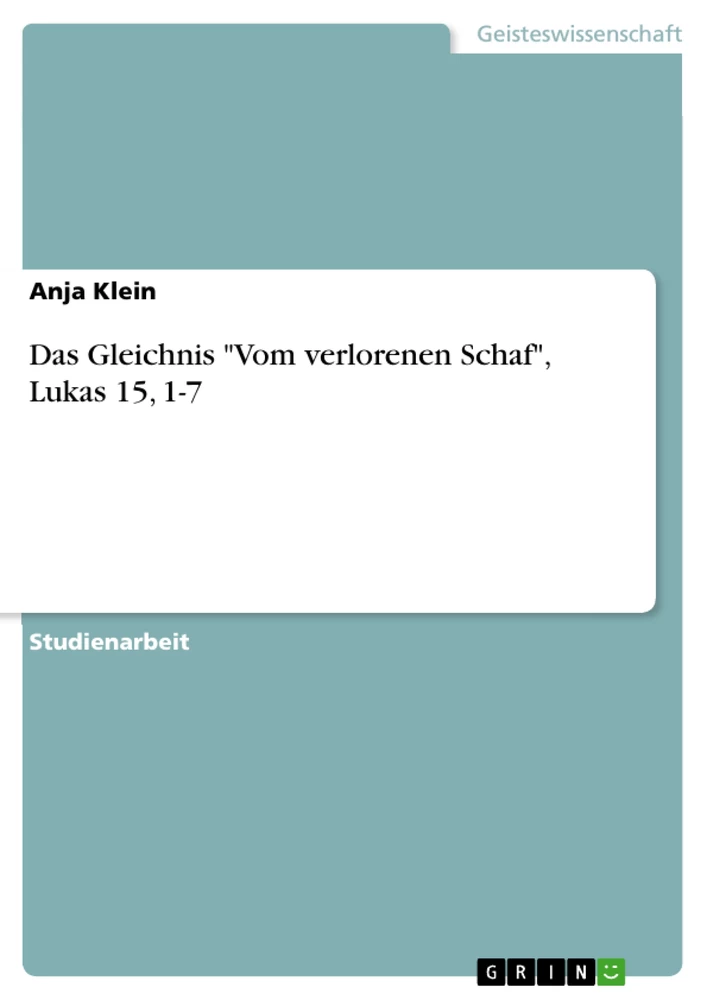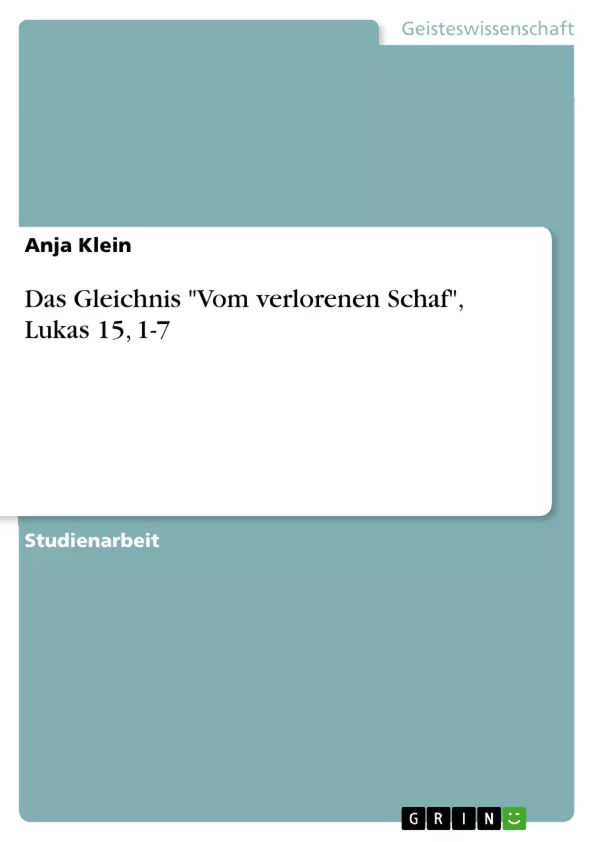Der Name des Verfassers des Lukasevangeliums ist leider nicht bekannt, da er ihn nicht nennt. Es ist aber davon auszugehen, dass die Apostelgeschichte und das Lukasevangelium vom selben Autor verfasst worden sind. Ein mögliches Indiz hierfür ist es, dass es hier nicht nur eine theologische Nähe, sondern auch Gemeinsamkeiten in terminologischer Hinsicht gibt (vgl. Apg 13,38f, Lk 18,14, anklingen der Rechtfertigungslehre). [vgl. Conzelmann/ Lindemann: Arbeitsbuch zum Neuen Testament, S.343] Diese Gemeinsamkeiten können einerseits auf eine gemeinsame Verfasserschaft hinweisen, andererseits aber auch auf literarische Weise vermittelt sein. Es gibt aber auch Stimmen, die gegen die Verfasserschaft des Paulusmitarbeiters Lukasplädieren und einwenden, dass er sich theologisch zu stark von Paulus unterscheide. [vgl. Calwer: Bibellexikon, S.847] Augenzeugen werden in der Apg namentlich leider nicht erwähnt, die hier Aufschluss geben könnten. [vgl. Conzelmann/ Lindemann: Arbeitsbuch zum Neuen Testament, S.343]
Auffällig im Gegensatz zu MT und Mk ist auch, dass bei Lk der Autor als individuell sichtbar wird. [vgl. Conzelmann/ Lindemann: Arbeitsbuch zum Neuen Testament, S342] Das "Ich" am Anfang bei Lk 1,3 und bei Apg 1,1 macht dies deutlich. "Seit Irenäus (um 180) gilt als Autor der Paulusbegleiter Lukas (Phlm 24, vgl. Kol 4,14, wo Lukas als Arzt bezeichnet ist, und 2 Tim 4,11; nach dem Canon Muratori war Lukas "litteris studios", also ein gebildeter Mann)." [Conzelmann/ Lindemann: Arbeitsbuch zum Neuen Testament, S.342] Letztlich bleibt der Verfasser von Lk (und der Apg) jedoch aufgrund fehlender Indizien unbekannt.
Auch auf die Frage ob Lukas Juden- oder Heidenchrist war, gibt es keine eindeutige Antwort in der Literatur. Zwar kürzt Lk die Gesetzesdebatten aus Mk. Eine Parallele zu den Passagen über das Gesetz, wie bei Markus 7, 1-23 oder Mk 10 1-12, lässt sich bei Lukas nicht finden. Das Verständnis des Gesetzes, wie man es im Gegensatz hierzu in der Apostelgeschichte finden kann, ist sehr unjüdisch. Hieraus kann man folgern, dass er kein Jude war, obwohl er die Bräuche gut kennt und sie sachlich zutreffend darstellt. [vgl. Calwer: Bibellexikon, S.848] Andererseits ist Lukas mit jüdischen Sitten vertraut, wie zum Beispiel die Schilderung des Synagogengottesdienstes in Lk 4,16ff zeigt, somit ist es zwar unwahrscheinlicher aber nicht undenkbar, dass er Diaspora-Jude war. [vgl. Conzelmann/ Lindemann: Arbeitsbuch zum Neuen Testament, S.343]
Inhaltsverzeichnis
- Historische Einordnung
- Abgrenzung und Kontext
- Übersetzungsvergleich
- Synoptischer Vergleich
- Literar- und Formkritik
- Literarkritik
- Formkritik
- Einzelexegese
- Theologische Zusammenfassung
- Literaturliste
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert das Gleichnis vom verlorenen Schaf aus dem Lukasevangelium. Sie befasst sich mit der historischen Einordnung des Textes, untersucht den Kontext und führt einen Übersetzungsvergleich durch. Außerdem werden literarische und formkritische Aspekte beleuchtet, um die Bedeutung des Gleichnisses zu erschließen. Schließlich wird eine theologische Zusammenfassung der Ergebnisse präsentiert.
- Historische Einordnung des Lukasevangeliums und des Gleichnisses
- Kontextualisierung des Gleichnisses im Lukasevangelium
- Übersetzungsvergleich verschiedener Bibelübersetzungen
- Literarische und formkritische Analyse des Gleichnisses
- Theologische Interpretation des Gleichnisses
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel beleuchtet die historische Einordnung des Lukasevangeliums und diskutiert die Frage nach der Autorschaft und dem Entstehungskontext. Es werden unterschiedliche Perspektiven auf die Verfasserschaft des Evangeliums sowie die zeitliche Einordnung in den historischen Kontext beleuchtet.
- Das zweite Kapitel setzt sich mit der Abgrenzung und dem Kontext des Gleichnisses vom verlorenen Schaf auseinander. Es werden textliche Parallelen zu anderen Abschnitten des Lukasevangeliums sowie zu anderen Evangelien aufgezeigt, um den Kontext des Gleichnisses zu verdeutlichen.
- Das dritte Kapitel führt einen Übersetzungsvergleich des Gleichnisses in verschiedenen Bibelübersetzungen durch. Es werden Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der Übersetzung des Textes aufgezeigt, um die Herausforderungen und Möglichkeiten der Übersetzung des biblischen Textes zu verdeutlichen.
- Das vierte Kapitel widmet sich dem synoptischen Vergleich des Gleichnisses vom verlorenen Schaf mit anderen Gleichnissen aus dem Neuen Testament. Es werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Darstellung des Gleichnisses in den Evangelien hervorgehoben, um die jeweilige Bedeutung und Intention der Autoren zu beleuchten.
- Das fünfte Kapitel analysiert das Gleichnis vom verlorenen Schaf aus literarischer und formkritischer Perspektive. Es werden die literarischen Merkmale des Textes, wie zum Beispiel die rhetorischen Mittel und die narrative Struktur, sowie die formkritische Einordnung des Gleichnisses in die Gattung des Gleichnisses untersucht.
Schlüsselwörter
Das Gleichnis vom verlorenen Schaf, Lukasevangelium, Historische Einordnung, Kontextualisierung, Übersetzungsvergleich, Synoptischer Vergleich, Literarkritik, Formkritik, Theologische Interpretation.
Häufig gestellte Fragen
Wer ist der Verfasser des Lukasevangeliums?
Der Verfasser ist namentlich nicht bekannt, wird aber seit dem 2. Jahrhundert traditionell mit dem Paulusbegleiter Lukas identifiziert. Die Arbeit diskutiert verschiedene Forschungssichten hierzu.
Was ist die theologische Kernbotschaft des Gleichnisses vom verlorenen Schaf?
Es thematisiert die Freude Gottes über die Umkehr eines Sünders und Gottes aktive Suche nach dem Verlorenen, was in Lukas 15, 1-7 dargestellt wird.
Wie unterscheidet sich Lukas von anderen Evangelisten?
Im Gegensatz zu Matthäus und Markus tritt der Autor bei Lukas als Individuum ("Ich") stärker in Erscheinung, etwa im Prolog des Evangeliums.
War Lukas ein Juden- oder Heidenchrist?
Dies ist umstritten. Während seine Kenntnis jüdischer Bräuche für eine jüdische Herkunft sprechen könnte, deutet sein unjüdisches Gesetzesverständnis in der Apostelgeschichte eher auf einen Heidenchristen hin.
Was beinhaltet die literarkritische Analyse des Textes?
Die Analyse untersucht die rhetorischen Mittel, die narrative Struktur und die Gattung des Gleichnisses innerhalb des synoptischen Vergleichs.
Warum ist der Kontext von Lukas 15 wichtig?
Das Gleichnis steht in einer Reihe von Erzählungen über das "Verlorene" und dient als Rechtfertigung Jesu gegenüber den Pharisäern für seinen Umgang mit Zöllnern und Sündern.
- Citation du texte
- Anja Klein (Auteur), 2005, Das Gleichnis "Vom verlorenen Schaf", Lukas 15, 1-7, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/55506