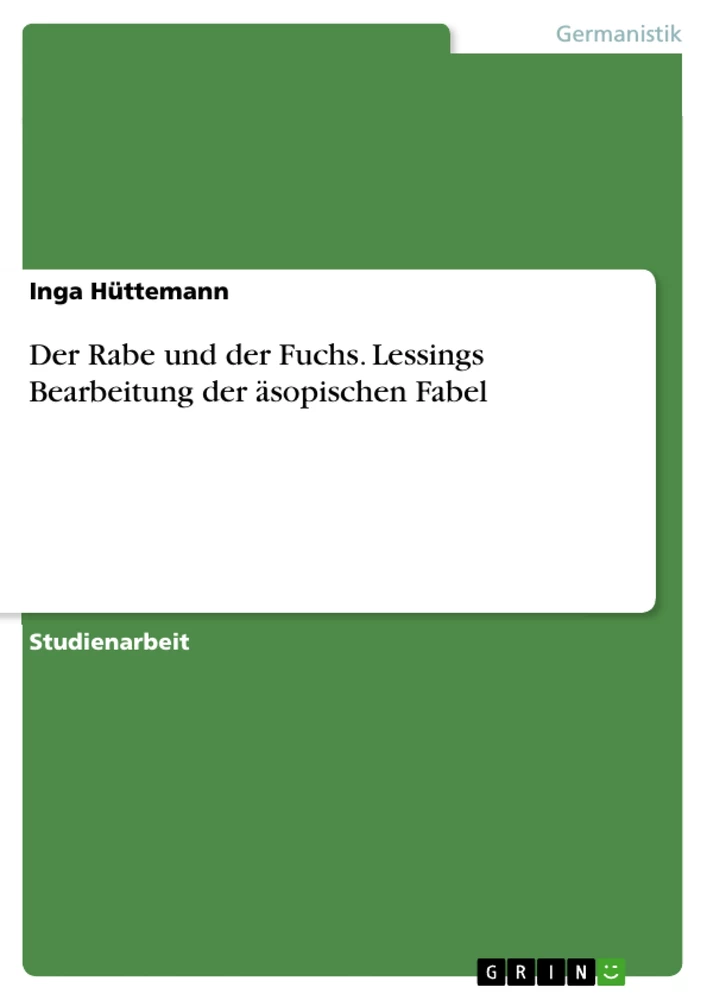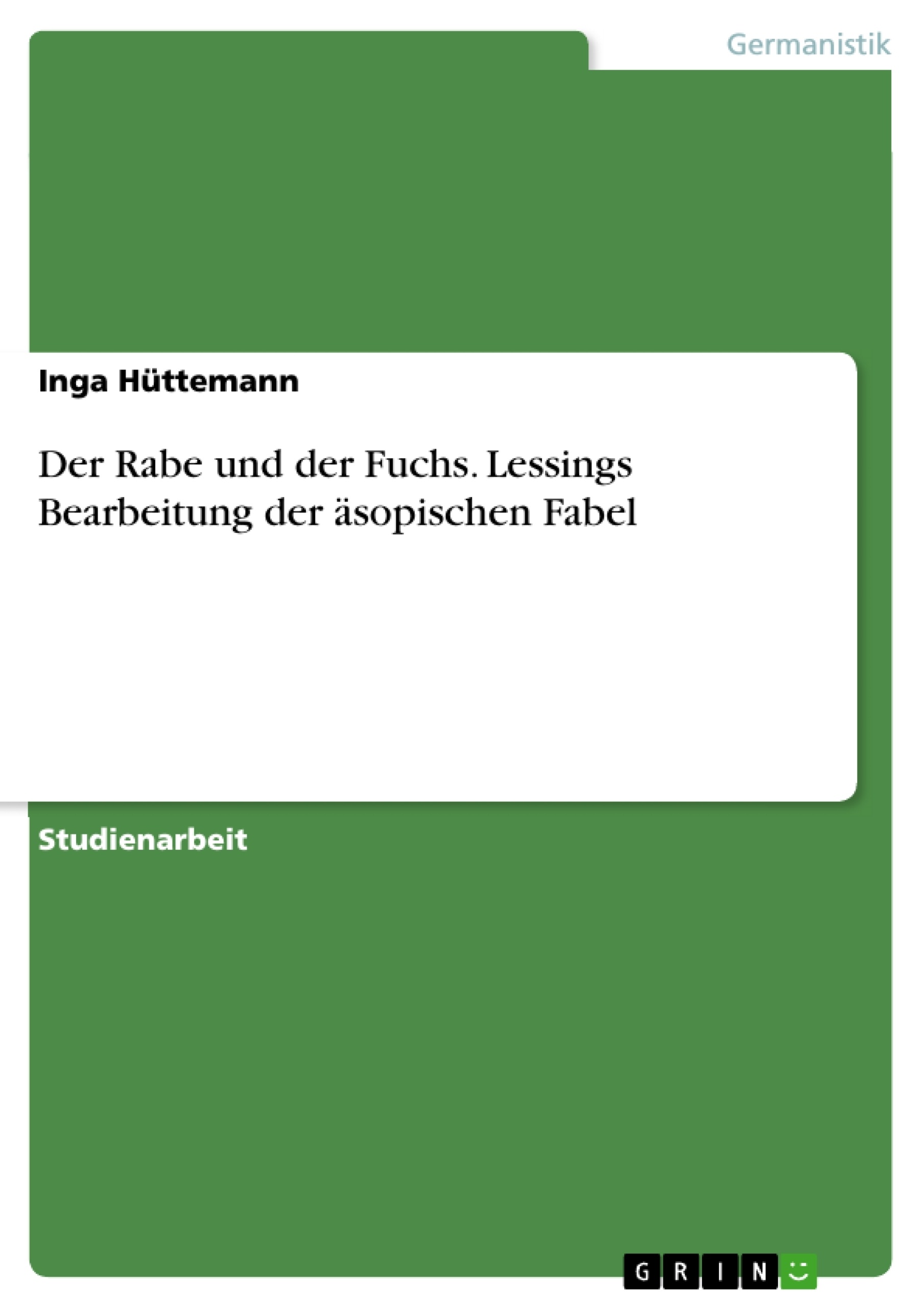Fuchs und Rabe sind ein alt bekanntes Pärchen in der Fabeltradition. Schon seit der Antike streiten sich die beiden um ihre Beute. Wenn sie zusammentreffen, wissen wir schon am Anfang, wer als Sieger aus der Konfrontation hervorgehen wird: Der Fuchs, der ja bekanntlich ein schlauer und hinterlistiger Geselle ist, hat es immer wieder geschafft, den Raben um seine Beute zu betrügen.
Die lange Fabeltradition und die vielen Bearbeitungen dieser äsopischen Fabel haben uns eine klare Rollenverteilung gelehrt: Der schlaue Fuchs ist der Gewinner, der dumme Rabe hat das Nachsehen. Äsop transportiert damit eine ganz einfache Botschaft: Der Dumme wird am Ende der Verlierer sein, Dummheit wird bestraft. Die zahlreichen Bearbeitungen dieser Fabel, von Luther bis La Fontaine, haben diese klassische Rollenverteilung übernommen. Sprachlich und stilistisch variieren die einzelnen Bearbeitungen, im Kern, also ihrer Moral, bleiben sie immer gleich. Bis zu Lessing: Der Aufklärer begnügt sich nicht mit einer sprachlichen Bearbeitung. Im Gegenteil. Er verwendet den traditionellen Stoff, um ihn gegen die Erwartungen zu verdrehen, um so etwas Neues zu schaffen. Bei ihm ist der Fuchs nicht mehr der Gewinner, vielmehr verliert er alles, nämlich sein Leben. Der Rabe hingegen kann sich zum ersten Mal als der Sieger fühlen. Aber ist er das wirklich? Die Fabel von Lessing bereitet in ihrer Deutung mehr Probleme als ihre Vorgänger. Von Äsop bis La Fontaine lag die sogenannte Moral klar auf der Hand. Bei Lessing hingegen ist es schwierig, überhaupt eine Lehre herauszufinden. Das liegt zum einen an der von ihm bewusst angestrebten „Singularität des Falles“. Dadurch, dass das Fleisch vergiftet ist, lässt sich der Fall nicht verallgemeinern. Eindeutig ist lediglich die moralische Verurteilung des Fuchses, die im Epimythion deutlich wird. Doch die Fabel auf diese eine Aussage zu reduzieren, wäre zu einfach.
Im Folgenden wird versucht, die Bearbeitung Lessings zu analysieren. Da Lessing bei der Lektüre seiner Fabel immer die Kenntnis der äsopischen Fabel voraussetzt, wird auch bei der Analyse von dem Original ausgegangen. Es wird in einem ersten Schritt näher betrachtet, um anschließend die wesentlichen Unterschiede zwischen den beiden Fabeln herauszustellen. Die wesentlichen Veränderungen erzielt Lessing durch die neuartige Konzeption der beiden Charaktere. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I) Der Rabe und der Fuchs im Original von Äsop
- II) Vergleich der beiden Fabeln
- III) Analyse der Lessing-Fabel
- 1. Der Rabe
- 2. Der Fuchs
- 3. Das Epimythion
- IV) Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert Lessings Bearbeitung der äsopischen Fabel „Der Rabe und der Fuchs“ und vergleicht sie mit dem Original. Die Zielsetzung besteht darin, die Unterschiede in Handlung, Charakterisierung und Moral beider Fassungen herauszuarbeiten und Lessings Intentionen zu ergründen.
- Vergleich der äsopischen Fabel mit Lessings Version
- Analyse der Charaktere (Rabe und Fuchs) in beiden Fassungen
- Untersuchung der Moral und der impliziten Botschaft
- Interpretation der Veränderungen, die Lessing an der ursprünglichen Fabel vorgenommen hat
- Bedeutung der „Singularität des Falles“ in Lessings Fabel
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die zentrale Fragestellung vor: Wie unterscheidet sich Lessings Bearbeitung der bekannten Fabel vom Original und welche Intentionen verfolgt Lessing mit seiner Adaption? Es wird auf die klassische Rollenverteilung in der Fabeltradition hingewiesen und Lessings innovative Umkehrung dieser Rollen angekündigt. Die Einleitung betont die Schwierigkeit, eine eindeutige Moral in Lessings Version zu finden und kündigt den methodischen Ansatz der Arbeit an, der den Vergleich des Originals mit Lessings Bearbeitung in den Mittelpunkt stellt.
I) Der Rabe und der Fuchs im Original von Äsop: Dieses Kapitel beschreibt die äsopische Fabel in ihren Grundzügen. Es wird die Handlung – ein Rabe verliert seinen Käse durch die List eines Fuchses – erzählt und die Charakterisierung von Rabe und Fuchs analysiert. Der Rabe wird als dumm und eitel dargestellt, der Fuchs als schlau und hinterlistig. Die Moral der Fabel wird als die Bestrafung von Dummheit und Eitelkeit gedeutet. Das Kapitel betont, dass die Moral implizit ist und die Schadenfreude des Lesers über den dummen Raben hervorruft. Es wird auch auf die Bedeutung der Fabel innerhalb der äsopischen Tradition eingegangen.
II) Vergleich der beiden Fabeln: Dieses Kapitel stellt die zentralen Unterschiede zwischen der äsopischen Fabel und Lessings Version heraus. Der wichtigste Unterschied liegt in der Vergiftung des Fleisches, wodurch das Ende und die Pointe der Fabel grundlegend verändert werden. Bei Äsop ist der Fuchs der eindeutige Gewinner; bei Lessing ist er der Verlierer, da er an dem vergifteten Fleisch stirbt. Auch die List des Fuchses ist anders. Anstatt den Raben zum Singen zu bringen, appelliert er an dessen Stolz und Großmütigkeit. Der Rabe bei Lessing gibt seine Beute freiwillig her und ist am Ende zufrieden. Die Charakterisierung beider Figuren wird deutlich verändert.
Schlüsselwörter
Äsopische Fabel, Lessing, „Der Rabe und der Fuchs“, Fabeltradition, Moral, Charakterisierung, Vergleich, Interpretation, Aufklärung, List, Eitelkeit, Dummheit, Vergiftung.
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zu Lessings Bearbeitung der Fabel "Der Rabe und der Fuchs"
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Gotthold Ephraim Lessings Bearbeitung der bekannten Äsopischen Fabel "Der Rabe und der Fuchs" und vergleicht sie mit dem Original. Der Fokus liegt auf den Unterschieden in Handlung, Charakterisierung und Moral beider Fassungen, sowie auf der Ergründung von Lessings Intentionen hinter seiner Adaption.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Vergleich der Äsopischen Fabel mit Lessings Version; Analyse der Charaktere (Rabe und Fuchs) in beiden Fassungen; Untersuchung der Moral und der impliziten Botschaft; Interpretation der Veränderungen, die Lessing an der ursprünglichen Fabel vorgenommen hat; Bedeutung der „Singularität des Falles“ in Lessings Fabel.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, vier Hauptkapitel und ein Kapitel mit Schlüsselwörtern. Kapitel I beschreibt die Äsopische Originalfabel. Kapitel II vergleicht die beiden Fassungen. Kapitel III analysiert Lessings Fabel im Detail (Rabe, Fuchs, Epimythion). Kapitel IV fasst die Ergebnisse zusammen.
Was ist der zentrale Unterschied zwischen der Äsopischen Fabel und Lessings Version?
Der wichtigste Unterschied liegt in der Vergiftung des Fleisches, was das Ende und die Pointe der Fabel grundlegend verändert. Bei Äsop gewinnt der Fuchs, bei Lessing stirbt er. Auch die List des Fuchses und die Charakterisierung beider Figuren werden deutlich verändert.
Wie wird der Rabe in beiden Fassungen dargestellt?
Im Original ist der Rabe dumm und eitel. In Lessings Version gibt er seine Beute freiwillig her und ist am Ende zufrieden. Seine Charakterisierung wird also deutlich verändert.
Wie wird der Fuchs in beiden Fassungen dargestellt?
Im Original ist der Fuchs schlau und hinterlistig. In Lessings Version appelliert er an den Stolz und die Großmütigkeit des Raben und stirbt am vergifteten Fleisch. Seine List und seine Rolle als Gewinner werden umgekehrt.
Welche Moral vermitteln die beiden Fassungen?
Die Äsopische Fabel bestraft implizit Dummheit und Eitelkeit. Lessings Version hat eine weniger eindeutige Moral, die Interpretation der "Singularität des Falles" steht im Vordergrund.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Äsopische Fabel, Lessing, "Der Rabe und der Fuchs", Fabeltradition, Moral, Charakterisierung, Vergleich, Interpretation, Aufklärung, List, Eitelkeit, Dummheit, Vergiftung.
Welche Methode wird in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit verwendet einen vergleichenden Ansatz, der die Äsopische Originalfabel mit Lessings Bearbeitung kontrastiert, um Lessings Intentionen und die Veränderungen in Handlung, Charakterisierung und Moral aufzuzeigen.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für akademische Zwecke gedacht und dient der Analyse von literarischen Themen.
- Quote paper
- Inga Hüttemann (Author), 2005, Der Rabe und der Fuchs. Lessings Bearbeitung der äsopischen Fabel, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/55447