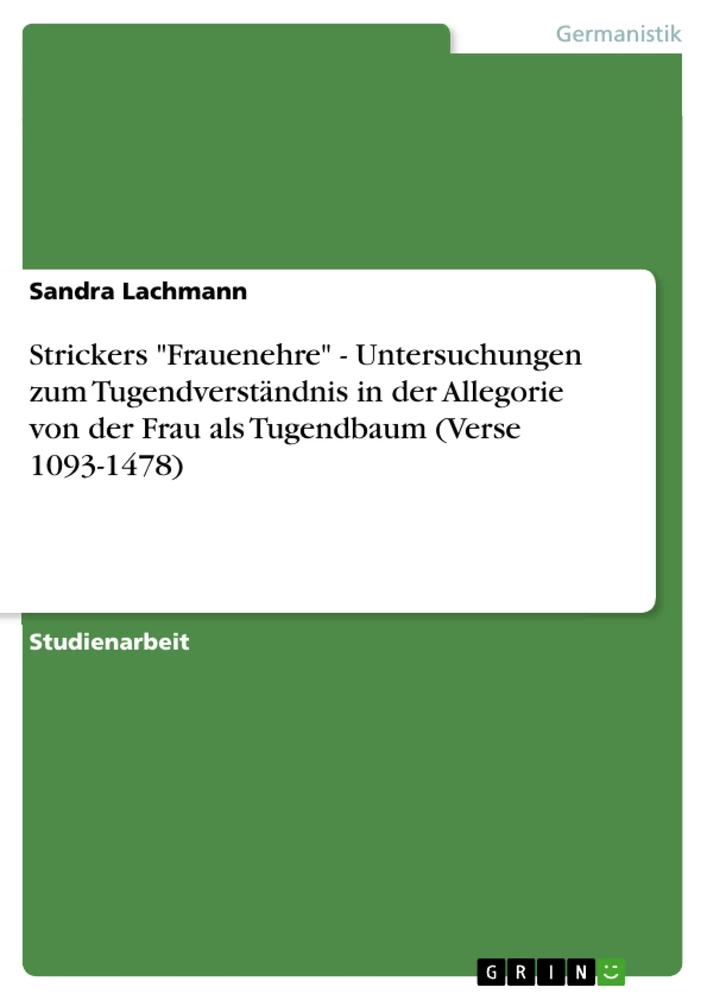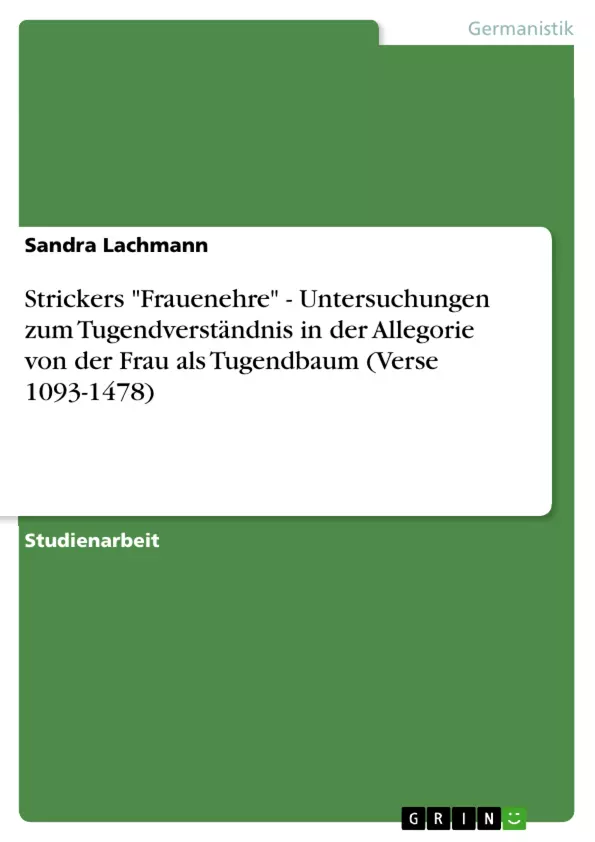War die mittelhochdeutsche Dichtung bis ins 12. Jahrhundert von der höfischen Dichtung und der Beschäftigung mit ritterlichen Tugendkatalogen gekennzeichnet, liegt mit des Strickers Frauenehre eine Lehrdichtung vor, in der auf neuartige Weise die Tugendlehre mit dem Frauenpreis verknüpft wird. Obgleich dabei die vrouwe und der Minnedienst im Zentrum der Dichtung stehen, kann sie nicht in die Tradition des Minnesangs eingereiht werden, sondern zeichnet sich durch innovative Aufbereitung eines bekannten Stoffes aus. Wie wichtig dem Stricker dabei das didaktische Element war, zeigt die Ergänzung des Lehrgedichtes durch eine Allegorie und ein bîspel. Der Stricker nutzt verschiedene Möglichkeiten, seine Gedanken bildhaft darzustellen und dem Publikum verständlich zu machen.
Die vorliegende Arbeit widmet sich mit ihren Untersuchungen ausschließlich der in der Frauenehre enthaltenen Allegorie und stellt sich die Frage, welches Tugendverständnis darin literarisch abgebildet ist. Ferner soll das Ergebnis mit der philosophischen Tugendvorstellung der Entstehungszeit verglichen werden. Die Untersuchungen setzen sich also nicht zum Ziel, das Tugendverständnis der Frauenehre oder des Strickers in seiner Gesamtheit zu untersuchen. Dazu müsste die gesamte Dichtung bzw. das Gesamtwerk des Autors analysiert werden.
Die Arbeit gliedert sich in zwei Teile. Der erste dient der theoretischen Annäherung an das Thema und gibt Hinweise, die für die anschließende Textanalyse notwendig sind. So wird zunächst die historische Entwicklung der Tugendlehre nachgezeichnet (Kapitel 2.1). Problematisch dabei ist die Überlappung von Begriffs- und Ideengeschichte. Nicht zu jeder Zeit ist ein Begriff fassbar, der etymologisch zum Wort „Tugend“ gehört. Insbesondere in der Bibel fehlt eine eindeutige Entsprechung. Diese Arbeit verwendet daher den Tugendbegriff in einem ideengeschichtlichen Zusammenhang, weshalb auch moraltheologische Reflexionen, die nicht explizit als Tugendreflexionen bezeichnet werden können, Berücksichtigung finden. Da sich die Lehre von den Tugenden – wie noch gezeigt wird – aus der christlichen Moraltheologie ableitet, kann dieses Vorgehen gerechtfertigt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Einbettung
- Herausbildung und Entwicklung der Tugendlehre
- Griechische Antike
- Moralvorstellungen in der Heiligen Schrift und ihre Auslegung in der Patristik
- Die Tugendlehre der Scholastik
- Das Frauenbild im Mittelalter – Differenz zwischen Dichtung und Wirklichkeit
- Die mittelalterliche Allegorie
- Die Symbolhaftigkeit des Baumes am Beispiel des Tugend- und Lasterbaumes von Hugos de Saint-Victor
- Herausbildung und Entwicklung der Tugendlehre
- Strickers Allegorie von der Frau als Tugendbaum (Verse 1093-1478)
- Abgrenzung innerhalb der Dichtung
- Analyse des Tugendverständnisses
- Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die in Strickers Frauenehre enthaltene Allegorie und analysiert das dort abgebildete Tugendverständnis. Sie vergleicht dieses literarische Verständnis mit der philosophischen Tugendvorstellung der Entstehungszeit. Die Arbeit konzentriert sich dabei ausschließlich auf die Allegorie und nicht auf das gesamte Tugendverständnis der Frauenehre oder des Strickers.
- Die Entwicklung der Tugendlehre von der Antike bis ins 13. Jahrhundert
- Die Darstellung des Frauenbildes im Mittelalter
- Die Funktionsweise und Bedeutung der mittelalterlichen Allegorie
- Die Bedeutung des Baumes als Symbol in der mittelalterlichen Literatur
- Das Tugendverständnis in Strickers Allegorie von der Frau als Tugendbaum
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt den Kontext der Arbeit vor und erklärt die Bedeutung der Allegorie in Strickers Frauenehre.
- Kapitel 2.1 zeichnet die historische Entwicklung der Tugendlehre nach, beginnend mit der griechischen Antike und endend mit der scholastischen Tugendlehre. Es wird die Bedeutung von Aristoteles, Augustinus und der Heiligen Schrift für die Entwicklung der Tugendlehre beleuchtet.
- Kapitel 2.2 beleuchtet die Unterschiede zwischen dem realen und dem fiktiven Frauenbild im Mittelalter.
- Kapitel 2.3 erläutert die Bedeutung und Funktionsweise der mittelalterlichen Allegorie.
- Kapitel 2.4 erklärt die symbolische Bedeutung des Baumes in der mittelalterlichen Literatur, insbesondere am Beispiel des Tugend- und Lasterbaumes von Hugos de Saint-Victor.
- Kapitel 3.1 definiert den Teil der Frauenehre, der als Allegorie betrachtet werden kann, und erläutert die literarische Vorgehensweise des Strickers in der Allegorie.
- Kapitel 3.2 untersucht die Tugendlehre des Dichters in der Allegorie und analysiert die wichtigsten Tugenden, deren Verhältnis zueinander und die Möglichkeiten, diese Tugenden zu erlangen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit dem Tugendverständnis in Strickers Frauenehre, insbesondere mit der Allegorie von der Frau als Tugendbaum. Die Arbeit untersucht die historische Entwicklung der Tugendlehre, die Bedeutung des Frauenbildes im Mittelalter, die Funktion der Allegorie sowie die symbolische Bedeutung des Baumes. Die Analyse konzentriert sich auf die wichtigsten Tugenden, deren Beziehung zueinander und die Möglichkeiten, diese Tugenden zu erlangen. Die Arbeit setzt sich mit dem Konzept der Frau als "Tugenbaum" auseinander und untersucht die Rezeption der antiken und christlichen Lehre vom Tugendbegriff im Mittelalter.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Strickers „Frauenehre“?
Es handelt sich um eine mittelhochdeutsche Lehrdichtung, die Tugendlehre mit dem Lob der Frauen verknüpft.
Was symbolisiert der „Tugendbaum“ in der Allegorie?
Der Baum dient als bildhafte Darstellung für das Wachstum und die Struktur von Tugenden innerhalb einer Person, hier speziell der Frau.
Welche historischen Wurzeln hat die Tugendlehre des Strickers?
Die Arbeit untersucht Einflüsse aus der griechischen Antike, der Bibel, der Patristik und der mittelalterlichen Scholastik.
Wie unterscheidet sich das literarische Frauenbild von der Wirklichkeit des Mittelalters?
Die Arbeit beleuchtet die Differenz zwischen der idealisierten „vrouwe“ in der Dichtung und der tatsächlichen sozialen Stellung der Frau im Mittelalter.
Welche Funktion hat die Allegorie in diesem Werk?
Sie dient als didaktisches Mittel, um komplexe moralische und philosophische Inhalte dem Publikum bildhaft verständlich zu machen.
- Quote paper
- Sandra Lachmann (Author), 2005, Strickers "Frauenehre" - Untersuchungen zum Tugendverständnis in der Allegorie von der Frau als Tugendbaum (Verse 1093-1478), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/55381