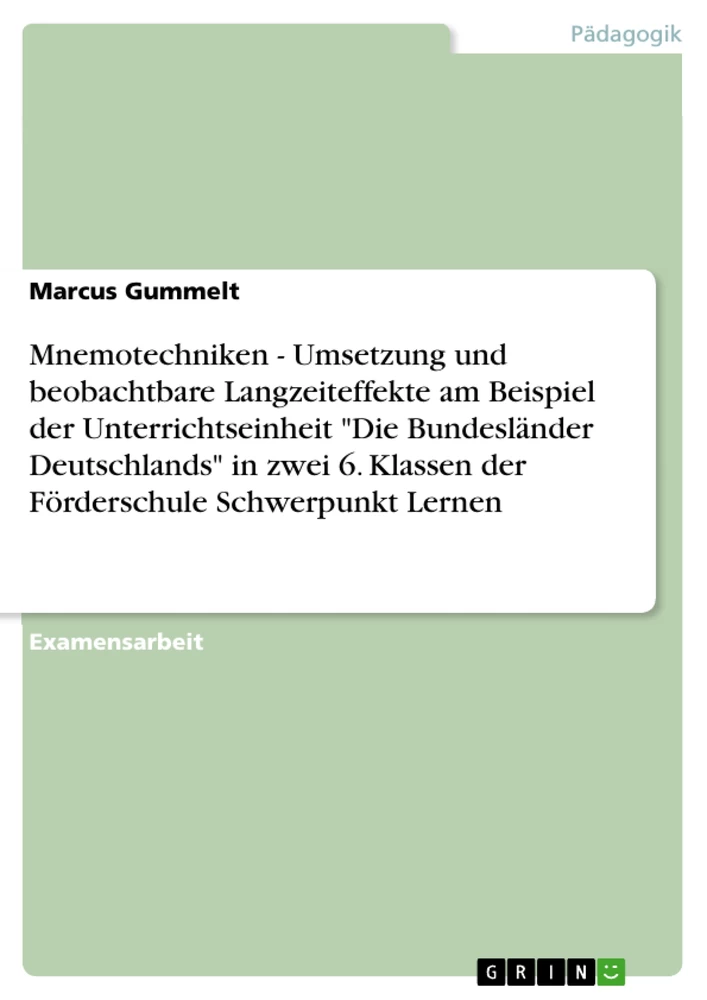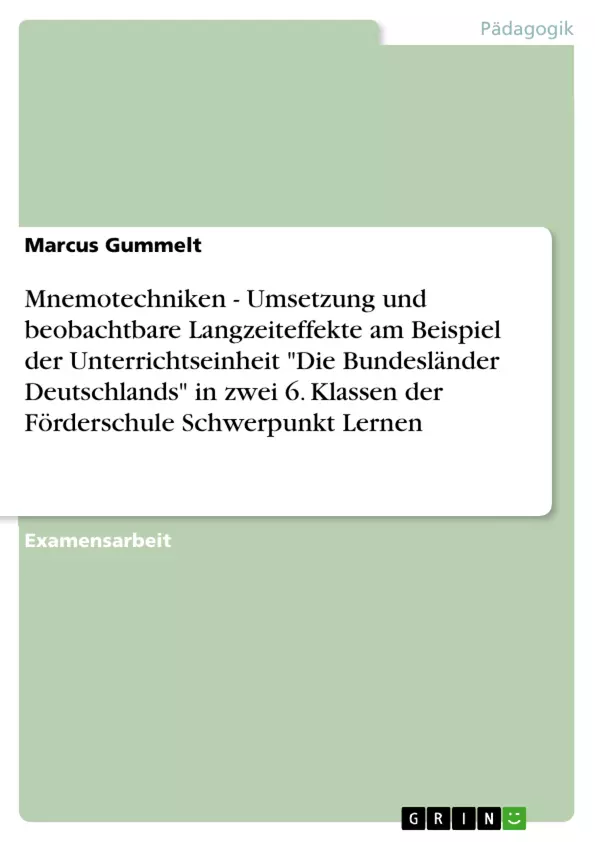Die von 1500 bis 1800 bestimmende “Pauk“- und Memorierschule ist heute weitgehend überwunden, weil sie für die Bewältigung komplexer Lernaufgaben offensichtlich nicht ausreicht (Meyer, 2003).
Dennoch müssen Kinder heute durch Veränderungen der Lernumwelt und eine immer komplexer werdende Informationsgesellschaft eine Vielzahl von Informationen aufnehmen und präsent haben.
Ich schließe mich der These von Meyer (2003) an, die besagt, dass Schüler und Schülerinnen heute immer mehr und schneller lernen müssen, wodurch sie auch immer weniger gründlich lernen.
Die Notwendigkeit, Informationen dauerhaft abzuspeichern und sicher reproduzieren zu können, wird deutlich, wenn man bedenkt, dass gerade zur Lösung komplexer Lernaufgaben spezifisches Faktenwissen benötigt wird (Wippich, 1984). Folgendes Zitat untermauert diesen Standpunkt: „A good memory is essential for intelligence and creativity“ (Morris, 1979, S. 52).
Die Behaltensleistungen von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Schwerpunkt Ler-nen sind im Vergleich mit gleichaltrigen Regelschülern signifikant schlechter und diese Defizite in der Gedächtnisleistung werden als bedeutsame Ursache unterdurchschnittlicher kognitiver Leistungsfähigkeit gesehen (Büttner, 1998).
Es stellt sich also die Frage, ob es spezifische Unterrichtsmethoden oder Lerntechniken gibt, die Schü-lern bei der Einspeicherung und dem Abruf von bedeutendem Faktenwissen hilfreich sein können.
Mnemotechniken (Techniken, die bei der Speicherung und dem Abruf von Wissen helfen können) werden in nahezu allen bedeutenden Veröffentlichungen zur Verbesserung von Lern- und Gedächtnis-leistungen beschrieben und als effektiv bewertet. (Anderson, 1996; Büttner, 1996; Kintsch, 1982; Metzig & Schuster, 2003; Neidhard, 2001; Schuster & Woschek, 1989; Ulrich, Stapf & Giray, 1996; Wippich, 1984).
Im praktischen Teil der vorliegenden Arbeit wird der Versuch unternommen, eine Unterrichtseinheit zu spezifischem Faktenwissen mit ausgewählten Mnemotechniken zu gestalten, durchzuführen und auf Langzeiteffekte hin zu untersuchen. Dabei steht die Darstellung der praktischen Umsetzung dieser Unterrichtseinheit im Vordergrund. Bedingt durch den Versuchsaufbau können nur erste Hinweise für mögliche Langzeiteffekte herausgefunden werden, da die für eine beweiskräftige empirische Untersu-chung nötige Kontrollgruppe aus organisatorischen Gründen fehlt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung und Überblick
- 2. Funktionsweise des menschlichen Gedächtnisses
- 2.1 Mehrspeichermodelle
- 2.2 Theorie der Verarbeitungstiefe
- 2.3 Die duale Kode-Theorie
- 2.4 Zusammenfassung und Bedeutung für die vorliegende Arbeit
- 3. Prozesse und Faktoren für das Einprägen und Erinnern aus dem Langzeitgedächtnis
- 3.1 Einprägen
- 3.1.1 Organisation der Lernsituation
- 3.1.2 Bildhaftigkeit
- 3.1.3 Bekanntheitsgrad
- 3.1.4 Elaborative Verarbeitung
- 3.2 Abruf aus dem Langzeitgedächtnis
- 3.3 Erkenntnisse zu Gedächtnisleistungen von Förderschülern
- 3.1 Einprägen
- 4. Mnemotechniken
- 4.1 Geschichtentechnik
- 4.2 Schlüsselwortmethode
- 5. Ableitung der Fragestellung und Formulierung der Forschungshypothesen
- 6. Methode
- 6.1 Vorüberlegungen und Voruntersuchungen
- 6.2 Untersuchungsplan
- 6.2.1 Benennung und Operationalisierung der unabhängigen und abhängigen Variablen
- 6.2.1.1 Schüler einer Förderschule Schwerpunkt Lernen
- 6.2.1.2 Lerngegenstand
- 6.2.1.3 Unterrichtseinheit auf Basis ausgewählter Mnemotechniken
- 6.2.1.4 Messzeitpunkte
- 6.2.1.5 Langzeiteffekte bei der Behaltensleistung der Unterrichtsinhalte
- 6.2.2 Auswahl der Untersuchungsmethode
- 6.2.1 Benennung und Operationalisierung der unabhängigen und abhängigen Variablen
- 6.3 Untersuchungsdurchführung
- 6.3.1 Untersuchungsablauf
- 6.3.2 Beschreibung der Lerngruppe
- 6.3.3 Lernausgangslage
- 6.3.4 Lehrer und Mitarbeiter
- 6.3.5 Beschreibung der Unterrichtseinheit
- 6.3.5.1 Bezug zu theoretischen Überlegungen
- 6.3.5.2 Kürzübersicht über die Unterrichtseinheit
- 6.3.5.3 Darstellung der einzelnen Unterrichtsstunden
- 7. Ergebnisse
- 7.1 Ergebnisse der einzelnen Messzeitpunkte
- 7.2 Darstellung der Gesamtergebnisse
- 7.3 Fehlerschwerpunkte
- 8. Diskussion
- 8.1 Methodenkritik
- 8.2 Überprüfung der aufgestellten Hypothesen
- 8.3 Probleme und Umsetzung im Unterricht
- 8.4 Schlussbetrachtung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit untersucht die Effektivität von Mnemotechniken bei der Vermittlung von spezifischem Faktenwissen an Schüler einer Förderschule Schwerpunkt Lernen. Ziel ist es, die Auswirkungen ausgewählter Mnemotechniken auf die Langzeitbehaltensleistung der Schüler zu analysieren. Die Arbeit will einen Beitrag zur Erweiterung des Methodenrepertoires im Unterricht für Förderschüler leisten.
- Funktionsweise des menschlichen Gedächtnisses und relevante Gedächtnismodelle
- Prozesse und Faktoren, die das Einprägen und Erinnern beeinflussen
- Mnemotechniken und ihre Anwendung im Unterricht
- Empirische Untersuchung der Langzeiteffekte von Mnemotechniken bei Förderschülern
- Diskussion der Ergebnisse und Implikationen für die Unterrichtspraxis
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung gibt einen Überblick über die Bedeutung des Gedächtnisses für das Lernen und die Herausforderungen, die sich aus der immer komplexer werdenden Informationsgesellschaft für das Lernen ergeben. Die Arbeit stellt die Problematik der geringen Behaltensleistungen von Förderschülern im Vergleich zu Regelschülern dar und führt die zentrale Forschungsfrage ein: Können Mnemotechniken die Gedächtnisleistung von Förderschülern verbessern?
Kapitel 2 widmet sich der Funktionsweise des menschlichen Gedächtnisses. Es werden die wichtigsten Gedächtnismodelle vorgestellt, die für das Verständnis der Mnemotechniken relevant sind, wie beispielsweise das Mehrspeichermodell und die Theorie der Verarbeitungstiefe.
Kapitel 3 beleuchtet Prozesse und Faktoren, die das Einprägen und Erinnern aus dem Langzeitgedächtnis beeinflussen, wie Organisation der Lernsituation, Bildhaftigkeit und elaborative Verarbeitung. Außerdem werden Erkenntnisse zur Gedächtnisleistung von Förderschülern vorgestellt.
Kapitel 4 behandelt verschiedene Mnemotechniken, die im Unterricht eingesetzt werden können, um die Speicherung und den Abruf von Wissen zu erleichtern. Es werden beispielsweise die Geschichtentechnik und die Schlüsselwortmethode beschrieben.
Kapitel 5 leitet aus den theoretischen Grundlagen die Fragestellung der Arbeit ab und formuliert die Forschungshypothesen.
Kapitel 6 beschreibt die Methodik der empirischen Untersuchung. Es werden die Untersuchungsmethode, der Versuchsaufbau und die Auswahl der Stichprobe erläutert.
Kapitel 7 präsentiert die Ergebnisse der empirischen Untersuchung und analysiert die Daten.
Kapitel 8 diskutiert die Ergebnisse und ihre Implikationen für die Unterrichtspraxis. Es werden die methodischen Grenzen der Untersuchung betrachtet und ein Ausblick auf weitere Forschungsfragen gegeben.
Schlüsselwörter
Mnemotechniken, Gedächtnis, Langzeitgedächtnis, Förderschule, Schwerpunkt Lernen, Behaltensleistung, Lernpsychologie, Unterrichtsmethoden, empirische Untersuchung.
Häufig gestellte Fragen
Was sind Mnemotechniken?
Mnemotechniken sind Lern- und Gedächtnistechniken, die durch Bildhaftigkeit oder Organisation helfen, Informationen sicher im Langzeitgedächtnis zu speichern.
Warum sind diese Techniken für Förderschüler besonders wichtig?
Förderschüler mit Schwerpunkt Lernen haben oft Defizite in der Gedächtnisleistung; Mnemotechniken können helfen, diesen Nachteil beim Speichern von Faktenwissen auszugleichen.
Was ist die Schlüsselwortmethode?
Dabei wird ein unbekanntes Wort mit einem ähnlich klingenden, bekannten Bild verknüpft, um die Behaltensleistung durch visuelle Assoziationen zu steigern.
Welche Rolle spielt die Bildhaftigkeit beim Lernen?
Visuelle Informationen werden laut der dualen Kode-Theorie besser verarbeitet als rein verbale, was das Einprägen komplexer Inhalte erleichtert.
Welche Langzeiteffekte wurden in der Arbeit untersucht?
Die Arbeit untersucht anhand einer Unterrichtseinheit zu den Bundesländern, ob Schüler das Wissen durch Mnemotechniken auch über einen längeren Zeitraum sicher reproduzieren können.
- Arbeit zitieren
- Marcus Gummelt (Autor:in), 2005, Mnemotechniken - Umsetzung und beobachtbare Langzeiteffekte am Beispiel der Unterrichtseinheit "Die Bundesländer Deutschlands" in zwei 6. Klassen der Förderschule Schwerpunkt Lernen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/55269