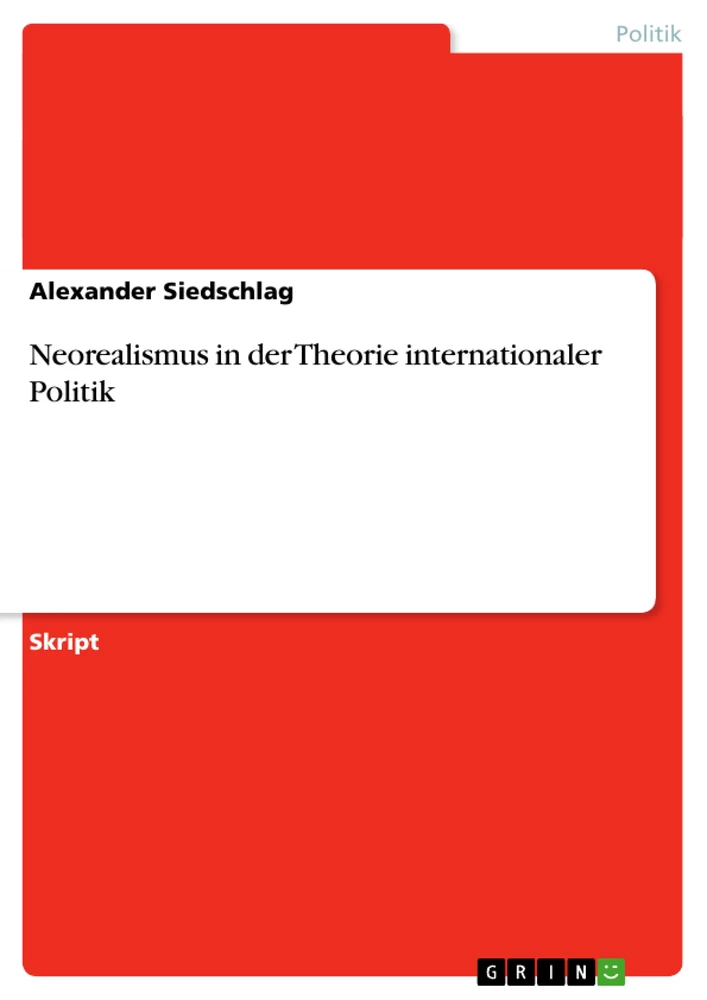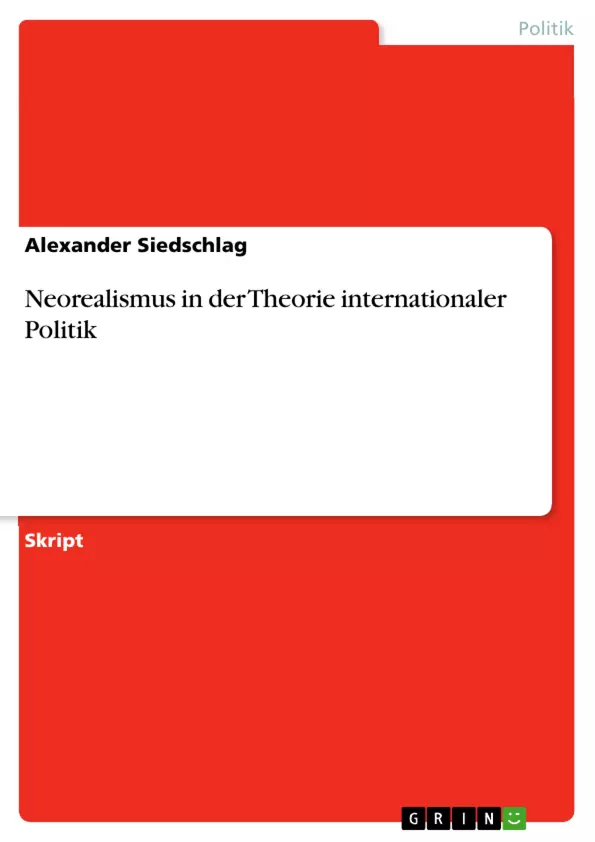Neorealismus ist keine spezifische Theorie, sondern ein facettenreiches Paradigma: Im Rahmen einer gemeinsamen Weltsicht und Auffassung über den Gegenstandsbereich des Faches Internationale Politik haben sich unterschiedliche neorealistische Theorien entwickelt, die unterschiedliche Analysebegriffe und -methoden verwenden. Oft wird Neorealismus sofort mit dem Ansatz von Waltz gleichgesetzt, was aber völlig falsch ist; denn weder der Theorie noch der Methode nach entspricht dieser unserem heutigen Wissensstand. Seinen theoretischen und methodologischen Fortschritt verdankt der Neorealismus heute anderen Beiträgen. Allerdings ist der Waltz′sche Neorealismus eine wichtige Reibungsfläche, auf die sowohl die anderen neorealistischen Theorien als auch Ansätze aus ganz anderen Paradigmen Bezug nehmen, um ihre Positionen abzustecken und zu verdeutlichen. Deshalb ist seine Kenntnis auch heute noch unverzichtbar.
Der Neorealismus von Waltz - oft bezeichnet als struktureller Realismus, weil er direkt von der Struktur des internationalen Systems auf das Verhalten der Staaten schließt - ist zum guten Teil aus der kritischen Auseinandersetzung mit dem klassischen Realismus von Hans J. Morgenthau hervorgegangen. Diese Auseinandersetzung fand in erster Linie auf einer wissenschaftstheoretischen Ebene statt (weiterführend: Waltz 1975, 1990). Der damals innovative Ansatz von Waltz, der in den 1970er-Jahren entstanden ist, lag in dem Versuch, eine in ihrer Einfachheit und Kompaktheit radikale Theorie der internationalen Politik zu entfalten, die mit einem Minimum an Variablen auskommt. Der absolut bestimmende Faktor für die Erklärung internationaler Politik - und internationale Politik bedeutet für Waltz die relative "Position" von Staaten zueinander und die Wahrung dieser Position - ist die Struktur des internationalen Systems. Diese Struktur definiert sich durch das "Ordnungsprinzip" Anarchie (dem Fehlen einer internationalen Instanz, die verbindlich Recht setzen und durchsetzen kann) und durch die Verteilung von Machtressourcen auf die Staaten. Waltz geht davon aus, dass die Struktur des internationalen Systems unmittelbar die immer wiederkehrenden Grundmuster und Folgen des Verhaltens der Staaten untereinander erklärt.[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 2. Die Hauptkomponenten des strukturellen Realismus von Kenneth N. Waltz
- 2.1 Wissenschaftstheoretische Grundannahmen
- 2.2 Struktureller Dreisatz von Waltz: „ordering principle”, „qualities”, „capabilities”
- 2.3 Positionale „Sicherheit” als Motivationsfaktor und die Rolle des Machtgleichgewichts
- 2.4 Ergänzungen nach dem Ende des Kalten Kriegs
- 3. Interne Kritik und andere neorealistische Theorien
- 3.1 Von strukturalistischen zu dynamischen Analysekonzepten
- 3.2 Ökonomischer Realismus (Robert L. Gilpin)
- 3.3 Neorealistische Kooperationstheorie (Joseph M. Grieco)
- 3.4 Konfiguratorischer Realismus (Werner Link)
- 3.5 Synoptischer Realismus und Konstellationsanalyse
- 4. Der Neorealismus in der Debatte: Rezeption und externe Kritik
- 4.1 Die Neorealismus-Globalismus-Debatte
- 4.2 Die Neorealismus-Neoliberalismus-Debatte
- 4.3 Die Rationalismus-Reflektivismus-Debatte
- 4.4 Die Relevanz von Neorealismus
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text befasst sich mit dem Neorealismus in der Theorie der internationalen Politik. Er analysiert die Hauptkomponenten des strukturellen Realismus nach Kenneth N. Waltz und beleuchtet die wissenschaftstheoretischen Grundannahmen dieses Ansatzes. Darüber hinaus werden interne Kritikpunkte am Neorealismus und alternative neorealistische Theorien vorgestellt. Der Text betrachtet den Neorealismus im Kontext von Debatten und Kontroversen innerhalb der internationalen Politik und beleuchtet seine Relevanz in der heutigen Zeit.
- Struktureller Realismus nach Waltz
- Wissenschaftstheoretische Grundlagen des Neorealismus
- Kritik und alternative neorealistische Theorien
- Rezeption und externe Kritik am Neorealismus
- Relevanz des Neorealismus in der heutigen Zeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Neorealismus als ein facettenreiches Paradigma vor und führt in die Hauptthemen des Textes ein. Das zweite Kapitel analysiert die Hauptkomponenten des strukturellen Realismus von Kenneth N. Waltz. Es werden die wissenschaftstheoretischen Grundannahmen des Ansatzes erläutert und die drei wichtigsten Elemente – Ordnungsprinzip, Qualitäten und Fähigkeiten – dargestellt. Darüber hinaus wird die Rolle des Machtgleichgewichts und des Motivationsfaktors „Sicherheit“ im Kontext des strukturellen Realismus untersucht. Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit interner Kritik am Neorealismus und anderen neorealistischen Theorien. Es werden verschiedene Ansätze vorgestellt, die sich von Waltz's Theorie abgrenzen, darunter der ökonomische Realismus (Robert L. Gilpin), die neorealistische Kooperationstheorie (Joseph M. Grieco) und der Konfiguratorische Realismus (Werner Link). Das vierte Kapitel betrachtet die Rezeption des Neorealismus in der Debatte und externe Kritik. Es werden die Neorealismus-Globalismus-Debatte, die Neorealismus-Neoliberalismus-Debatte und die Rationalismus-Reflektivismus-Debatte analysiert. Abschließend wird die Relevanz des Neorealismus für die heutige Zeit diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter des Textes sind: Neorealismus, struktureller Realismus, Kenneth N. Waltz, internationale Politik, Anarchie, Machtgleichgewicht, Sicherheit, Kritik, alternative Theorien, Debatten, Rezeption, Relevanz.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Kern des strukturellen Realismus nach Kenneth Waltz?
Waltz postuliert, dass die Struktur des internationalen Systems (Anarchie und Machtverteilung) das Verhalten von Staaten unmittelbar bestimmt, unabhängig von deren innerer Verfassung.
Was bedeutet "Anarchie" im Neorealismus?
Anarchie bezeichnet das Fehlen einer zentralen Weltregierung, die verbindliches Recht durchsetzen kann, was Staaten dazu zwingt, primär für ihre eigene Sicherheit zu sorgen.
Welche Kritik gibt es am Ansatz von Waltz?
Kritiker bemängeln die Radikalität und Einfachheit des Modells sowie die Vernachlässigung ökonomischer Faktoren und dynamischer Analysekonzepte.
Was unterscheidet den Neorealismus vom klassischen Realismus?
Während der klassische Realismus (Morgenthau) Machtstreben aus der menschlichen Natur ableitet, begründet der Neorealismus es systemtheoretisch durch die Struktur des internationalen Systems.
Welche anderen neorealistischen Theorien gibt es?
Dazu gehören der ökonomische Realismus (Gilpin), die neorealistische Kooperationstheorie (Grieco) und der Konfiguratorische Realismus (Link).
- Arbeit zitieren
- Alexander Siedschlag (Autor:in), 2002, Neorealismus in der Theorie internationaler Politik, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/5525