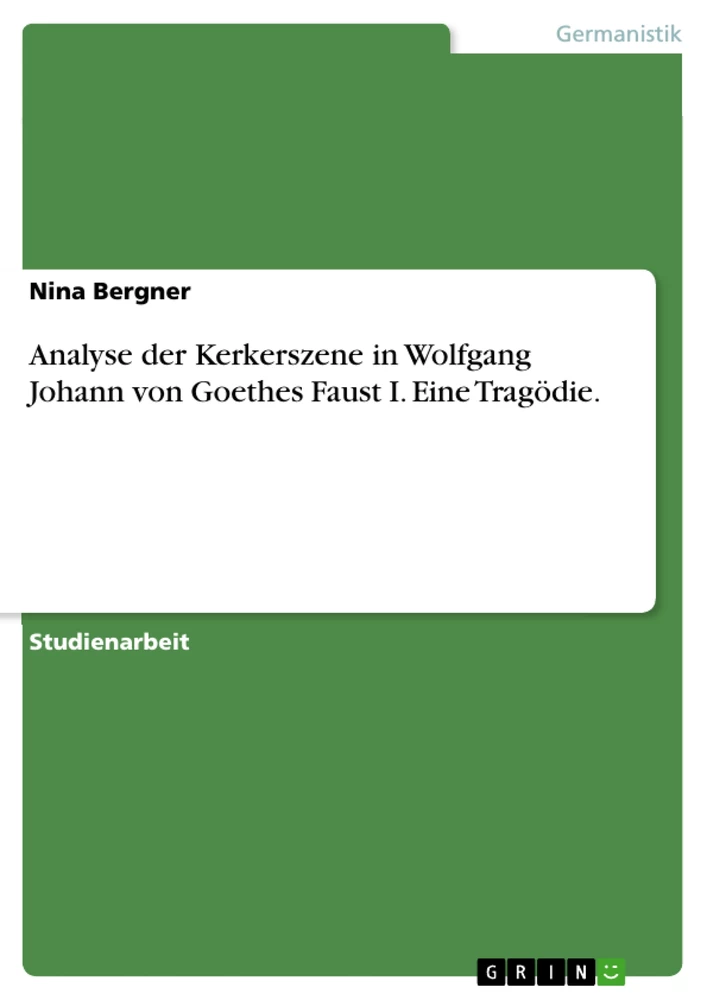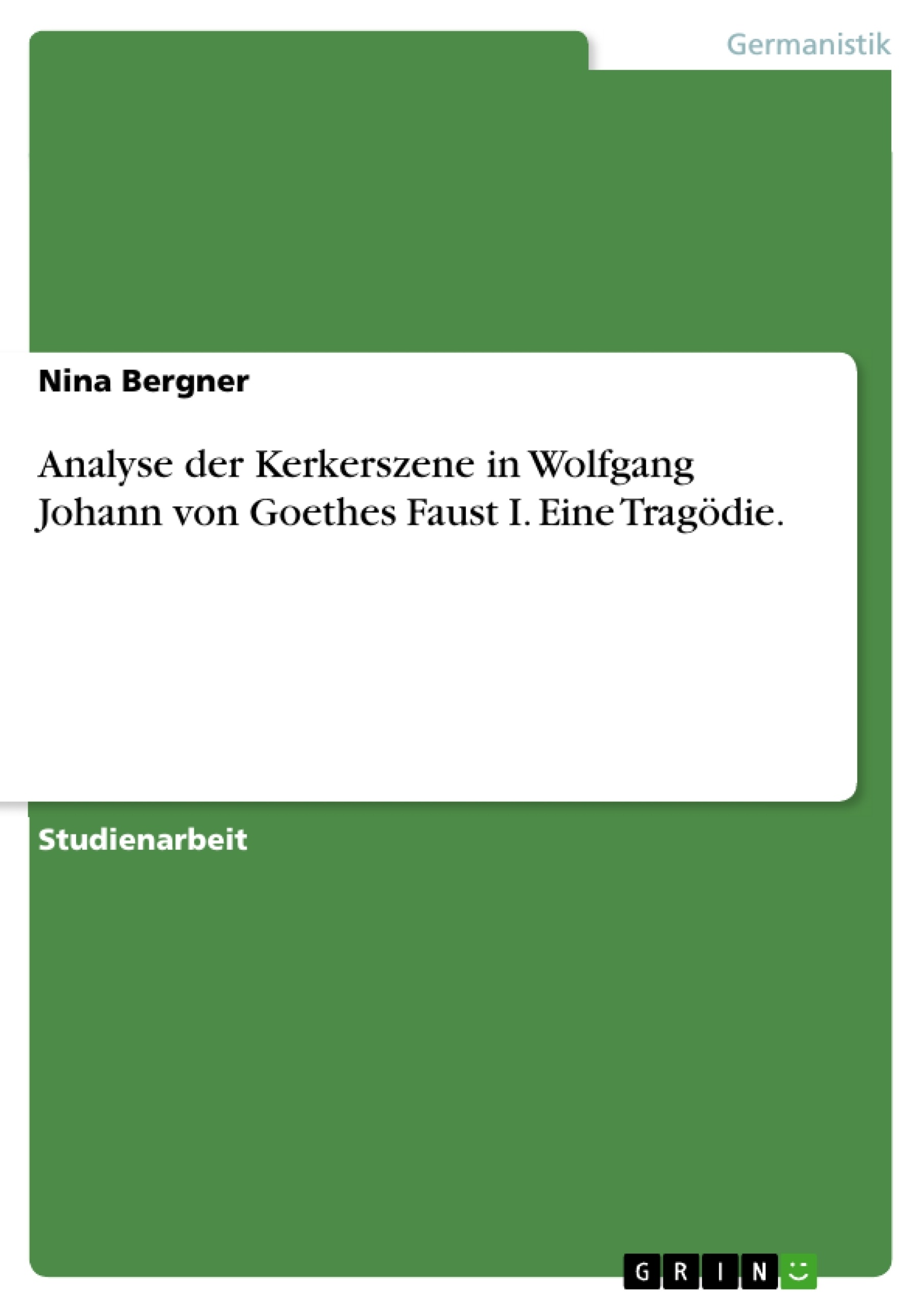In Johann Wolfgang von Goethes „Faust. Der Tragödie erster Teil“ geht es hauptsächlich um Doktor Faust, welcher mit Mephistopheles, dem Teufel, eine Wette abschließt. Mephisto soll ihm einen Moment des irdischen Lebens zeigen, welcher Faust zu der Äußerung: „Verweile doch! du bist so schön!“ (V1700) veranlasst. Falls Mephisto dies schaffen sollte, gehöre Faust ihm: „Dann magst du mich [= Faust] in Fesseln schlagen“ (V1701). Sollte Mephisto dies nicht gelingen, wird dieser auf Fausts Seele verzichten müssen. Auf der „Weltfahrt“ mit Mephisto erlebt Faust seine Verjüngung in der Hexenküche und Konfrontationen gesellschaftlicher und politischer Probleme seiner Zeit. Unter anderem lernt er Margarete (Gretchen) kennen, in die er sich „verliebt“. Gretchen ist ein wohlerzogenes, „braves“, junges Mädchen niederen Standes, welches Faust schnell verfällt. Zwischen beiden kommt es zur so genannten „Gretchen-Tragödie“: Sie bringt aus Versehen ihre Mutter durch ein vermeintliches Schlafmittel um, welches sie auf Anraten Mephistos bekommt; sie fühlt sich verantwortlich für den Mord an ihrem Bruder, Valentin, durch Faust mit der Hilfe Mephistos und ertränkt schließlich ihr und Fausts gemeinsames Kind.
Die Gretchen-Tragödie findet in der letzten Szene, der „Kerkerszene“ ihren Höhepunkt, ihr irdisches Ende, ihre Erlösung.
Die Schluss-Szene ist höchst interessant zu analysieren, da sich gegen Ende, vor allem eines Dramas oder, wie hier, einer Tragödie, die Handlung zuspitzt und am spannungsreichsten beziehungsweise tragischsten wird. Auch so in dieser: Die „Kerkerszene enthält das Höchstmaß an Dramatik, das im ‚Faust’ überhaupt möglich ist“ . Sie ist „etwas, zu dem es keinen Vergleich im ganzen Werk gab“ . Sie wird als „die mächtigste […] Szene“ der ganzen Tragödie bezeichnet. Darum reizt es mich besonders mich mit dieser letzten zu beschäftigen.
Bei der „Kerkerszene“ ist zu betonen, dass vor allem die letzten paar Verse, welche jeweils nur einen kurzen Ausruf einer Figur darstellen, nicht nur beim genauen Betrachten viele Bedeutungsmöglichkeiten zulassen, sondern auch den Bezug zum Mikro- und Makrokosmos darstellen, sowie eine Brücke zu allem Vergangenen im ersten Teil der Faust-Tragödie schlagen.
Vorerst werde ich einige Hintergründe zu der Szene zu erklären versuchen. Danach werde ich einen Überblick über den Inhalt der Szene geben, so dass der Teil der interpretatorischen Analyse möglich ist, welcher den Hauptteil der Arbeit ausmachen soll.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hintergründe zur „Kerkerszene“
- Vergleich zum „Urfaust“
- Susanna Margaretha Brandt
- Das Machandelboom-Märchen
- Inhalt der „Kerkerszene“
- Interpretatorische Analyse
- Äußere Form
- Innere Form
- Eingangsmonologe der Hauptcharaktere der Szene
- Hauptteil der Szene
- Schluss der Szene
- Schlussgedanke
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die „Kerkerszene“ aus Goethes „Faust I“, um die dramatische Gestaltung und die tiefgründige Thematik der Szene zu untersuchen. Die Analyse fokussiert auf die sprachliche und dramaturgische Gestaltung, die Hintergründe der Szene und deren Bedeutung im Kontext des Gesamtwerkes.
- Dramaturgische Gestaltung der Kerkerszene
- Einfluss von "Urfaust" und Susanna Margaretha Brandt
- Symbolische Bedeutung des Machandelboom-Märchens
- Charakterentwicklung von Faust und Gretchen
- Thematisierung von Schuld, Reue und Erlösung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik von Goethes „Faust. Der Tragödie erster Teil“ ein und stellt die Wette zwischen Faust und Mephistopheles vor. Sie beschreibt die „Gretchen-Tragödie“ und ihren Höhepunkt in der „Kerkerszene“, die als die dramatischste und bedeutendste Szene des Werkes hervorgehoben wird. Die Arbeit kündigt die Analyse der Szene an, die sich auf die Hintergründe, den Inhalt und die interpretatorische Analyse konzentrieren wird.
Hintergründe zur „Kerkerszene“: Dieses Kapitel beleuchtet verschiedene Hintergründe der „Kerkerszene“. Es vergleicht die Szene mit ihrer Version im „Urfaust“, hebt die Unterschiede in der Prosa- und Versform hervor und diskutiert den Einfluss von Susanna Margaretha Brandt, einer realen Kindsmörderin, auf die Figur des Gretchen. Schließlich wird das Machandelboom-Märchen als weiterer relevanter Kontext für die Szene vorgestellt, dessen Bedeutung später im Detail analysiert wird. Der Vergleich zum Urfaust betont die stilistische Entwicklung Goethes und die Verstärkung der Dramatik durch die Wahl der Reimform in der endgültigen Fassung. Susanna Margaretha Brandt dient als historischer Bezugspunkt für die Darstellung des Gretchens und ihrer Verzweiflungstat. Das Machandelboom-Märchen liefert ein mythologisches und symbolisches Verständnis für Gretchens Zustand.
Inhalt der „Kerkerszene“: Dieser Abschnitt gibt einen zusammenfassenden Überblick über die Handlung der „Kerkerszene“. Er beschreibt das Zusammentreffen von Faust und Gretchen im Kerker, Gretchens Verwirrung und ihren Gesang, sowie ihre Auseinandersetzung mit Faust und ihre endgültige Hinwendung zu Gott. Die Zusammenfassung skizziert die wichtigsten Ereignisse der Szene, ohne jedoch bereits eine detaillierte Interpretation anzubieten. Fausts Bemühungen, Gretchen zu retten, Gretchens Schuldbewusstsein und die Konfrontation mit Mephistopheles bilden die zentralen Elemente dieser Zusammenfassung.
Interpretatorische Analyse: Dieser Abschnitt bietet eine detaillierte interpretatorische Analyse der „Kerkerszene“. Er beginnt mit einer Untersuchung der äußeren Form, indem er die Metrik und den Sprachstil von Faust und Gretchen vergleicht und die Bedeutung der stilistischen Veränderungen für die Charakterentwicklung herausarbeitet. Im zweiten Teil der Analyse wird die innere Form der Szene untersucht, mit Fokus auf die Eingangsmonologe, den Hauptteil und den Schluss der Szene. Die Analyse beleuchtet die symbolische Bedeutung des Machandelboom-Märchens, die Rolle der Regieanweisungen und die Verwendung von Bibelzitaten. Die Analyse der äußeren Form analysiert die stilistische Veränderung von Faust und Gretchen, die ihre emotionalen Zustände widerspiegeln. Die Analyse der inneren Form konzentriert sich auf die Bedeutung von Monologen, Dialogen, und Symboliken, um die psychologischen und theologischen Aspekte der Szene zu verstehen.
Schlüsselwörter
Goethe, Faust I, Kerkerszene, Gretchen-Tragödie, Dramenanalyse, Mephistopheles, Schuld, Reue, Erlösung, Machandelboom-Märchen, Susanna Margaretha Brandt, Tragödie, Katharsis, Mikrokosmos, Makrokosmos.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse der Kerkerszene in Goethes Faust I
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die „Kerkerszene“ aus Goethes „Faust I“. Sie untersucht die dramatische Gestaltung und die tiefgründige Thematik der Szene, fokussiert auf sprachliche und dramaturgische Aspekte, Hintergründe und die Bedeutung im Gesamtwerk. Die Analyse umfasst Einleitung, Hintergrundinformationen (inkl. Vergleich zum „Urfaust“, Susanna Margaretha Brandt und dem Machandelboom-Märchen), Inhaltszusammenfassung, interpretatorische Analyse (äußere und innere Form) und einen Schlussgedanken.
Welche Themen werden in der Analyse behandelt?
Die Arbeit behandelt die dramaturgische Gestaltung der Kerkerszene, den Einfluss von „Urfaust“ und Susanna Margaretha Brandt, die symbolische Bedeutung des Machandelboom-Märchens, die Charakterentwicklung von Faust und Gretchen sowie die Thematisierung von Schuld, Reue und Erlösung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu den Hintergründen der Kerkerszene, ein Kapitel zum Inhalt der Szene, eine interpretatorische Analyse (mit Unterkapiteln zur äußeren und inneren Form) und einen Schlussgedanken. Das Inhaltsverzeichnis bietet einen detaillierten Überblick über die einzelnen Abschnitte.
Was wird in der Einleitung erläutert?
Die Einleitung führt in die Thematik von Goethes „Faust I“ ein, stellt die Wette zwischen Faust und Mephistopheles vor, beschreibt die „Gretchen-Tragödie“ und hebt die Bedeutung der Kerkerszene hervor. Sie kündigt die folgende Analyse an.
Welche Hintergründe zur Kerkerszene werden beleuchtet?
Das Kapitel zu den Hintergründen vergleicht die Szene mit dem „Urfaust“, diskutiert den Einfluss von Susanna Margaretha Brandt und die Bedeutung des Machandelboom-Märchens. Es werden die stilistischen Unterschiede zwischen den Fassungen und der historische und mythologische Kontext der Szene erläutert.
Wie wird der Inhalt der Kerkerszene zusammengefasst?
Die Inhaltszusammenfassung beschreibt das Zusammentreffen von Faust und Gretchen im Kerker, Gretchens Verwirrung und Gesang, ihre Auseinandersetzung mit Faust und ihre Hinwendung zu Gott. Die wichtigsten Ereignisse werden skizziert, ohne detaillierte Interpretation.
Wie sieht die interpretatorische Analyse aus?
Die interpretatorische Analyse untersucht die äußere Form (Metrik, Sprachstil) und die innere Form (Eingangsmonologe, Hauptteil, Schluss) der Szene. Sie beleuchtet die symbolische Bedeutung des Machandelboom-Märchens, die Rolle der Regieanweisungen und die Verwendung von Bibelzitaten. Die Analyse betrachtet stilistische Veränderungen, Monologe, Dialoge und Symboliken, um psychologische und theologische Aspekte zu verstehen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Goethe, Faust I, Kerkerszene, Gretchen-Tragödie, Dramenanalyse, Mephistopheles, Schuld, Reue, Erlösung, Machandelboom-Märchen, Susanna Margaretha Brandt, Tragödie, Katharsis, Mikrokosmos, Makrokosmos.
- Arbeit zitieren
- Nina Bergner (Autor:in), 2003, Analyse der Kerkerszene in Wolfgang Johann von Goethes Faust I. Eine Tragödie., München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/55220