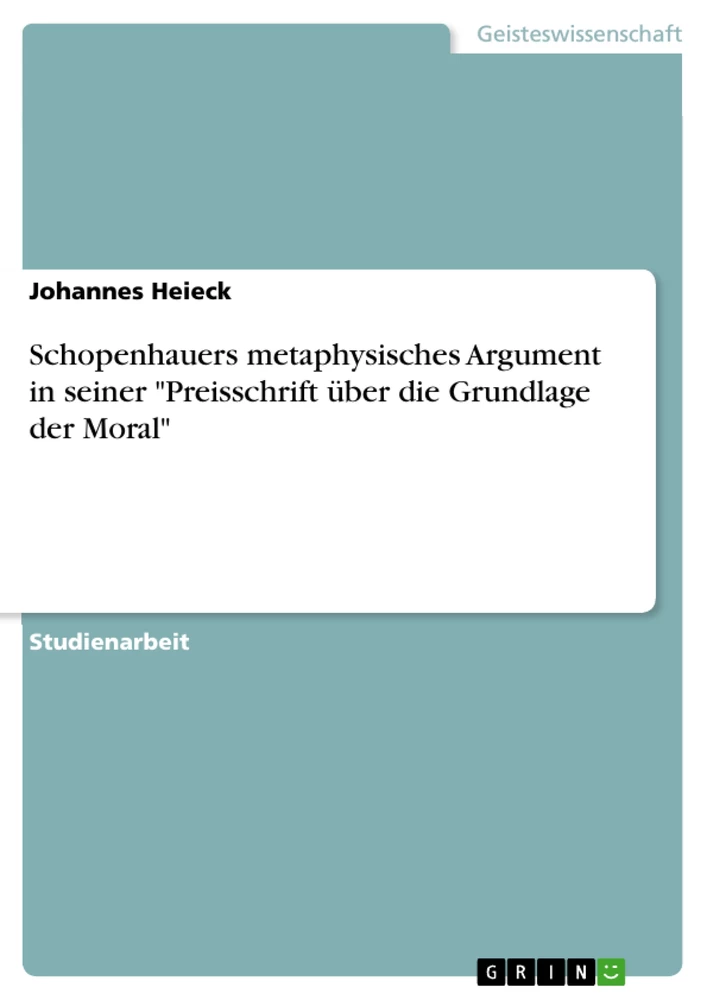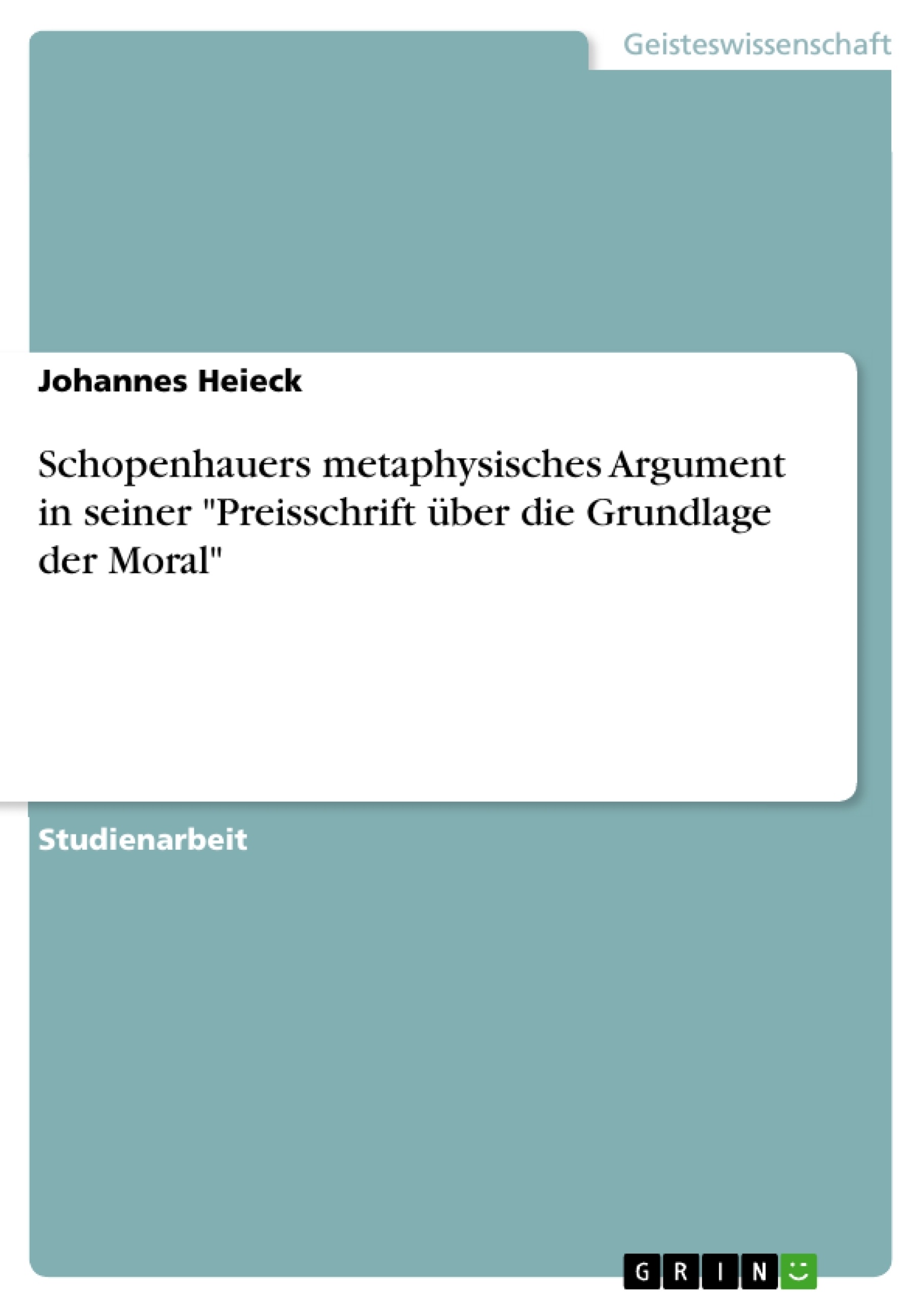Nachdem Schopenhauer in seiner „Preisschrift über die Grundlage der Moral“ das Mitleid als
die Triebfeder aller moralischen Handlungen nachgewiesen hat, entschließt er sich, der Arbeit
noch eine Zugabe beizufügen. Er ist bei seinen Untersuchungen zu der Ansicht gelangt, dass
allein die Metaphysik in der Lage ist, dem Menschen die „letzte Befriedigung und
Beruhigung“ zu gewähren. Dieser möchte er sich in den letzten beiden Paragraphen seiner
Preisschrift widmen.
Die vorliegende Arbeit soll einen Überblick über diese beiden letzten Paragraphen geben.
Zunächst soll der Gedankengang Schopenhauers wiedergegeben werden. In den darauf
folgenden Abschnitten soll gezeigt werden, welche verschiedenen Elemente ihn bei der
Entwicklung seiner eigenen Metaphysik beeinflusst haben. Hierbei sollen seine Ausführungen
zur Philosophie Immanuel Kants ebenso betrachtet werden, wie seine Beziehung zur
Christlichen Heilslehre und seine offenkundige Affinität zum Buddhismus.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Hauptteil
- II. 1: Der Paragraph 21
- II. 2: Der Paragraph 22
- II. 3: Schopenhauers Kritik am Christentum
- II. 4: Schopenhauers Kritik an Kant
- II. 5: Schopenhauers Moralkonzeption
- III. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert Schopenhauers metaphysisches Argument in seiner „Preisschrift über die Grundlage der Moral“, indem sie seine Gedanken in den letzten beiden Paragraphen der Schrift beleuchtet. Die Arbeit verfolgt das Ziel, Schopenhauers Argumentation und die Einflüsse, die seine Metaphysik prägten, aufzuzeigen.
- Die Bedeutung der Metaphysik für Schopenhauers Moralphilosophie
- Schopenhauers Kritik an traditionellen Ansätzen zur Moral
- Schopenhauers eigene Moralkonzeption und seine Verbindung zu seinem metaphysischen System
- Der Einfluss von Kant und dem Buddhismus auf Schopenhauers Gedanken
- Die Rolle des Mitleids als moralische Triebfeder
Zusammenfassung der Kapitel
I.: Einleitung
Die Einleitung stellt Schopenhauers „Preisschrift über die Grundlage der Moral“ vor und erklärt den Fokus der Arbeit auf die beiden letzten Paragraphen der Schrift, die sich mit Schopenhauers metaphysischen Argumenten befassen. Die Arbeit verfolgt das Ziel, Schopenhauers Gedankengang und die Einflüsse auf seine Metaphysik zu beleuchten.
II. 1: $21
In diesem Abschnitt stellt Schopenhauer seine These vor, dass jedes menschliche Leben auf den Tod ausgerichtet ist und jeder Mensch sein Leben in moralischer Rücksicht beenden möchte. Er belegt dies anhand verschiedener Beispiele und argumentiert, dass die Metaphysik eine zentrale Rolle für das Verständnis des moralischen Urphänomens spielt. Schopenhauer widerspricht dabei den einzelnen Religionen, die ihr Dogma als allgemeingültige Wurzel der Moral ausgeben.
II. 2: $22
Schopenhauer kritisiert die nachkantische Philosophie und ihre Unfähigkeit, die Problematik des moralischen Ursprungs zu lösen. Er greift die Konzepte von „Gut“ und „Böse“ als relative Begriffe der Erfahrungswelt auf und erklärt, wie Mitleid entsteht und die Unterschiede zwischen Charakteren spiegelt. Schopenhauer argumentiert, dass die Trennung zwischen dem eigenen Selbst und dem Anderen nur scheinbar ist und basiert auf der begrenzten Erkenntnisfähigkeit des Menschen. Er bezieht sich auf Kants Lehre von Raum und Zeit und zeigt auf, dass die Vielheit der Welt nur eine Erscheinung ist und ein wahres Wesen dahintersteckt.
Schlüsselwörter
Schopenhauers Metaphysik, Moral, Mitleid, Tod, Kritik am Christentum, Kritik an Kant, „Preisschrift über die Grundlage der Moral“, Buddhismus, metaphysisches Argument, „Urphänomen“, „Ding an sich“, „Transzendentale Ästhetik“
Häufig gestellte Fragen
Was ist die zentrale Triebfeder der Moral laut Schopenhauer?
Schopenhauer identifiziert das Mitleid als die alleinige Triebfeder aller moralischen Handlungen.
Welche Rolle spielt die Metaphysik in Schopenhauers Ethik?
Die Metaphysik dient dazu, dem Menschen die „letzte Befriedigung und Beruhigung“ zu gewähren und das moralische Urphänomen tiefer zu begründen.
Wie kritisiert Schopenhauer das Christentum?
Er kritisiert die religiösen Dogmen, die sich als allgemeingültige Wurzel der Moral ausgeben, und stellt dem seine eigene metaphysische Begründung gegenüber.
Welchen Einfluss hatte Immanuel Kant auf Schopenhauer?
Schopenhauer bezieht sich auf Kants Lehre von Raum und Zeit sowie die Transzendentale Ästhetik, kritisiert jedoch Kants Begründung der Moral.
Was versteht Schopenhauer unter der „Vielheit der Welt“?
Er argumentiert, dass die Vielheit nur eine Erscheinung ist und dass die Trennung zwischen dem Selbst und dem Anderen auf der begrenzten Erkenntnisfähigkeit basiert.
Welche Verbindung besteht zwischen Schopenhauer und dem Buddhismus?
Die Arbeit beleuchtet Schopenhauers offenkundige Affinität zum Buddhismus, insbesondere im Hinblick auf seine Sicht der Welt als Erscheinung und das Mitleid.
- Citar trabajo
- Johannes Heieck (Autor), 2006, Schopenhauers metaphysisches Argument in seiner "Preisschrift über die Grundlage der Moral", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/55019