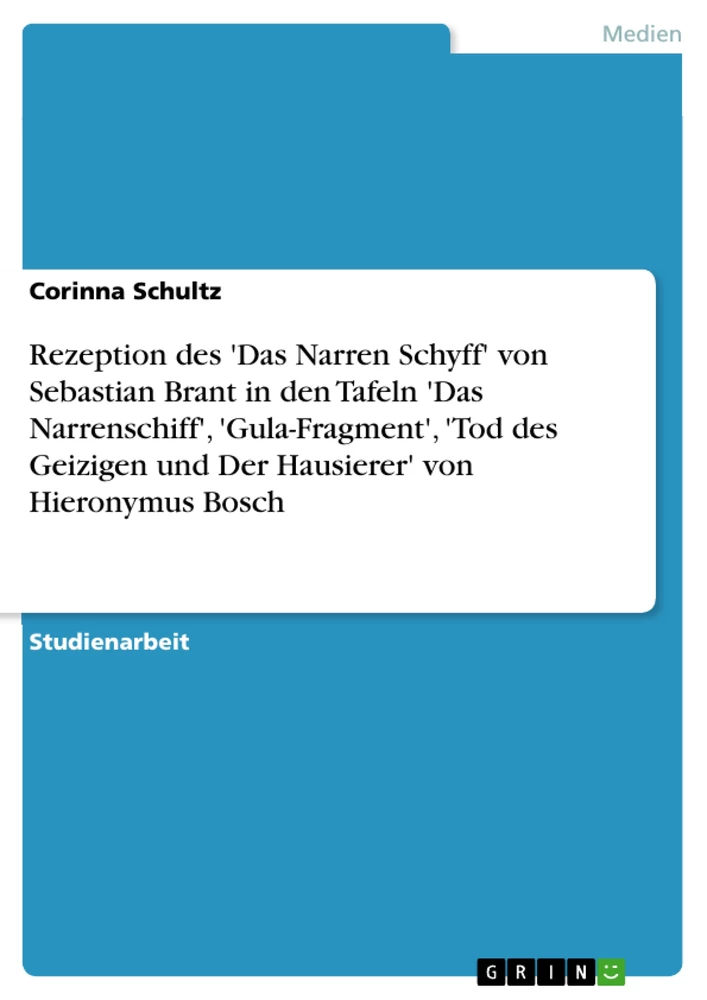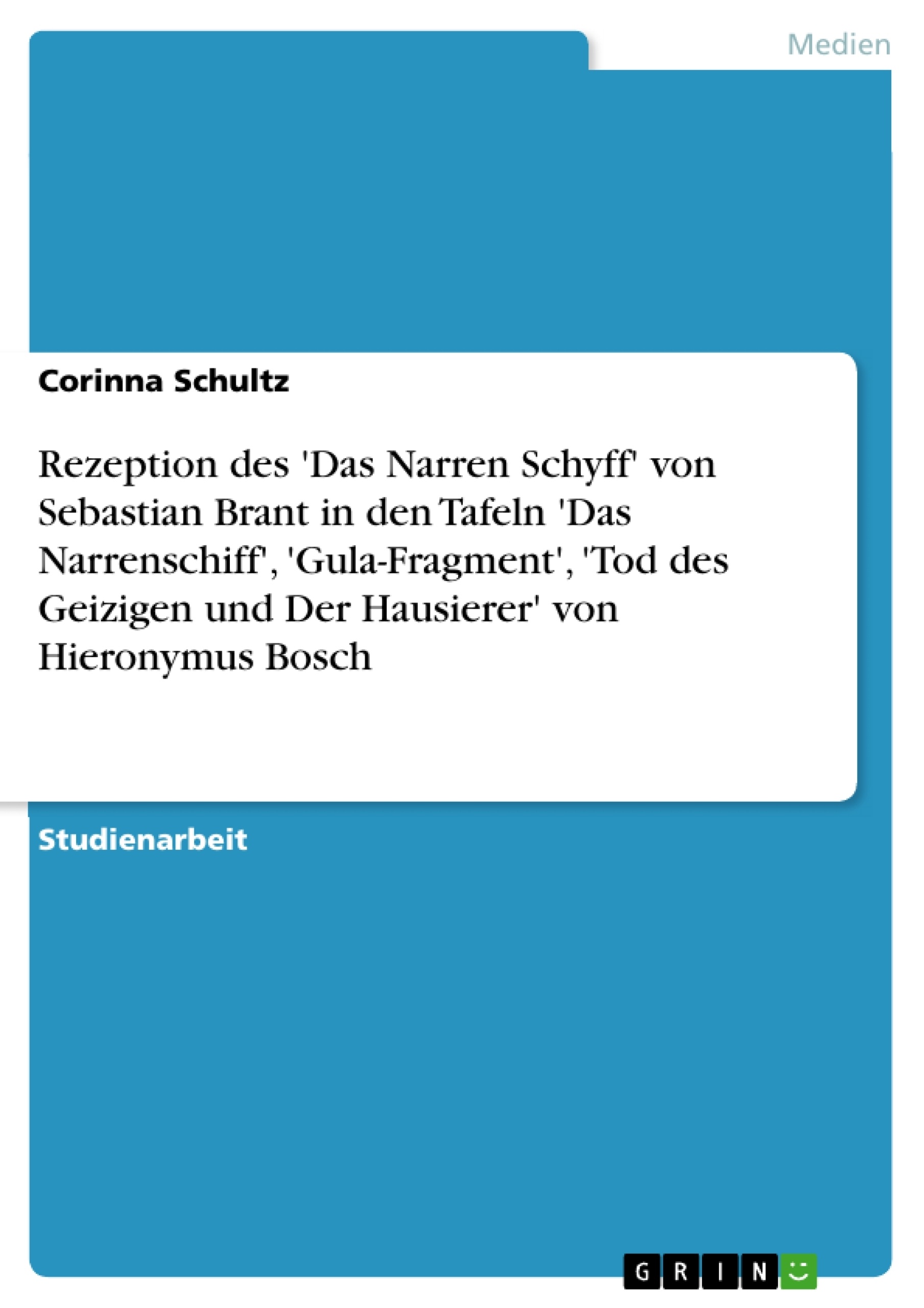Im ursprünglichen Sinne ist der Narr ein pathologisch Irrsinniger. Geisteskranke, geistige Behinderte und Missgestaltete galten als „natürliche Narren“. Als „künstliche Narren“ bezeichnete man im Mittelalter die Menschen, die absichtlich Scherze trieben und sich dumm oder tölpelhaft verhielten. Die Hofnarren als „Offizianten“ in einem festen höfischen Amt sollten ihren Herrn allerdings nicht belustigen, sondern ihn als ernste Figur ständig daran erinnern, dass auch er in Sünde fallen könne und darin sterben werde. Sie waren also eine soziale Institution zulässiger Kritik. In der Bibel ist der Narr ebenfalls keine Figur, die nur Späße machte, sondern eine negative Gestalt. Er ist ein Gottesleugner: „Die Toren sprechen in ihrem Herzen: Es gibt keinen Gott.“
Hieronymus Bosch beschäftigte sich gleichfalls mit dem Narrenthema. Ein Zeugnis davon tragen die Tafeln das Narrenschiff (Musée du Louvre, Paris), Gula-Fragment (New Haven), Tod des Geizigen (National Gallery of Art, Washington) und der Hausierer (Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam). Alle vier Arbeiten wurden mit Öl auf Eichenholz gemalt. Die technische Untersuchung der Werke mittels Infrarotfotografie und Dendrochronolgie hat ergeben, dass sie „alle aus demselben Baumstamm [stammen]. Aber sie bilden nicht nur materiell, sondern auch inhaltlich eine Einheit“3, was es noch zu untersuchen gilt. Setzt man das Gula-Fragment als unteres Teilstück mit dem Narrenschiff zusammen, ergibt sich ein Format von 92,1x30,9cm. Der Tod des Geizigen weist eine Größe von 92,6x30,8cm auf. Der Durchmesser der Kreisform des Hausierers beträgt 64,6cm. Das Format, die Malweise und die Holzanalyse bringen deutliche Argumente für die Zusammengehörigkeit der vier Tafeln.
Inhaltsverzeichnis
- Das Narrenthema
- Die ausgewählten vier Tafeln des Hieronymus Bosch
- Das Narrenschiff
- Gula-Fragment
- Tod des Geizigen
- Der Hausierer
- Sebastian Brant: „Das Narren Schyff“
- Vergleich der Werke beider Künstler
- Ergeben die vier ausgewählten Tafeln ein unvollständiges Triptychon?
- Zusammenfassende Interpretation
- Quellen- und Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Rezeption des „Das Narren Schyff“ von Sebastian Brant in vier Tafeln des niederländischen Malers Hieronymus Bosch. Im Fokus steht die Analyse der ikonografischen Elemente und der Symbolik, um die Beziehung zwischen den beiden Werken aufzuzeigen und die Bedeutung des Narrenthemas in der Kunst und Literatur des späten Mittelalters zu beleuchten.
- Das Narrenthema in Kunst und Literatur des Mittelalters
- Die Rezeption von Brants „Das Narren Schyff“ in der Kunst
- Ikonografische Analyse der vier Tafeln des Hieronymus Bosch
- Vergleich der Werke Brants und Boschs
- Zusammenhang zwischen den vier Tafeln und deren mögliche Interpretation als unvollständiges Triptychon
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet das Narrenthema in seinem historischen Kontext und zeigt die Bedeutung des Narren in der Gesellschaft, der Literatur und der Kunst des Mittelalters auf. Das zweite Kapitel widmet sich den vier ausgewählten Tafeln des Hieronymus Bosch: „Das Narrenschiff“, „Gula-Fragment“, „Tod des Geizigen“ und „Der Hausierer“. Es werden die ikonografischen Elemente und die Symbolik der einzelnen Tafeln analysiert, um die Beziehung zwischen den Werken und das Narrenthema zu beleuchten.
Kapitel 3 beschäftigt sich mit dem Werk Sebastian Brants „Das Narren Schyff“ und dessen Bedeutung für die Zeit des ausgehenden Mittelalters. Im vierten Kapitel werden die Werke beider Künstler miteinander verglichen, um Parallelen und Unterschiede in der Behandlung des Narrenthemas aufzuzeigen.
Schlüsselwörter
Narrenthema, Hieronymus Bosch, Sebastian Brant, „Das Narren Schyff“, Ikonografie, Symbolik, Mittelalter, Kunstgeschichte, Literaturgeschichte.
Häufig gestellte Fragen
Wie hängen Hieronymus Bosch und Sebastian Brant zusammen?
Bosch rezipierte in seinen Werken Themen aus Brants berühmter Moralsatire „Das Narren Schyff“, insbesondere die Kritik an menschlichen Lastern und Sünden.
Welche vier Tafeln von Bosch werden in der Arbeit untersucht?
Untersucht werden „Das Narrenschiff“, das „Gula-Fragment“, der „Tod des Geizigen“ und „Der Hausierer“.
Bilden diese vier Tafeln ein gemeinsames Kunstwerk?
Technische Analysen (Dendrochronologie) zeigen, dass alle Tafeln aus demselben Baumstamm stammen und vermutlich Teile eines heute unvollständigen Triptychons waren.
Was symbolisierte der Narr im Mittelalter?
Der Narr war nicht nur zur Belustigung da; er galt als Figur der Sünde, als Gottesleugner und als soziale Institution zur zulässigen Kritik an der Obrigkeit.
Was ist das „Gula-Fragment“?
Es ist ein Teilstück, das ursprünglich unter dem „Narrenschiff“ angeordnet war und das Laster der Völlerei (Gula) thematisiert.
- Citation du texte
- Corinna Schultz (Auteur), 2006, Rezeption des 'Das Narren Schyff' von Sebastian Brant in den Tafeln 'Das Narrenschiff', 'Gula-Fragment', 'Tod des Geizigen und Der Hausierer' von Hieronymus Bosch, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/54677