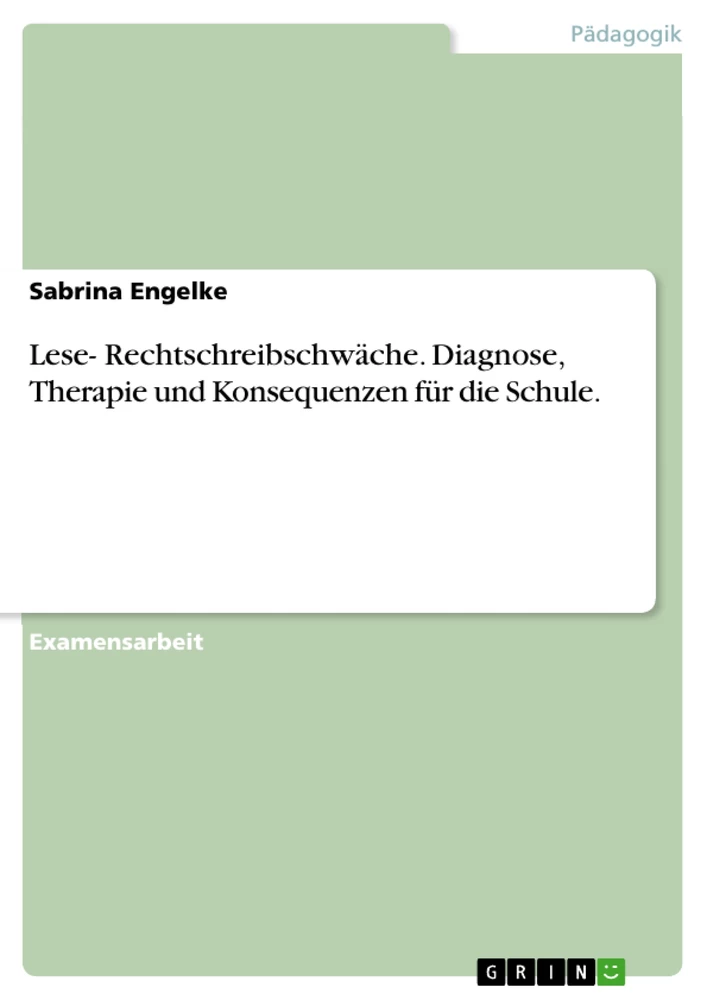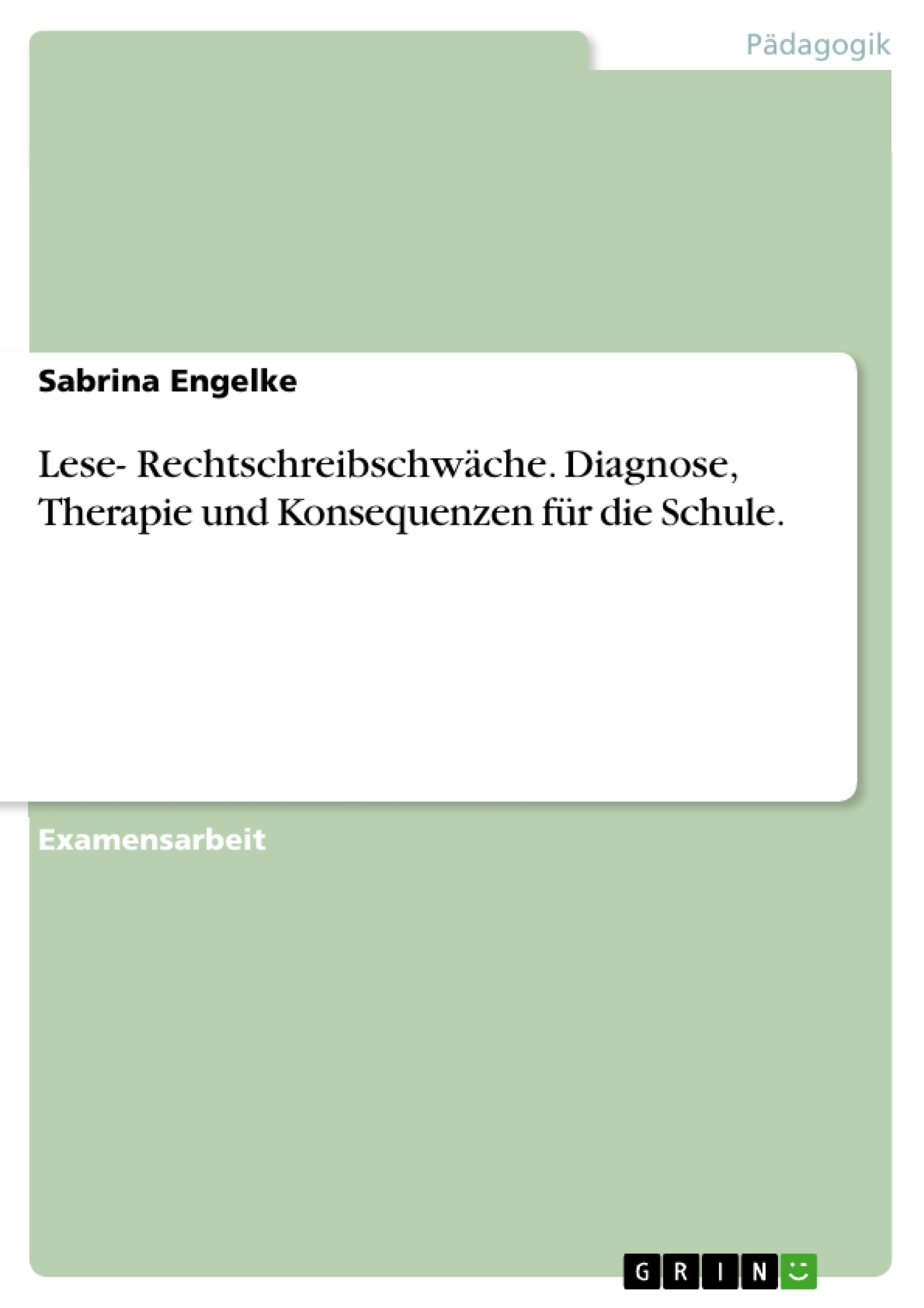Ziel dieser Arbeit soll nicht sein, den Stand der Forschung und verschiedene Forschungsaspekte zur Legasthenie wiederzugeben. Es soll auch nicht darum gehen, die verschiedenen Forschungsansätze und -theorien zur Ursachenforschung zu diskutieren. Ich möchte mich auf die - für Lehrer, Eltern und Betroffene - wesentlichen Details konzentrieren. Das ist zum einen die Definition der Legasthenie und zum anderen sind es die möglichen Ursachen, aber auch die Diagnosemöglichkeiten und Möglichkeiten der Förderung besonders im Rahmen der Normalschule.
Inhaltsverzeichnis
- A Einleitung
- B Legasthenie
- 1 Definition
- 2 Symptome
- 2.1 Primärsymptome
- 2.2 Begleitstörungen
- 3 Ursachen
- 3.1 Familiäre und soziokulturelle Ursachen
- 3.2 Kognitive Ursachen
- 3.3 Emotionale und motivationale Ursachen
- 3.4 Konstitutionelle bzw. biologische Ursachen
- 3.5 Schulische Ursachen
- 3.6 Fazit
- 4 Prävalenz
- 5 Diagnose
- 5.1 Allgemeines zum Vorgehen in der Diagnostik der Lese- Rechtschreibschwäche
- 5.2 Der Salzburger Lese- und Rechtschreibtest – Ein Beispiel eines diagnostischen Testverfahrens
- 5.3 Eine Möglichkeit zur Diagnose außerhalb der speziellen Diagnostikverfahren
- 5.4 Fazit
- 6 Therapie-/ Fördermöglichkeiten
- 6.1 Die Legasthenie- Förderung und ihre Bedingungen
- 6.1.1 Förderung und Hilfen während des normalen Unterrichts
- 6.1.2 Förderung in LRS- Förderklassen
- 6.1.3 Der LRS- Erlass des Bundeslandes Niedersachsen
- 6.2 Das Marburger Rechtschreibtraining – Ein Beispiel aus den speziellen Verfahren der Legasthenie- Therapie
- 6.1 Die Legasthenie- Förderung und ihre Bedingungen
- C Lernen unter Einbeziehung der Sinne und Grundlagen der Wahrnehmung
- 1 Die für die Wahrnehmung bedeutsamen Sinnessysteme und ihre Bedeutung für schulisches Lernen
- 2 Exkurs: Wahrnehmen und Lernen im Gehirn
- 3 Die Sinne des Menschen und die Wahrnehmung
- 3.1 Das visuelle System
- 3.2 Das auditive System
- 3.3 Das olfaktorische System
- 3.4 Das gustatorische System
- 3.5 Hautsinne und Berührung
- 3.6 Das kinästhetische System
- 4 Die gestörte Wahrnehmung
- 5 Begründung für einen Zusammenhang zwischen Wahrnehmung und Erlernen des Lesens und Schreibens
- D Durchführung einer Fördereinheit unter Einbeziehung des Lernens mit allen Sinnen an rechtschreibschwachen Kindern
- 1 Konzeption
- 2 Die Fördergruppe
- 2.1 Vorstellung der Schule
- 2.2 Vorstellung der Schüler
- 3 Praktische Durchführung der Fördereinheit
- 3.1 Begründung für die Stationsarbeit
- 3.2 Durchführung
- 3.3 Übersicht über die Aufgaben, Übungen und Spiele der Einheit
- 3.4 Ergebnisse des Vortests und das Schülerverhalten
- 3.5 Ergebnisse des Nachtests und das veränderte Schülerverhalten
- 3.4 Vergleich und Auswertung
- E Konsequenzen aus den Erkenntnissen/ Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht Lese-Rechtschreibschwäche (LRS), ihre Diagnose und Therapie sowie die Konsequenzen für die Schule. Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis von LRS zu vermitteln und praktische Fördermöglichkeiten aufzuzeigen.
- Definition und Symptome von Legasthenie
- Ursachen von Lese-Rechtschreibschwäche (biologische, kognitive, soziokulturelle Faktoren)
- Diagnostische Verfahren und deren Anwendung
- Therapieansätze und Fördermöglichkeiten (z.B. Marburger Rechtschreibtraining)
- Bedeutung der Wahrnehmung und sinnliches Lernen bei der Förderung von Kindern mit LRS
Zusammenfassung der Kapitel
A Einleitung: Die Einleitung betont die zentrale Bedeutung von Lese- und Schreibfähigkeit in unserer Gesellschaft und die Herausforderungen, die sich aus Lese-Rechtschreibschwäche (LRS) für betroffene Kinder ergeben. Sie verweist auf den Stillstand der Legasthenieforschung im deutschsprachigen Raum in den 60er und 70er Jahren und die erst in den 90er Jahren einsetzende Wiederaufnahme und Erweiterung von Forschungsansätzen aus dem angloamerikanischen Raum. Weiterhin wird das gesellschaftliche Stigma rund um LRS thematisiert.
B Legasthenie: Dieses Kapitel befasst sich ausführlich mit dem Phänomen der Legasthenie. Es definiert den Begriff, beschreibt detailliert die Primär- und Begleitsymptome und analysiert verschiedene Ursachen, darunter familiäre, kognitive, emotionale, konstitutionelle und schulische Faktoren. Es werden verschiedene diagnostische Verfahren vorgestellt, inklusive einer detaillierten Betrachtung des Salzburger Lese- und Rechtschreibtests. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf verschiedenen Therapie- und Fördermöglichkeiten, von der Unterstützung im regulären Unterricht bis hin zu spezialisierten Förderklassen und dem niedersächsischen LRS-Erlass. Das Marburger Rechtschreibtraining dient als Beispiel für ein spezifisches Therapieverfahren.
C Lernen unter Einbeziehung der Sinne und Grundlagen der Wahrnehmung: Dieses Kapitel untersucht den Zusammenhang zwischen Wahrnehmung und dem Erlernen von Lesen und Schreiben. Es beleuchtet die verschiedenen Sinnessysteme (visuell, auditiv, olfaktorisch, gustatorisch, kinästhetisch) und ihre Bedeutung für den Lernprozess. Der Exkurs zum Wahrnehmen und Lernen im Gehirn bietet neurobiologische Einblicke. Der Abschnitt über gestörte Wahrnehmung ist relevant für das Verständnis von LRS. Schließlich wird ein fundierter Zusammenhang zwischen Wahrnehmung und dem Schriftspracherwerb hergestellt.
D Durchführung einer Fördereinheit unter Einbeziehung des Lernens mit allen Sinnen an rechtschreibschwachen Kindern: Dieses Kapitel beschreibt die praktische Durchführung einer Fördereinheit für rechtschreibschwache Kinder. Es erläutert die Konzeption der Einheit, stellt die Schüler und die Schule vor und beschreibt detailliert die methodische Vorgehensweise, insbesondere die gewählte Stationsarbeit. Die Ergebnisse von Vor- und Nachtests werden präsentiert und analysiert, um die Wirksamkeit der Fördermaßnahme zu evaluieren. Der Vergleich der Testergebnisse zeigt die Entwicklung der Schüler.
Schlüsselwörter
Legasthenie, Lese-Rechtschreibschwäche (LRS), Diagnose, Therapie, Fördermöglichkeiten, Wahrnehmung, Sinnesintegration, schulisches Lernen, Marburger Rechtschreibtraining, Salzburger Lese- und Rechtschreibtest.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Legasthenie, Wahrnehmung und sinnliches Lernen
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Diese Hausarbeit befasst sich umfassend mit dem Thema Legasthenie (LRS), ihren Ursachen, Diagnosemethoden, Therapieansätzen und der Bedeutung von Wahrnehmung und sinnlichem Lernen für die Förderung betroffener Kinder. Sie präsentiert eine Fallstudie mit der Durchführung und Auswertung einer Fördereinheit.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Definition und Symptome von Legasthenie, Ursachen (biologisch, kognitiv, soziokulturell), Diagnostik (inkl. Salzburger Lese- und Rechtschreibtest), Therapie- und Fördermöglichkeiten (z.B. Marburger Rechtschreibtraining), die Rolle der Wahrnehmung und der verschiedenen Sinnessysteme beim Lernen, sowie die praktische Durchführung und Evaluation einer multisensorischen Fördereinheit für Kinder mit LRS.
Welche diagnostischen Verfahren werden beschrieben?
Die Hausarbeit beschreibt verschiedene diagnostische Verfahren zur Erkennung von Legasthenie. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Salzburger Lese- und Rechtschreibtest als Beispiel für ein etabliertes Testverfahren. Zusätzlich werden alternative Diagnosemöglichkeiten außerhalb spezialisierter Testverfahren angesprochen.
Welche Therapie- und Fördermethoden werden vorgestellt?
Die Arbeit stellt verschiedene Therapie- und Fördermethoden für Legasthenie vor, darunter die Unterstützung im regulären Unterricht, Förderklassen und das Marburger Rechtschreibtraining als Beispiel für ein spezifisches Therapieverfahren. Der niedersächsische LRS-Erlass wird ebenfalls thematisiert.
Welche Rolle spielt die Wahrnehmung im Lernprozess von Kindern mit LRS?
Die Hausarbeit betont die wichtige Rolle der Wahrnehmung und der Integration aller Sinne (visuell, auditiv, olfaktorisch, gustatorisch, kinästhetisch) beim Erlernen von Lesen und Schreiben. Ein Exkurs beleuchtet die neurobiologischen Grundlagen des Wahrnehmens und Lernens im Gehirn. Die Arbeit argumentiert für einen engen Zusammenhang zwischen Wahrnehmungsfähigkeit und Schriftspracherwerb.
Wie wird die praktische Fördereinheit beschrieben?
Die Hausarbeit beschreibt detailliert die Konzeption und Durchführung einer Fördereinheit für rechtschreibschwache Kinder. Es wird eine Stationsarbeit eingesetzt. Die Ergebnisse von Vor- und Nachtests werden präsentiert und analysiert, um die Wirksamkeit der Fördermaßnahme zu evaluieren.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Legasthenie, Lese-Rechtschreibschwäche (LRS), Diagnose, Therapie, Fördermöglichkeiten, Wahrnehmung, Sinnesintegration, schulisches Lernen, Marburger Rechtschreibtraining, Salzburger Lese- und Rechtschreibtest.
Welche Zielsetzung verfolgt die Hausarbeit?
Die Hausarbeit zielt darauf ab, ein umfassendes Verständnis von Legasthenie zu vermitteln und praktische Fördermöglichkeiten aufzuzeigen. Sie möchte die Bedeutung der Wahrnehmung und des sinnlichen Lernens für Kinder mit LRS hervorheben.
- Citar trabajo
- Sabrina Engelke (Autor), 2005, Lese- Rechtschreibschwäche. Diagnose, Therapie und Konsequenzen für die Schule., Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/54559