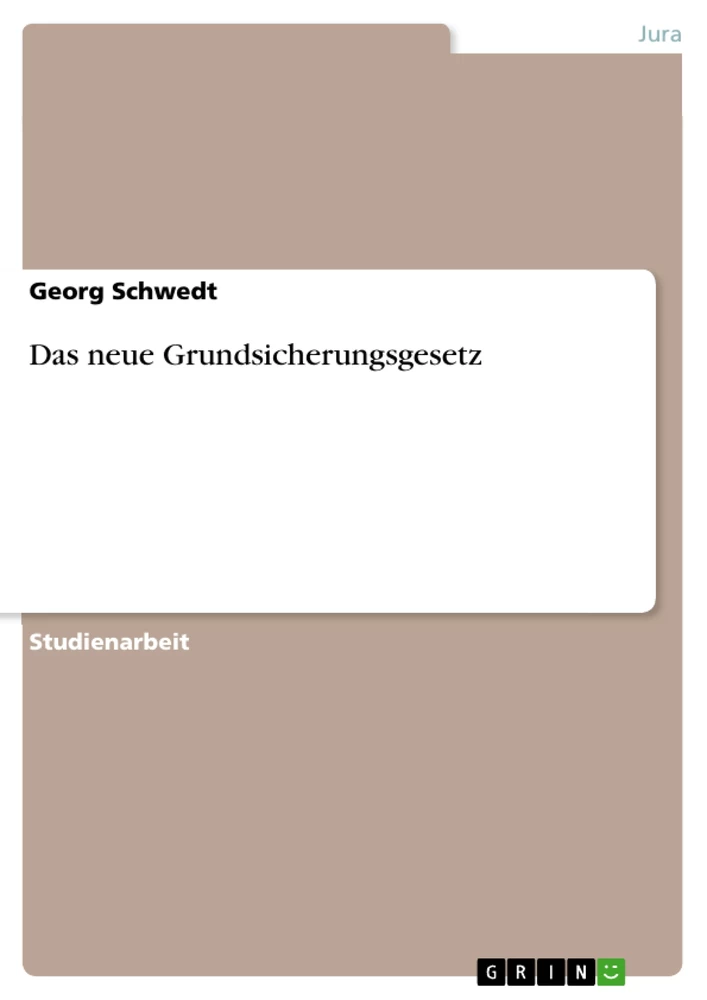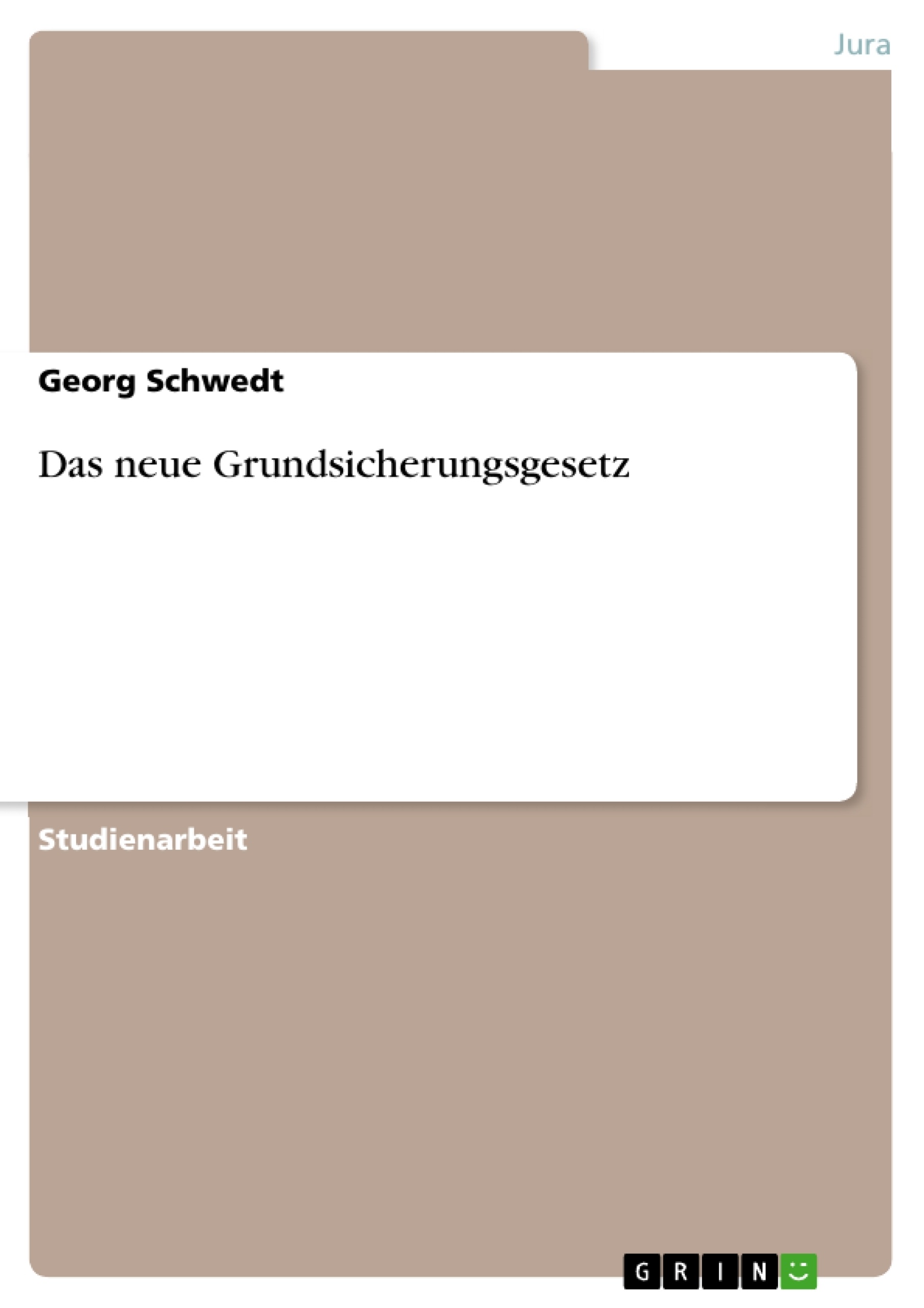Am 1.1. 2003 trat das Gesetz über eine steuerfinanzierte bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (GSiG), das auch kurz Grundsicherungsgesetz genannt wird, in Kraft.
Damit hat sich nach langjährige Debatte über das Für und Wider der Einführung einer beitragsunabhängigen und bedarfsbezogenen Grundsicherung im Gegensatz zum vorherrschenden System der leistungs- und beitragsbezogenen Sozialversicherung, eine erste Konkretisierung und Umsetzung der Debatte vollzogen.
In dieser Arbeit wird das neue Grundsicherungsgesetz in Grundzügen vorgestellt. Weiterhin wird eine Einordnung in die erwähnte Debatte vorgenommen und werden die wichtigsten Gründe für die Einführung des GSiG beleuchtet. Abschließend findet eine erste vorsichtige Einschätzung der zur erwartenden positiven Auswirkungen und Defizite statt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das neue Grundsicherungsgesetz
- Inhalt
- Wichtige Unterschiede zur vorherigen Regelung
- Grundsicherungskonzepte
- Allgemeine Grundsicherung
- Grundrente
- Basisrente
- Mindestrente
- Gründe für die Einführung des Grundsicherungsgesetzes
- Vorsichtige Einschätzung der Folgen des Grundsicherungsgesetzes
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit stellt das neue Grundsicherungsgesetz (GSiG) vor, ordnet es in die gesellschaftliche Debatte ein, beleuchtet die Gründe für seine Einführung und gibt eine erste Einschätzung der zu erwartenden Auswirkungen und Defizite.
- Vorstellung des GSiG und seiner wichtigsten Inhalte
- Vergleich des GSiG mit der vorherigen Sozialhilfe-Regelung
- Analyse verschiedener Grundsicherungskonzepte
- Diskussion der Gründe für die Einführung des GSiG
- Erste Einschätzung der positiven und negativen Folgen des GSiG
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt das neue Grundsicherungsgesetz (GSiG) ein, das am 1. Januar 2003 in Kraft trat und eine langjährige Debatte über bedarfsorientierte Grundsicherung abschließt. Die Arbeit beschreibt die Zielsetzung, das GSiG in Grundzügen vorzustellen, es in die Debatte einzuordnen, die Gründe für seine Einführung zu beleuchten und eine erste Einschätzung der zu erwartenden positiven Auswirkungen und Defizite zu geben.
Das neue Grundsicherungsgesetz: Dieses Kapitel beschreibt den Inhalt des GSiG, welches aus acht Paragraphen besteht. §1 definiert die Leistungsberechtigten (Personen über 65 oder voll erwerbsunfähig). §2 regelt den Leistungsanspruch, wobei das Einkommen des Ehepartners angerechnet wird, das von Eltern/Kindern jedoch nicht (bis 100.000 €). §3 legt die Höhe der Leistungen fest, basierend auf dem BSHG, zuzüglich einer Pauschale und Kosten für Unterkunft und Heizung. §4 benennt die Träger der Grundsicherung, §5 die Informations- und Prüfungspflichten der Rentenversicherungsträger. §6 legt den Bewilligungszeitraum fest, §7 die Zusammenarbeit zwischen Trägern, und §8 regelt Erhebungen zur Wirkung des Gesetzes. Der Vergleich mit der vorherigen Sozialhilfe-Regelung hebt die Unterschiede hervor, insbesondere die Nichtanrechnung von Vermögen von Kindern/Eltern unter 100.000€ jährlich, die Pauschalierung einmaliger Leistungen und die aktive Informationspflicht der Rentenversicherungsträger. Das GSiG löst Personen unter §1 GSiG aus dem Sozialhilfesystem, andere bleiben darin.
Grundsicherungskonzepte: Dieses Kapitel präsentiert fünf verschiedene Grundsicherungskonzepte nach Bäcker: die allgemeine Grundsicherung (Steuerfinanzierung, Bürgergeld), die Grundrente (auf Ältere beschränkt), die Basisrente (beitragsfinanziert, leistungsabhängig), und die Mindestrente (beitragsfinanziert, mit Auffüllung bei niedrigen Entgeltpunkten). Jedes Modell wird kurz beschrieben und seine grundlegenden Merkmale herausgestellt, ohne detailliert auf Vor- und Nachteile einzugehen.
Gründe für die Einführung des Grundsicherungsgesetzes: Dieses Kapitel würde die systematischen Widersprüche des alten Systems, die zunehmende Altersarmut, die verschämte Armut und den Wunsch nach administrativer Vereinfachung als Hauptgründe für die Einführung des GSiG diskutieren. Es würde belegen, warum diese Faktoren zu der Notwendigkeit einer Reform geführt haben und wie das GSiG diese Probleme angehen soll.
Vorsichtige Einschätzung der Folgen des Grundsicherungsgesetzes: Dieses Kapitel würde die positiven Auswirkungen und die Probleme und Defizite des GSiG diskutieren. Positive Aspekte könnten verbesserte soziale Sicherheit und vereinfachte Verfahren sein. Negative Aspekte könnten mögliche Lücken im Schutz bestimmter Bevölkerungsgruppen oder unvorhergesehene Folgen sein. Die verfassungsrechtliche Debatte um das GSiG würde hier ebenfalls kurz angesprochen werden.
Schlüsselwörter
Grundsicherungsgesetz (GSiG), Altersarmut, Erwerbsminderung, Sozialhilfe, Grundsicherungskonzepte, Beitragssystem, Steuerfinanzierung, Bedarfsorientierung, Rentenversicherung, Vermögensanrechnung.
FAQ: Das neue Grundsicherungsgesetz (GSiG)
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über das neue Grundsicherungsgesetz (GSiG). Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel, sowie Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Vorstellung des GSiG, dem Vergleich mit vorherigen Regelungen, der Analyse verschiedener Grundsicherungskonzepte und einer ersten Einschätzung der Auswirkungen.
Was sind die Hauptthemen des GSiG?
Das GSiG behandelt die Grundsicherung für ältere und erwerbsunfähige Menschen. Kernpunkte sind die Leistungsberechtigten, die Höhe der Leistungen (basierend auf dem BSHG), die Anrechnung von Einkommen und Vermögen, die Träger der Grundsicherung und die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Institutionen. Ein wichtiger Aspekt ist der Vergleich mit dem vorherigen Sozialhilfesystem.
Welche Grundsicherungskonzepte werden verglichen?
Das Dokument beschreibt und vergleicht verschiedene Grundsicherungskonzepte: die allgemeine Grundsicherung (steuerfinanziert), die Grundrente (auf Ältere beschränkt), die Basisrente (beitragsfinanziert, leistungsabhängig) und die Mindestrente (beitragsfinanziert, mit Auffüllung bei niedrigen Entgeltpunkten). Ein detaillierter Vergleich der Vor- und Nachteile findet jedoch nicht statt.
Warum wurde das GSiG eingeführt?
Die Einführung des GSiG wird mit systematischen Widersprüchen des alten Systems, zunehmender Altersarmut, verschämter Armut und dem Wunsch nach administrativer Vereinfachung begründet. Das Dokument erläutert, wie diese Faktoren zur Notwendigkeit einer Reform führten und wie das GSiG diese Probleme angehen soll.
Welche positiven und negativen Folgen werden erwartet?
Als positive Folgen werden verbesserte soziale Sicherheit und vereinfachte Verfahren genannt. Als potenzielle negative Folgen werden Lücken im Schutz bestimmter Bevölkerungsgruppen und unvorhergesehene Auswirkungen aufgeführt. Die verfassungsrechtliche Debatte um das GSiG wird ebenfalls kurz erwähnt.
Wer sind die Leistungsberechtigten nach §1 GSiG?
Nach §1 GSiG sind Personen über 65 Jahre oder voll erwerbsunfähige Personen leistungsberechtigt.
Wie wird das Einkommen und Vermögen angerechnet?
Das Einkommen des Ehepartners wird angerechnet. Das Einkommen von Kindern/Eltern wird bis zu einer Höhe von 100.000 € jährlich nicht angerechnet. Weitere Details zur Vermögensanrechnung sind im Dokument nicht explizit aufgeführt.
Wie hoch ist die Leistung?
Die Höhe der Leistungen basiert auf dem Bundessozialhilfegesetz (BSHG), zuzüglich einer Pauschale und Kosten für Unterkunft und Heizung.
Wer sind die Träger der Grundsicherung?
§4 des GSiG benennt die Träger der Grundsicherung, nähere Informationen dazu werden im Dokument jedoch nicht spezifiziert.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für das GSiG?
Schlüsselwörter umfassen: Grundsicherungsgesetz (GSiG), Altersarmut, Erwerbsminderung, Sozialhilfe, Grundsicherungskonzepte, Beitragssystem, Steuerfinanzierung, Bedarfsorientierung, Rentenversicherung und Vermögensanrechnung.
- Quote paper
- Georg Schwedt (Author), 2002, Das neue Grundsicherungsgesetz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/54536