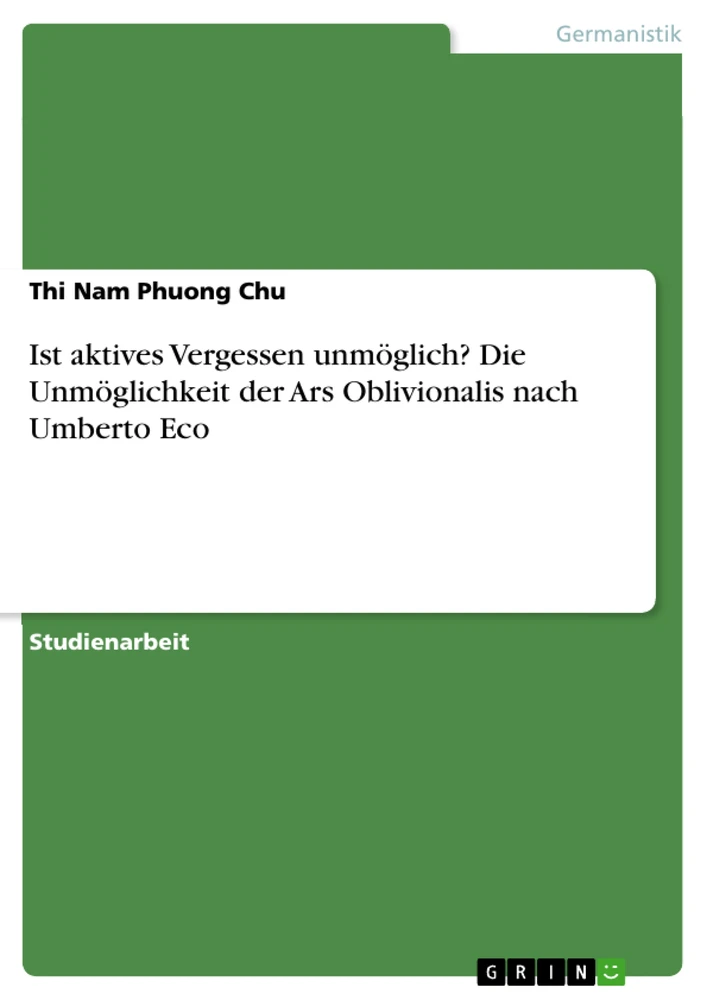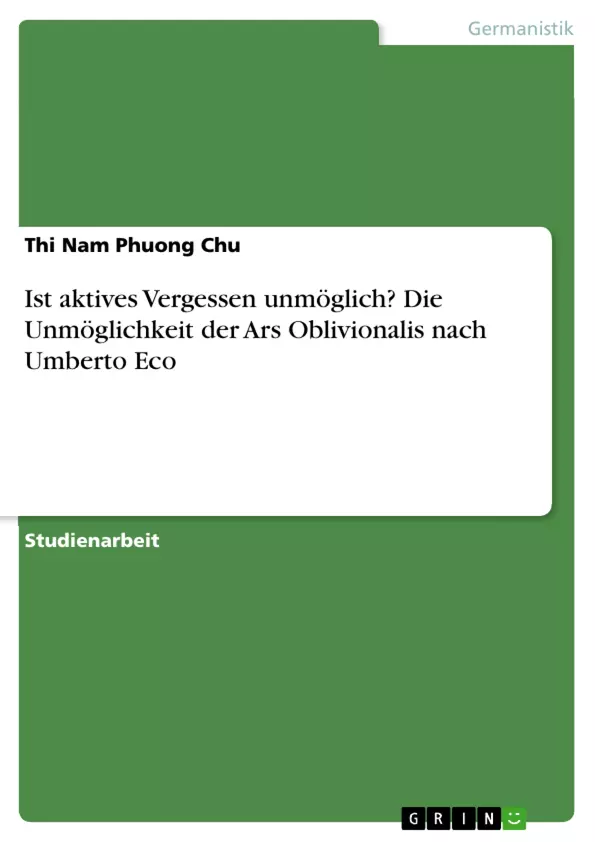"Vergiss es!" So sagen wir nicht selten im Alltagsleben. Seien wir ehrlich, haben wir alle Dinge, die lieber vergessen werden. Wir wollen das vergessen, was wir nicht mehr brauchen oder nicht mehr für richtig halten. Wir wollen unseren Kopf von traumatischen Erlebnissen, peinlichen Situationen und Demütigungen entlasten. Gibt es dann eine Technik, die das schnelle und aktive Vergessen ermöglicht? Die Antwort nach Umberto Eco 1988 in seinem Aufsatz "An ‚Ars Oblivionalis?‘ Forget it!" lautet „Nein!“. Der italienische Semiotiker meinte, das Vergessen aus Versehen ist möglich, während das aktive Vergessen und daher eine ars oblivionalis unausführbar bleibt. Wie lässt sich diese Schlussfolgerung begründen? Welche Ansätze für die Stützung seiner Argumente verfolgte Umberto Eco? Wie steht seine Behauptung im Zusammenhang mit anderen Ansichten zum Thema „Gedächtnis“ von dem Vergessen her?
Einher mit der Beantwortung der Forschungsfragen sollen nachfolgend zwei Thesen zur wissenschaftlichen Überprüfung abgeleitet werden: Mnemotechnik ist eine Semiotik und Semiotik dient sich als Vergegenwärtigungsmittel. Danach werden Ecos Vorschläge für das Erzeugen der Oblivion (des Vergessens oder der Vergesslichkeit) präsentiert. Abschließend wird die vorliegende Hausarbeit Bücher und Beiträge, die in den Rahmen der Debatte zum Thema „Gedächtnis“ gehören, unter die Lupe nehmen und sie miteinander sowie mit Ecos These vergleichen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Unmöglichkeit der ars oblivionalis
- Mnemotechnik als Semiotik
- Semiotik als Vergegenwärtigungsmittel
- Ecos Strategien für das gezielte Vergessen
- Gedächtnisverwirrung
- Steganographie
- Ergänzung
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Frage, ob eine "ars oblivionalis", eine Kunst des Vergessens, möglich ist, und analysiert die Argumente von Umberto Eco, der diese Möglichkeit verneint. Die Arbeit untersucht die semiotischen Grundlagen der Mnemotechnik und die Rolle der Semiotik als Vergegenwärtigungsmittel. Sie beleuchtet außerdem Ecos Strategien zur Erzeugung von Oblivion (Vergessen) und setzt diese in Beziehung zu anderen Ansichten zum Thema Gedächtnis.
- Die Unmöglichkeit einer "ars oblivionalis" nach Umberto Eco
- Die Semiotische Natur der Mnemotechnik und ihre Bedeutung für das Vergessen
- Ecos Ansätze zum gezielten Vergessen: Gedächtnisverwirrung und Steganographie
- Der Vergleich von Ecos These mit anderen Ansichten zum Thema Gedächtnis
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach der Möglichkeit einer "ars oblivionalis" und führt in Ecos These ein. Sie präsentiert außerdem die beiden Thesen, die im Folgenden untersucht werden: Mnemotechnik ist eine Semiotik und Semiotik dient als Vergegenwärtigungsmittel.
Das zweite Kapitel beleuchtet die Unmöglichkeit der ars oblivionalis nach Eco. Es erklärt, warum die Mnemotechnik als semiotisches System verstanden werden muss und wie diese semiotische Natur die Möglichkeit eines aktiven Vergessens verhindert.
Das dritte Kapitel präsentiert Ecos Strategien für das gezielte Vergessen. Es analysiert die Techniken der Gedächtnisverwirrung und der Steganographie und diskutiert deren Effizienz bei der Erzeugung von Oblivion.
Schlüsselwörter
Ars oblivionalis, Mnemotechnik, Semiotik, Vergessen, Erinnerung, Gedächtnis, Umberto Eco, Gedächtnisverwirrung, Steganographie, semiotisches Zeichen, Vergegenwärtigung.
- Citar trabajo
- Thi Nam Phuong Chu (Autor), 2020, Ist aktives Vergessen unmöglich? Die Unmöglichkeit der Ars Oblivionalis nach Umberto Eco, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/544577