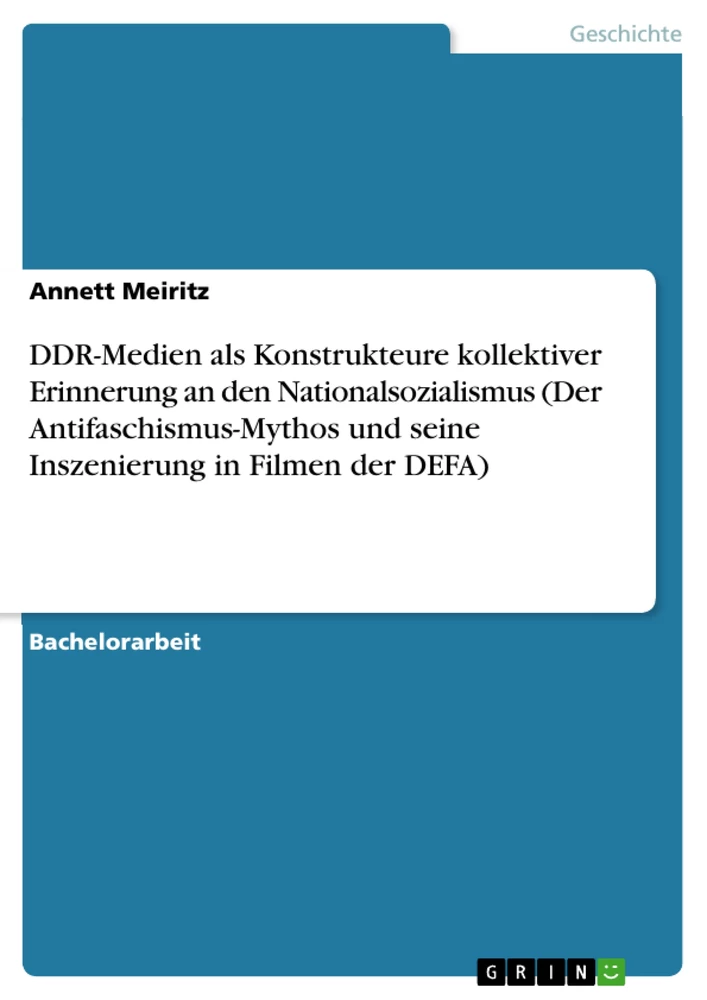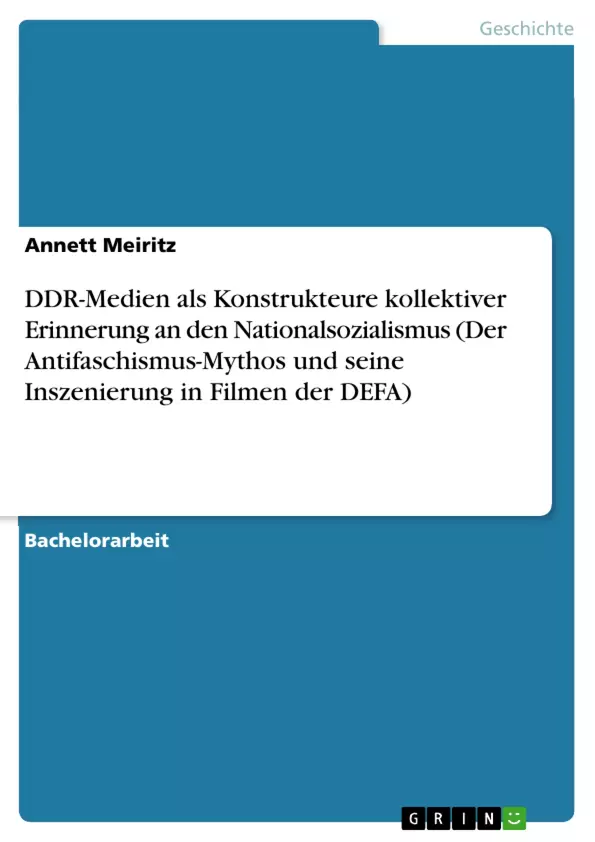„Jeder tiefere Kontinuitäts- und Traditionsbruch kann zur Entstehung von Vergangenheit führen, dann nämlich, wenn nach einem solchen Bruch ein Neuanfang versucht wird.“ Die Wahrnehmung von Vergangenheit ist keinesfalls naturwüchsig, Vergangenes kann nicht als etwas bedingungslos Gegebenes betrachtet werden. Denn nur die bloße Abfolge von Ereignissen sorgt längst nicht dafür, dass diese Episoden Berücksichtigung in Gegenwart und Zukunft finden. Dazu bedarf es aktiver Erinnerung, welche ausgewählte Geschehnisse mit Bedeutung ausstattet. Dies ist besonders dann notwendig, wenn die Vergangenheit herausragende Begebenheiten birgt – sowohl ruhmreichen als auch katastrophalen Charakters.
Mit den Folgen einer historischen Zäsur sah sich auch Deutschland nach Ende des Zweiten Weltkriegs konfrontiert. Alle politischen Konzepte der kommenden Jahrzehnte mussten vor dem Hintergrund der unlängst zu Fall gebrachten nationalsozialistischen Diktatur entwickelt werden. Dieser Weg gestaltete sich mühevoll: Es galt, im Ausland schrittweise Vertrauen und außenpolitische Anerkennung zurück zu gewinnen. Innerhalb der Grenzen war es auf Grund einer tiefen geistigen Verwurzelung der NS-Ideologie erforderlich, den Menschen andere moralische und kulturelle Werte zu vermitteln – die Identität einer ganzen Nation bedurfte eines neuen Fundaments. Dabei musste sorgfältig ausgewählt werden, welche Bestände der vergangenen Jahre auf welche Weise zum Einsatz kommen durften.
Denn im Prozess einer umfassenden gesellschaftlichen Neugestaltung nimmt der Rückgriff auf die Vergangenheit eine Schlüsselrolle ein: Die gemeinsame Fernbetrachtung ausgewählter Ereignisse stellt ein wichtiges Charakteristikum sozialer Gruppen dar. Deshalb widmet sich der erste Teil dieser Arbeit den Mechanismen kollektiven Erinnerns: Welche Merkmale kennzeichnen gemeinschaftlich geteilte Erinnerungen, und wie lässt sich das kollektive Gedächtnis strukturieren? Dazu werden zunächst Prinzipien des kollektiven Gedächtnisses umrissen, gestützt auf die Theorien von Maurice Halbwachs, Aleida Assmann und Jan Assmann. Im Mittelpunkt steht die Frage nach Faktoren, welche bewirken, dass bestimmte Aspekte der Vergangenheit gesellschaftliche Bedeutung erlangen.
Inhaltsverzeichnis
- Abgrenzung der Themenstellung
- 1. Das kollektive Gedächtnis: Wesen und Wirkung
- 1. 1 Kollektive Erinnerungen: Kategorien nach Halbwachs, Assmann und Assmann
- 1. 2 Kollektive Erinnerungen als Machtressource
- 1. 2. 1 Erinnern nach Einheitsgebot: Gedächtnisstruktur in der DDR
- 1. 2. 2 Mission Mythos: Die doppelte Legitimationsfunktion
- 1. 2. 3 Der Gründungsmythos als fundierende Erinnerungsfigur
- 2. Massenmedien: Mittel und Mittler im kollektiven Erinnerungsprozess
- 2. 1 Medien als Konservierungsstoffe kollektiver Erinnerungen
- 2. 1. 1 Audiovisuelle Medien in der DDR
- 2. 2 Entwicklung der DEFA: Inhalte und Produktionsbedingungen von DDR-Filmen
- 2. 2. 1 Beginn von Filmprojekten in der SBZ
- 2. 2. 2 Vom sozialistischen Aufbau bis zum „Kahlschlagplenum’
- 2. 2. 3 Filmbilder als Vermittler von Vergangenheit: Die Thälmann-Epen
- 2. 1 Medien als Konservierungsstoffe kollektiver Erinnerungen
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Gestaltung des kollektiven Gedächtnisses in der DDR am Beispiel der DEFA-Filmproduktion. Sie untersucht, wie Massenmedien, insbesondere der Film, zur Konstruktion einer antifaschistischen Erinnerungskultur im Ostdeutschland beitrugen und welche Rolle der Antifaschismus-Mythos im Einparteienstaat spielte.
- Die Funktionsweise des kollektiven Gedächtnisses und seine Strukturierung in der DDR
- Der Antifaschismus-Mythos als Staatsmythos und dessen Funktion in der DDR
- Die Rolle von Massenmedien im kollektiven Erinnerungsprozess
- Die DEFA als Instrument der staatlichen Erinnerungskultur
- Die Inszenierung des Antifaschismus in DEFA-Filmen, insbesondere am Beispiel der Thälmann-Epen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Abgrenzung der Themenstellung und einer Einführung in die Konzepte des kollektiven Gedächtnisses. Dabei werden die Theorien von Maurice Halbwachs, Aleida Assmann und Jan Assmann vorgestellt. Im Anschluss wird das Wesen des kollektiven Gedächtnisses in der DDR beleuchtet, insbesondere dessen Einbindung in die Staatsmacht und die Legitimationsfunktion des Antifaschismus-Mythos. Der zweite Teil der Arbeit beschäftigt sich mit der Rolle von Massenmedien im kollektiven Erinnerungsprozess, wobei der Schwerpunkt auf audiovisuellen Medien in der DDR liegt. Die Entwicklung der DEFA und ihre Produktionsbedingungen werden erläutert, sowie die Bedeutung von DEFA-Filmen als Vermittler von Vergangenheit, insbesondere am Beispiel der Thälmann-Epen.
Schlüsselwörter
Kollektives Gedächtnis, DDR, DEFA, Antifaschismus-Mythos, Erinnerungskultur, Massenmedien, Film, Thälmann-Epen, sozialistische Ideologie, Geschichtspolitik
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielte der Antifaschismus-Mythos in der DDR?
Der Antifaschismus diente als Gründungsmythos und zentrale Legitimationsquelle für den DDR-Staat, um sich moralisch vom Nationalsozialismus und der BRD abzugrenzen.
Wie konstruierten DDR-Medien das kollektive Gedächtnis?
Medien wie die DEFA inszenierten historische Ereignisse im Sinne der sozialistischen Ideologie, um eine einheitliche Erinnerungskultur zu schaffen.
Was sind die "Thälmann-Epen"?
Es handelt sich um monumentale DEFA-Filme über den KPD-Führer Ernst Thälmann, die als wichtiges Instrument zur Vermittlung des antifaschistischen Geschichtsbildes dienten.
Welche Theorien zum kollektiven Gedächtnis werden genutzt?
Die Arbeit stützt sich auf die Konzepte von Maurice Halbwachs sowie Jan und Aleida Assmann zur Strukturierung gemeinschaftlicher Erinnerungen.
Was war das "Kahlschlagplenum"?
Das 11. Plenum des ZK der SED im Jahr 1965 führte zu Verboten zahlreicher Filme und markierte einen Wendepunkt in der Produktionsfreiheit der DEFA.
Wie unterschied sich das Erinnern in der DDR vom Westen?
In der DDR war das Erinnern einem staatlichen "Einheitsgebot" unterworfen, das den Widerstand der Arbeiterklasse betonte und die Kontinuität des Faschismus im Westen behauptete.
- Citation du texte
- Annett Meiritz (Auteur), 2004, DDR-Medien als Konstrukteure kollektiver Erinnerung an den Nationalsozialismus (Der Antifaschismus-Mythos und seine Inszenierung in Filmen der DEFA), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/54454