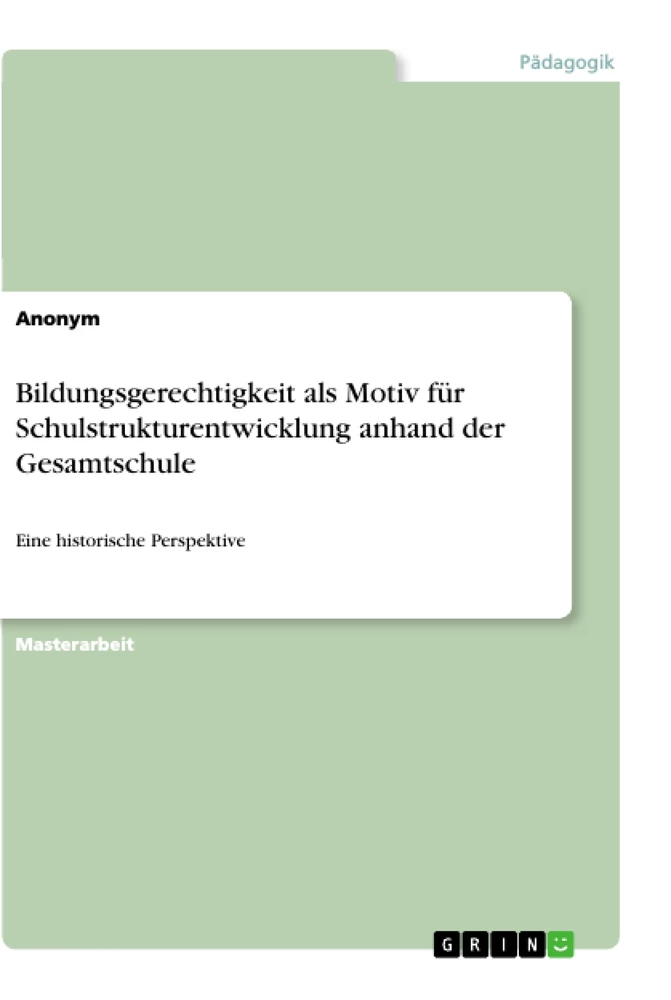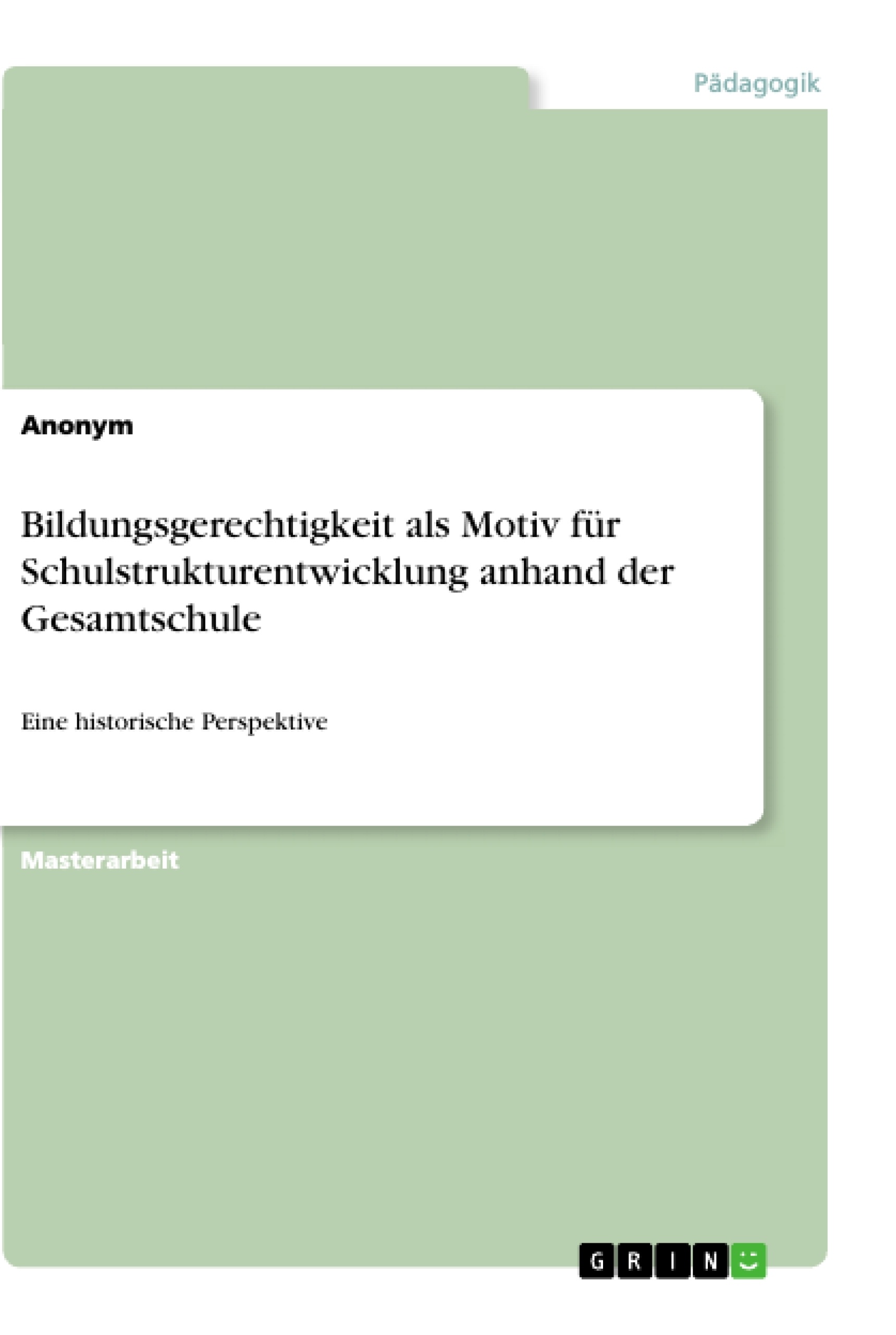Entwicklungen und Veränderungen, die die Gesellschaft und das Zusammenleben betreffen, stellen allgemein für die Menschheit und speziell für jeden einzelnen Menschen Prozesse dar, die sich als notwendig erweisen, also als zwingend, gleichsam aus der Not geboren. Ungeachtet, ob Erfolge oder Misserfolge, Wachstum oder Stagnation, Fortschritt oder Chaos ihre Wahrnehmung dominieren, laden sie zur bewussten Auseinandersetzung und rückblickenden Reflektion ein. Eine intensivere Betrachtung vermag zu hinterfragen, welche Prinzipien und Maximen Strukturen sozialer Mobilität erlauben, wenn nicht erfordern.
Schlömerkemper stellt in der Entwicklung der Menschheit die Einsicht und die Erkenntnis von Differenzen als zentrale Motive von Entwicklungen und Veränderungswünschen dar. Damit verbunden sei die Erkenntnis, dass Differenzen naturgegeben, aber auch veränderlich sein können, die Erkenntnis also, dass Differenzen einerseits zwischen Menschen in der Summe zu Vielfalt führen, andererseits unweigerlich hierarchische Strukturen zur Folge haben können (Schlömerkemper 2000). Somit bewegt sich der Begriff der Differenz mehr oder weniger zwischen den Polen der Bereicherung und des Makels. Diese Differenz spiegelt sich in und auf allen gesellschaftlichen Ebenen wider. Denn es unterliegen Begriffe wie jener der Differenz stets einem instrumentellen Charakter und können sogar im Kontext von gesellschaftlichen Prozessen als Motive und Erklärungsmodelle erachtet werden (Elias 1991 zit. in Keiner 1998: 41). Somit ist der Befund von Differenz auch im schulischen Kontext eine nicht unerhebliche Herausforderung an das deutsche Bildungswesen (Trautmann & Wischer 2011). Baumert (2002) zog mit Blick auf die PISA-Ergebnisse (2000) folgendes Resümee:
In der Verbesserung des Umgang mit Differenz liegt vermutlich die eigentliche Herausforderung der Modernisierung des Systems (Baumert 2002 zit. in Trautmann & Wischer 2011).
Dass die Thematik der Differenz, die bewusst nicht als Problem bezeichnet wird, im schulischen Kontext kein Neuland darstellt, steht vermutlich nicht zur Debatte (Trautmann & Wischer 2011). Vielmehr überwiegen kritische Fragen und Anregungen die Diskussion, weshalb sich der Umgang mit der Differenz, die heute überwiegend dem Begriff der Heterogenität gleichgesetzt wird (ebd.), als immer noch recht schwierig gestaltet (ebd.).
Inhaltsverzeichnis
- EINFÜHRUNG
- ,,DIFFERENZ\": GRUND ODER LÖSUNG ALL UNSERER PROBLEME?
- GANG DER DARSTELLUNG
- AUS DER GESCHICHTE DER BILDUNGSUNGLEICHHEIT LERNEN?
- BILDUNGSGERECHTIGKEIT
- IDEOLOGIEANFÄLLIGKEIT DER BEGRÜNDUNGEN VON GERECHTIGKEIT UND IHRER NEGATION
- ANTHROPOLOGISCHE,,VERWISSENSCHAFTLICHUNG“ VON DIFFERENZ
- ABLÖSUNG ANTHROPOLOGISIERENDER APOLOGIE DURCH,,BLINDE MECHANISMEN“
- ,,BILDUNGSGERECHTIGKEIT“ ALS „UMKÄMPFTER BEGRIFF“ ODER „, FUZZY CONCEPT“
- ZWISCHENFAZIT: ERFORDERNIS MULTIPERSPEKTIVISCHER BETRACHTUNG
- BILDUNGSGERECHTIGKEIT ALS CHANCENGLEICHHEIT
- CHANCENGLEICHHEIT ALS START- ODER ZIELCHANCENGLEICHHEIT
- GRUNDKOMPETENZEN ALS CHANCENGLEICHHEIT
- AUSDIFFERENZIERUNG DER CHANCENGLEICHHEIT
- LEISTUNGSPRINZIP IM KONTEXT DER CHANCENGLEICHHEIT
- FAMILIÄRE UNABDINGBARKEIT IM KONTEXT DER CHANCENGLEICHHEIT
- BEGABUNGSGERECHTIGKEIT IM KONTEXT DER CHANCENGLEICHHEIT
- VERTEILUNGSGERECHTIGKEIT IM KONTEXT CHANCENGLEICHHEIT
- ZWISCHENFAZIT
- BILDUNGSGERECHTIGKEIT ALS ANERKENNUNGSTHEORIE
- ANERKENNUNGSTHEORIE DURCH INTERPERSONELLE WAHRNEHMUNG
- ZWISCHENFAZIT
- BILDUNGSGERECHTIGKEIT ALS CHANCENGERECHTIGKEIT
- PRIMÄRE UND SEKUNDÄRE HERKUNFTSEFFEKTE NACH BOUDON
- DER MATTHÄUS- EFFEKT
- BEDEUTUNGSDIFFERENZ ZWISCHEN CHANCENGERECHTIGKEIT UND CHANCENGLEICHHEIT
- ZWISCHENFAZIT
- GERECHTIGKEITSBEGRIFFE IM VORLIEGENDEN HISTORISCHEN KONTEXT
- Historisches Verständnis der Bildungsgerechtigkeit
- Entwicklung des Schulsystems in der Bundesrepublik Deutschland
- Einführung der Gesamtschule und ihre Auswirkungen auf Bildungsgerechtigkeit
- Chancengleichheit und Chancengerechtigkeit als zentrale Konzepte
- Empirische Befunde und kritische Reflexion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit befasst sich mit der Entwicklung von Schulstrukturen in der Bundesrepublik Deutschland nach 1945, wobei der Fokus auf der Thematik der Bildungsgerechtigkeit liegt. Im Zentrum steht die Frage, inwiefern die Einführung der Gesamtschule als ein Instrument zur Erreichung von Bildungsgerechtigkeit verstanden werden kann.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer umfassenden Analyse des Begriffs der Bildungsgerechtigkeit. In diesem Kontext werden verschiedene Interpretationsansätze und theoretische Perspektiven beleuchtet, um die Komplexität des Themas aufzuzeigen. Im Anschluss wird die Entwicklung des Schulsystems in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg beleuchtet, wobei die Reorganisation des dreigliedrigen Schulsystems sowie die Reformphasen der 1960er Jahre im Fokus stehen. Die Arbeit widmet sich anschließend der Bildungspoltischen und Schulpädagogischen Diskussion um die Einführung der Gesamtschule. Dabei werden die Zielvorstellungen des Deutschen Bildungsrates und die empirischen Befunde der Begleitstudien analysiert.
Schlüsselwörter
Bildungsgerechtigkeit, Gesamtschule, Chancengleichheit, Chancengerechtigkeit, Schulstrukturentwicklung, Schulsystem, Bundesrepublik Deutschland, Historische Perspektive, Empirische Forschung, Bildungspolitik.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Bildungsgerechtigkeit?
Es beschreibt das Ideal, dass jeder Mensch unabhängig von seiner sozialen Herkunft die gleichen Chancen auf Bildung und den Erwerb von Kompetenzen haben sollte.
Welche Rolle spielt die Gesamtschule für die Bildungsgerechtigkeit?
Die Gesamtschule wurde eingeführt, um das dreigliedrige Schulsystem zu überwinden, soziale Selektion zu verringern und längeres gemeinsames Lernen zu ermöglichen.
Was ist der „Matthäus-Effekt“ im Bildungswesen?
Er beschreibt das Phänomen „Wer hat, dem wird gegeben“: Kinder aus bildungsnahen Schichten profitieren oft mehr von schulischen Angeboten als Kinder aus bildungsfernen Schichten.
Was sind primäre und sekundäre Herkunftseffekte?
Primäre Effekte sind leistungsbedingt durch das Elternhaus; sekundäre Effekte sind bewusste Bildungsentscheidungen der Eltern (z.B. Wahl des Gymnasiums trotz gleicher Leistung).
Warum ist Heterogenität eine Herausforderung für Schulen?
Unterschiedliche Voraussetzungen der Schüler erfordern individuelle Förderung, was in starren Schulstrukturen oft schwer umzusetzen ist und neue pädagogische Konzepte verlangt.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2019, Bildungsgerechtigkeit als Motiv für Schulstrukturentwicklung anhand der Gesamtschule, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/542390