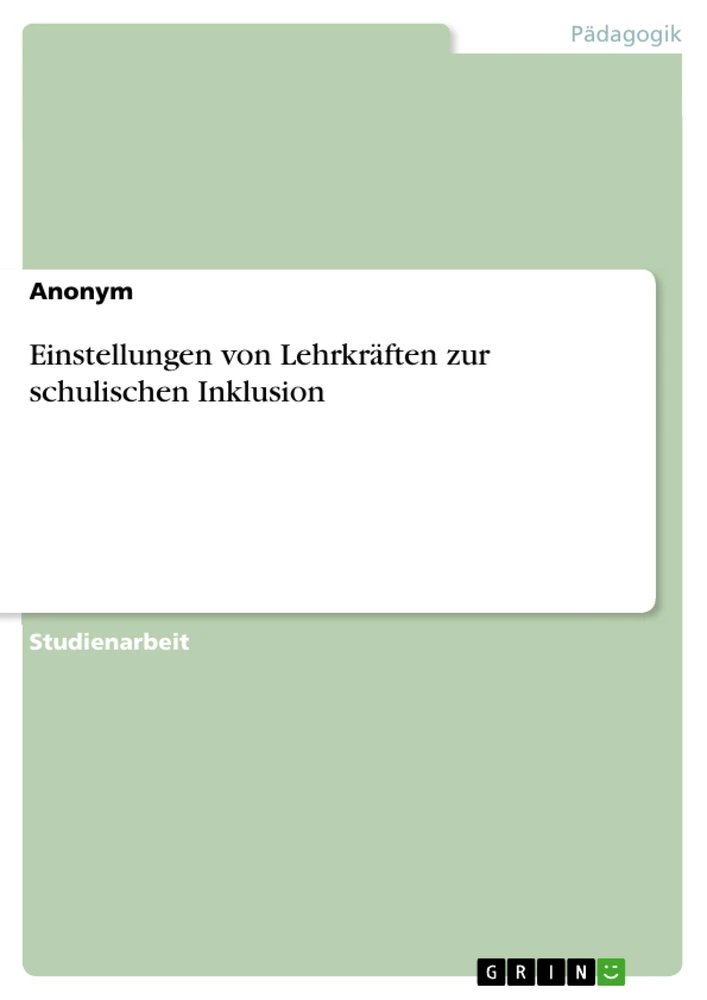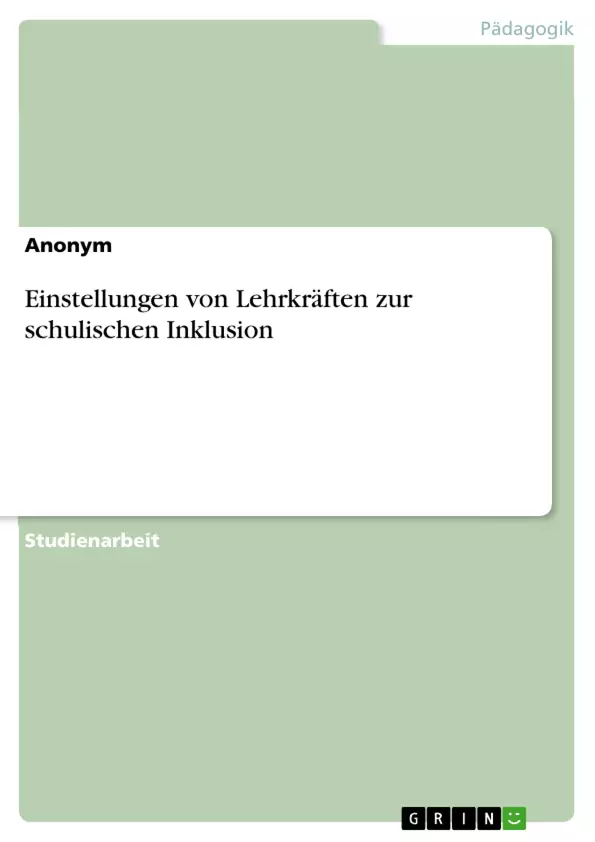In dieser Feldstudie wurden an einem inklusiven Gymnasium 23 Lehrkräfte hinsichtlich ihrer persönlichen Haltung zum Thema Inklusion von zieldifferenten und zielgleichen Schülerinnen und Schüler befragt und die Ergebnisse in Beziehung zur österreichischen Längsschnittstudie "EIS" aus den Jahren 1988,1998 und 2009 gesetzt.
Auf jeder Universität, in den meisten Schulen sowie unter den angehenden Lehrerinnen und Lehrern bietet das Wort "Inklusion" Grundlage für Diskussionen. Das Programm, welches sich hinter dem Begriff verbirgt, ist nicht neu. Die Forschung zu den Chancen und Möglichkeiten eines inklusiven Unterrichts begann in Deutschland schon Mitte der 1970er Jahre.
2013 fand in Leipzig bereits die 27. Jahrestagung der Integrations- / InklusionsforscherInnen aus deutschsprachigen Ländern statt. Doch seit der Unterzeichnung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) am 30. März 2007 von einem Großteil der EU-Mitgliedsstaaten ist das Thema in die Öffentlichkeit gelangt und hat eine bildungspolitische Debatte angestoßen. Von Deutschland wurde die UN-BRK im März 2009 ratifiziert.
In den UN-BRK werden keine eigenständigen Sonderrechte für Menschen mit Behinderungen festgeschrieben, sondern die allgemeinen Menschenrechte mit Blick auf Bildung, Partizipation oder Selbstbestimmung auf Menschen mit Behinderungen übertragen. Analog dazu wird in den UN-BRK Artikel 24 eine Integration von Menschen mit Behinderungen in das Schulsystem gefordert, welches ursprünglich für die sogenannten Regelschüler* konzipiert wurde.
Diese Formulierungen bergen aber auch gewisse Risiken. Demnach wird der Begriff der Inklusion häufig als Auflösung der Sonderschulen verstanden und allein auf Kinder mit Behinderungen eingeschränkt. Dass dies nicht der Fall sein soll, macht die UNESCO in ihren Richtlinien für Inklusion deutlich: "Inclusion is about the presence, participation an achievement of all students. […] Inclusion involves a particular emphasis on those groups of learners who may be at risk of marginalization, exclusion or underachievement".
Inhaltsverzeichnis
- Theorie
- Inklusion
- Die Einstellungs-Verhaltens-Relation
- Einstellung
- Die Beziehung von Einstellung und Verhalten
- Methodischer Teil
- Ergebnisse
- Zusammenfassung
- Reflexion des Forschungsprojektes
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den Einstellungen von Lehrkräften zur schulischen Inklusion und untersucht die Beziehung zwischen Einstellungen und tatsächlichem Verhalten.
- Das Konzept der Inklusion und seine Bedeutung im Bildungssystem
- Die Rolle von Einstellungen im Zusammenhang mit Inklusion
- Die Beziehung zwischen Einstellungen und Verhalten von Lehrkräften
- Die Herausforderungen und Chancen der Inklusion in der Praxis
- Die Bedeutung von Lehrerhaltung für den Erfolg von Inklusion
Zusammenfassung der Kapitel
- Theorie: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Inklusion und stellt verschiedene Perspektiven auf dieses Konzept vor. Es werden die Unterschiedlichkeiten zu den Begriffen Integration und Separation erläutert. Außerdem wird die Bedeutung der Einstellungen von Lehrkräften für die erfolgreiche Implementierung von Inklusion betont.
- Die Einstellungs-Verhaltens-Relation: In diesem Kapitel wird der Begriff der Einstellung näher beleuchtet. Es werden unterschiedliche Definitionen von Einstellung dargestellt und ihre Funktionen im Hinblick auf menschliches Verhalten erläutert. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem mehrdimensionalen Konzept der Einstellung.
Schlüsselwörter
Inklusion, Einstellung, Verhalten, Lehrkraft, Bildungssystem, Integration, Separation, Inklusionsforschung, Einstellungen-Verhaltens-Relation, UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK), UNESCO, Bildungspolitik.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielen Lehrerhaltungen für die Inklusion?
Die persönliche Einstellung der Lehrkräfte gilt als entscheidender Erfolgsfaktor. Eine positive Haltung begünstigt die Umsetzung inklusiver Maßnahmen im Unterricht erheblich.
Was besagt die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK)?
Die UN-BRK fordert ein inklusives Bildungssystem auf allen Ebenen, in dem Menschen mit Behinderungen gleichberechtigten Zugang zu hochwertiger Bildung haben.
Was ist der Unterschied zwischen zieldifferentem und zielgleichem Lernen?
Zielgleich bedeutet, dass alle Schüler denselben Abschluss anstreben. Zieldifferent bedeutet, dass Schüler nach individuellen Lehrplänen gefördert werden, die von den Standardzielen abweichen.
Was bedeutet „Einstellungs-Verhaltens-Relation“?
Dieser Begriff aus der Psychologie untersucht, inwiefern die innere Einstellung einer Person (z.B. zur Inklusion) tatsächlich ihr äußeres Handeln im Schulalltag bestimmt.
Wie definiert die UNESCO Inklusion?
Inklusion bezieht sich laut UNESCO auf die Anwesenheit, Partizipation und den Erfolg aller Schüler, mit besonderem Fokus auf Gruppen, die von Ausgrenzung bedroht sind.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2015, Einstellungen von Lehrkräften zur schulischen Inklusion, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/540239