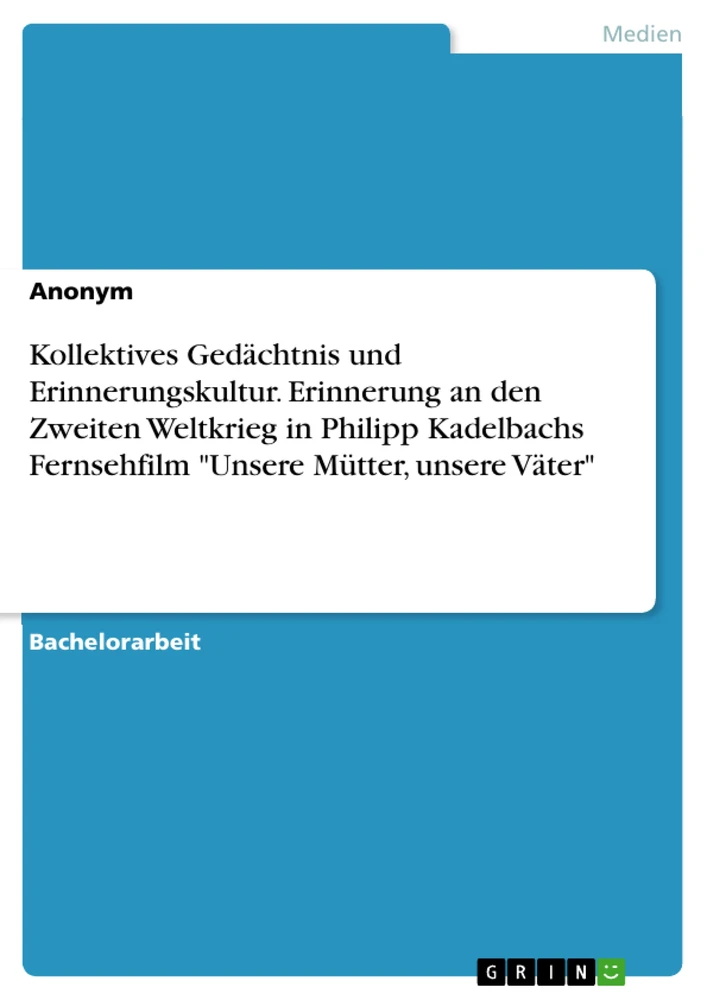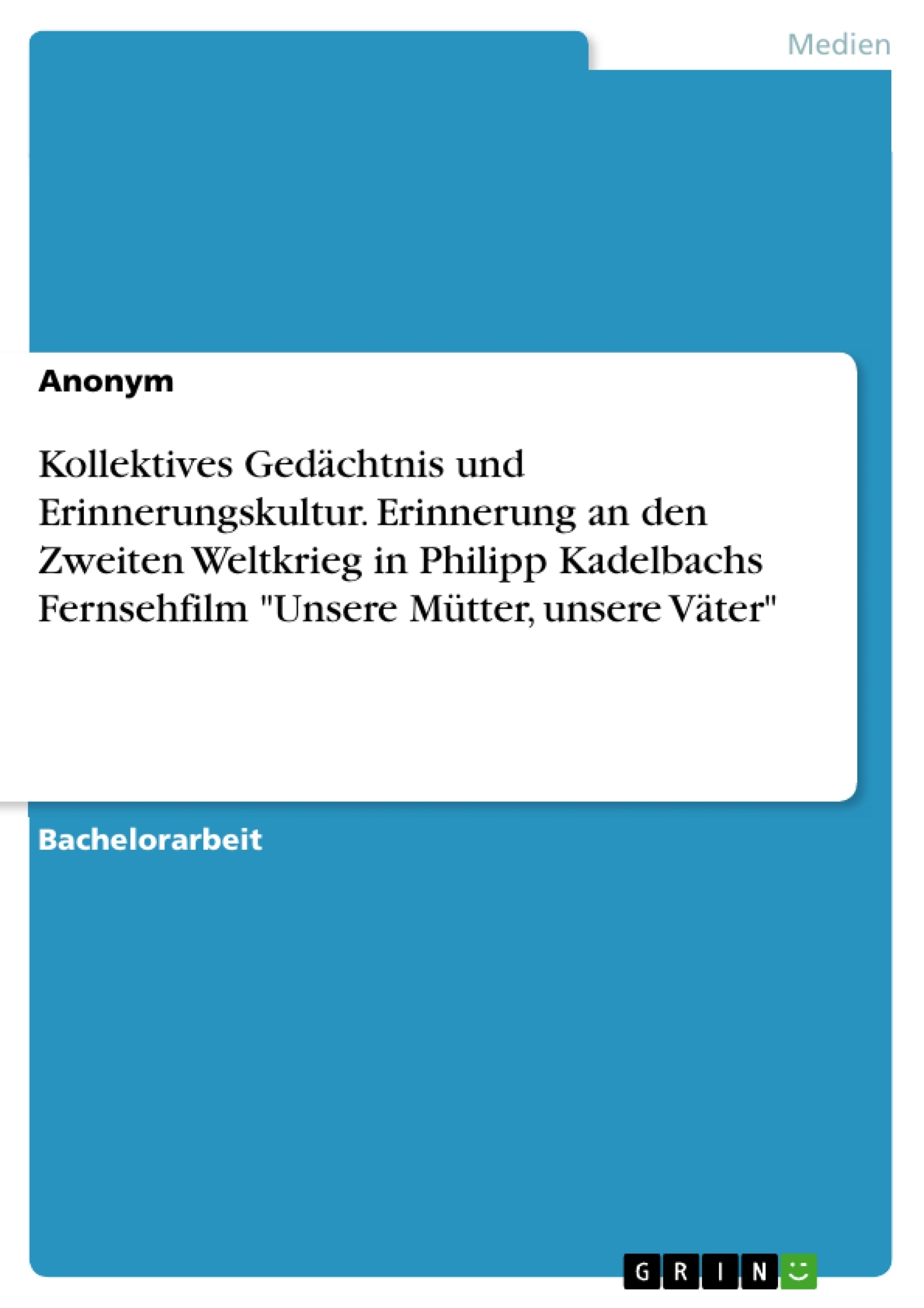Inhalt dieser Arbeit ist eine Auseinandersetzung mit dem deutschen dreiteiligen Fernsehfilm "Unsere Mütter, unsere Väter" von Regisseur Philipp Kadelbach aus dem Jahr 2013. Unter Berücksichtigung gängiger Theorien aus dem Forschungsfeld kollektive Gedächtnisse und Erinnerungskultur soll untersucht werden, inwiefern der Film kollektive Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg schafft.
Um einen theoretischen Rahmen und eine Grundlange für die Betrachtung des Films zu schaffen, werden zunächst ausgewählte Theorien aus dem genannten Forschungsbereich vorgestellt. Grundlegend sind dabei die Schriften zu mémoire collective und cadres sociaux von Maurice Halbwachs, die Untersuchungen zum kollektiven Gedächtnis von Aleida und Jan Assmann sowie die Dimensionen der Erinnerungskultur nach Astrid Erll. Während die Theorien von Halbwachs, Assmann und Erll den theoretischen Rahmen spannen, werden mit Aleida Assmanns eingeführten Überlegungen zu neuen Grundbegriffen des kollektiven Gedächtnisses die Perspektiven der Sieger und Verlierer sowie die der Opfer und Täter auf die Geschichte und die Bedeutung von Trauma und Vergangenheitsbewältigung näher betrachtet.
Im Mittelpunkt der Arbeit steht die ausführliche Filmanalyse der drei Teile von "Unsere Mütter, unsere Väter". Zum einen werden die Figuren und ihre Entwicklung analysiert, da die Veränderungen, die sie durchleben, ein zentrales Motiv des Films ist. Zum anderen wird nachfolgend die Darstellung von Nationalsozialismus, Holocaust und Antisemitismus, der Partisanen, der Opfer- und Täterrolle und des Nachkriegsdeutschlands genauer untersucht und interpretiert. Zusätzlich zu den inhaltlichen Motiven des Films wird kurz ausgeführt, welche Bedeutung Titel und stilistische Mittel haben. In der abschließenden Bemerkung werden noch einmal zentrale Gedanken aus der vorangestellten Analyse aufgegriffen.
Ziel der Arbeit ist es, sich mit der Frage zu beschäftigen, ob die Darstellung des Zweiten Weltkriegs, wie sie in Unsere Mütter, unsere Väter zu sehen ist, Einzug in das kollektive Gedächtnis der Deutschen halten sollte und damit nachwachsenden Generationen als verbindliches Bild damaliger Ereignisse dienen kann. Es wird unter anderem herausgestellt, dass Täter- und Opferrollen im Film unverhältnismäßig dargestellt sind und der Titel durch die Ansprache des Kollektivs dem Film einen zu hohen Stellenwert beimisst.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theorien zum kollektiven Gedächtnis und Erinnerungskultur
- 2.1. Das kollektive Gedächtnis nach Maurice Halbwachs: Mémoire collective und cadres sociaux
- 2.2. Das zweigeteilte kollektive Gedächtnis nach Aleida und Jan Assmann
- 2.2.1. Kommunikatives Kurzzeitgedächtnis und kulturelles Langzeitgedächtnis
- 2.2.2. Das kulturelle Gedächtnis
- 2.2.3. Gedächtnis als ars und vis, Funktionsgedächtnis und Speichergedächtnis
- 2.2.4. Grundbegriffe des individuellen und kollektiven Gedächtnisses
- 2.2.4.1. Sieger und Verlierer
- 2.2.4.2. Opfer- und Tätergedächtnis
- 2.2.4.3. Bedeutung von Trauma und Vergangenheitsbewältigung
- 2.3. Dimensionen der Erinnerungskultur nach Astrid Erll
- 3. Filmanalyse Unsere Mütter, unsere Väter
- 3.1. Inhaltsangabe
- 3.2. Figurenanalyse
- 3.2.1. Viktor vom Opfer zum Widerstandskämpfer
- 3.2.2. Greta - vom gefeierten Schlagerstar zur Defätistin
- 3.2.3. Charlotte - von der leichtgläubigen Patriotin zur entschlossenen Krankenschwester
- 3.2.4. Friedhelm und Wilhelm
- 3.2.4.1. Friedhelm – vom Pazifisten zum Kriegsverbrecher
- 3.2.4.2. Wilhelm - vom kriegserfahrenen Oberleutnant zum Deserteur
- 3.3. Analyse von Motiven, Titeln und stilistischen Mitteln
- 3.3.1. Darstellung des Nationalsozialismus
- 3.3.2. Darstellung des Holocaust und Antisemitismus
- 3.3.3. Darstellung der Partisanen
- 3.3.4. Darstellung Nachkriegsdeutschland
- 3.3.5. Täter-Opfer-Darstellung
- 3.3.6. Titel und Untertitel
- 3.3.7. Stilistische Mittel: Bild, Montage und Erzähler
- 3.4. Schlussbemerkungen zur Analyse: Mit fiktiver Geschichte zur kollektiven Erinnerung
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht, wie der Fernsehfilm „Unsere Mütter, unsere Väter“ (2013) kollektive Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg konstruiert. Der Film wird anhand von Theorien des kollektiven Gedächtnisses (Halbwachs, Assmann) und der Erinnerungskultur (Erll) analysiert. Die Arbeit fragt, ob die filmische Darstellung im kollektiven Gedächtnis der Deutschen verankert werden sollte und als verbindliches Bild für nachfolgende Generationen dienen kann.
- Konstruktion kollektiver Erinnerung im Film „Unsere Mütter, unsere Väter“
- Analyse der Figuren und ihrer Entwicklung im Kontext des Zweiten Weltkriegs
- Darstellung von Nationalsozialismus, Holocaust, und Antisemitismus im Film
- Die Rolle von Täter- und Opferschaft im Film
- Die Bedeutung von stilistischen Mitteln für die Konstruktion kollektiver Erinnerung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Gegenstand der Arbeit: die Analyse des Fernsehfilms „Unsere Mütter, unsere Väter“ im Hinblick auf seine Konstruktion kollektiver Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg. Sie skizziert die methodische Vorgehensweise, die auf ausgewählten Theorien zum kollektiven Gedächtnis und der Erinnerungskultur basiert, und benennt die Forschungsfrage, ob die filmische Darstellung als verbindliches Bild für nachfolgende Generationen dienen kann.
2. Theorien zum kollektiven Gedächtnis und Erinnerungskultur: Dieses Kapitel stellt relevante Theorien zum kollektiven Gedächtnis und zur Erinnerungskultur vor, insbesondere die Konzepte von Maurice Halbwachs (Mémoire collective und cadres sociaux), Aleida und Jan Assmann (kommunikatives Kurzzeitgedächtnis, kulturelles Langzeitgedächtnis), und Astrid Erll (Dimensionen der Erinnerungskultur). Es werden die Konzepte von "Sieger- und Verlierergedächtnis" sowie "Opfer- und Tätergedächtnis" im Detail erläutert und deren Relevanz für die spätere Filmanalyse herausgestellt. Der Fokus liegt auf dem wechselseitigen Verhältnis von individuellem und kollektivem Gedächtnis und der Rolle sozialer Rahmenbedingungen für die Erinnerung.
Schlüsselwörter
Kollektives Gedächtnis, Erinnerungskultur, Zweiter Weltkrieg, Unsere Mütter, unsere Väter, Philipp Kadelbach, Filmanalyse, Maurice Halbwachs, Aleida Assmann, Jan Assmann, Astrid Erll, Täter, Opfer, Nationalsozialismus, Holocaust, Antisemitismus, Nachkriegsdeutschland.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse des Fernsehfilms "Unsere Mütter, unsere Väter"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Bachelorarbeit analysiert den Fernsehfilm „Unsere Mütter, unsere Väter“ (2013) im Hinblick auf seine Konstruktion kollektiver Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg. Die Arbeit untersucht, ob die filmische Darstellung im kollektiven Gedächtnis der Deutschen verankert werden sollte und als verbindliches Bild für nachfolgende Generationen dienen kann.
Welche Theorien werden verwendet?
Die Analyse basiert auf Theorien des kollektiven Gedächtnisses von Maurice Halbwachs (Mémoire collective und cadres sociaux), Aleida und Jan Assmann (kommunikatives Kurzzeitgedächtnis, kulturelles Langzeitgedächtnis) und der Erinnerungskultur von Astrid Erll. Die Konzepte von „Sieger- und Verlierergedächtnis“ sowie „Opfer- und Tätergedächtnis“ spielen eine zentrale Rolle.
Welche Aspekte des Films werden analysiert?
Die Arbeit analysiert verschiedene Aspekte des Films, darunter die Inhaltsangabe, die Figurenanalyse (Viktor, Greta, Charlotte, Friedhelm, Wilhelm), die Darstellung von Nationalsozialismus, Holocaust, Antisemitismus und Nachkriegsdeutschland, die Täter-Opfer-Darstellung, die stilistischen Mittel (Bild, Montage, Erzähler) und die Bedeutung von Titel und Untertitel.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu relevanten Theorien des kollektiven Gedächtnisses und der Erinnerungskultur, eine detaillierte Filmanalyse von „Unsere Mütter, unsere Väter“ und ein Fazit. Das Inhaltsverzeichnis bietet einen umfassenden Überblick über die einzelnen Kapitel und Unterkapitel.
Welche Forschungsfrage wird gestellt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Kann die filmische Darstellung in „Unsere Mütter, unsere Väter“ als verbindliches Bild für nachfolgende Generationen im kollektiven Gedächtnis dienen?
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Kollektives Gedächtnis, Erinnerungskultur, Zweiter Weltkrieg, Unsere Mütter, unsere Väter, Philipp Kadelbach, Filmanalyse, Maurice Halbwachs, Aleida Assmann, Jan Assmann, Astrid Erll, Täter, Opfer, Nationalsozialismus, Holocaust, Antisemitismus, Nachkriegsdeutschland.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, zu untersuchen, wie der Film „Unsere Mütter, unsere Väter“ kollektive Erinnerung konstruiert und welche Rolle er im kollektiven Gedächtnis zukünftiger Generationen spielen könnte.
Wie wird die Filmanalyse durchgeführt?
Die Filmanalyse untersucht die Figuren und deren Entwicklung im Kontext des Zweiten Weltkriegs, die Darstellung von Nationalsozialismus, Holocaust und Antisemitismus, die Rolle von Tätern und Opfern und die Bedeutung stilistischer Mittel für die Konstruktion kollektiver Erinnerung.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2019, Kollektives Gedächtnis und Erinnerungskultur. Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg in Philipp Kadelbachs Fernsehfilm "Unsere Mütter, unsere Väter", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/538855