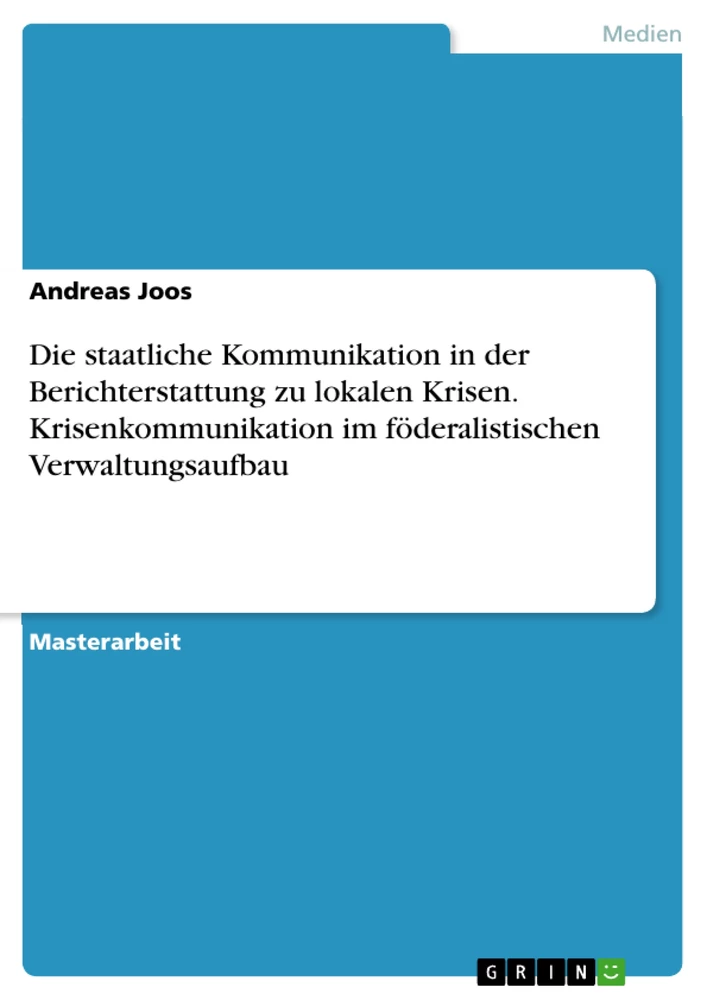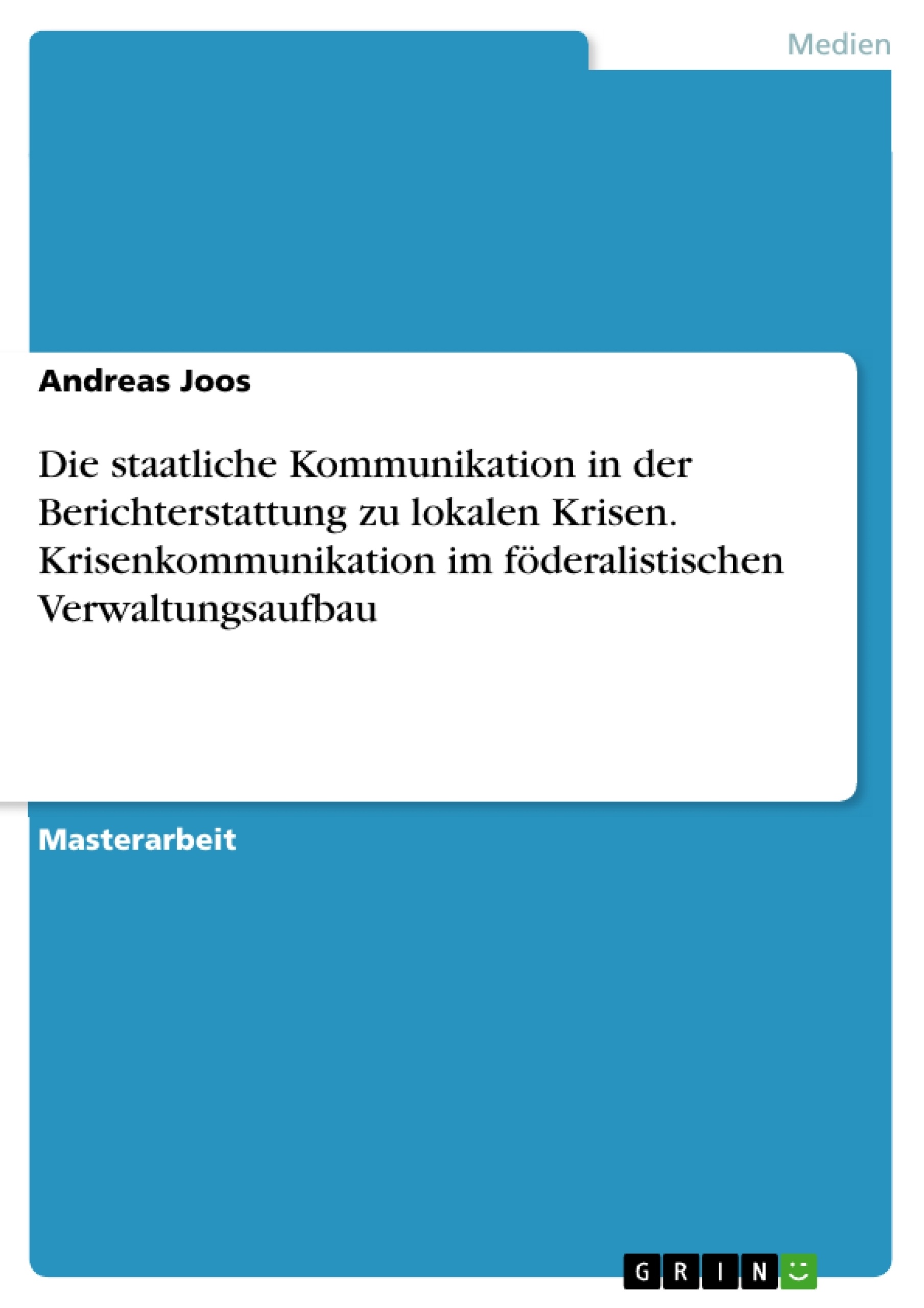Die Arbeit strebt an, die bislang wenig erforschte Krisenkommunikation im föderalen Verwaltungsaufbau zu untersuchen und den Blick auf lokale Krisen zu richten.
Hierbei wir die Berichterstattung zu vier ausgewählten Krisen im Bundesland Baden-Württemberg verglichen. Ziel ist es, krisenübergreifende Schemata staatlicher Krisenkommunikation herauszuarbeiten und gleichsam Unterschiede abzubilden.
Neben der Themen- und Akteursstruktur sollen insbesondere narrative, relationale und strategische Aspekte sowie die journalistische Kontextualisierung erfasst werden, um die Krisenkommunikation bestmöglich in ihrer Prozesshaftigkeit abzubilden.
Bevor die Krisenkommunikation empirisch untersucht wird, werden Rahmenbedingungen skizziert, welche die Krise erst zu einem universalen und überaus relevanten Phänomen für die Public Relations und die politische Kommunikation werden lassen.
Daran anschließend wird der sozialwissenschaftliche Forschungsstand dargelegt und die Krise aus kommunikationswissenschaftlicher Theorie-Perspektive beleuchtet. Die aus diesem Theorieteil abgeleiteten Ergebnisse bilden die Grundlage für die zentralen Forschungsannahmen und die Operationalisierung der Inhaltsanalyse. Des Weiteren sind die Besonderheiten staatlicher Krisenkommunikation hierfür unabdingbar.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Krisen-Begriff
- Genese und Diffusion
- Öffnung
- Instrumentalisierungspotential
- Krise und Gesellschaft
- Symptom der Risikogesellschaft
- Die Medienkatalyse
- Krisen als Politikum
- Public Relations in der Risikogesellschaft
- Forschungsstand und Theoretische Grundlagen
- Sozialwissenschaftliche Krisenforschung
- Organisationstheoretische Krisenforschung
- Kommunikationswissenschaftliche Krisenforschung
- Situational Crisis Communication Theory
- Einflussfaktoren der Kommunikationsstrategie
- Kommunikationsstrategien
- Strategie-Wahl
- Krisenkommunikation im Öffentlichen Sektor
- Verwaltungsstruktur der Bundesrepublik Deutschland
- Staatliches Krisenmanagement in Deutschland
- Staatliche Krisenkommunikation
- Zentrale Annahmen
- Methodisches Vorgehen
- Untersuchungsgegenstand
- Auswahl der Krisen
- Operationalisierung
- Ergebnisse
- Themen und Akteursstruktur
- Krisennarration
- Relationen und Interaktion
- Strategien
- Journalistische Kontextualisierung
- Zusammenfassung
- Reflexion und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Krisenkommunikation im föderalen Verwaltungsaufbau und untersucht die Lokalberichterstattung zu vier ausgewählten Krisen in Baden-Württemberg. Sie zielt darauf ab, krisenübergreifende Schemata staatlicher Krisenkommunikation herauszuarbeiten und regionale, krisentypische oder hierarchische Unterschiede zu identifizieren. Dabei stehen narrative, relationale und strategische Aspekte sowie die journalistische Kontextualisierung im Fokus.
- Analyse der Krisenkommunikation in lokalen Krisen
- Identifizierung von Schemata staatlicher Krisenkommunikation
- Untersuchung regionaler, krisentypischer und hierarchischer Unterschiede
- Analyse von narrativen, relationalen und strategischen Aspekten
- Bedeutung der journalistischen Kontextualisierung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Relevanz des Forschungsgegenstandes im Kontext der aktuellen Krisenlandschaft beleuchtet. Anschließend wird der Krisen-Begriff im Detail betrachtet, seine Genese und Diffusion, seine Öffnung und sein Instrumentalisierungspotenzial werden analysiert. Das dritte Kapitel widmet sich dem Einfluss von Krisen auf die Gesellschaft, insbesondere im Kontext der Risikogesellschaft und der Medienkatalyse. Es werden zudem die politischen Implikationen von Krisen beleuchtet.
Kapitel 4 befasst sich mit Public Relations in der Risikogesellschaft und Kapitel 5 mit dem Forschungsstand und den theoretischen Grundlagen zur Krisenforschung, einschließlich der sozialwissenschaftlichen, organisationstheoretischen und kommunikationswissenschaftlichen Perspektiven. Kapitel 6 widmet sich der Situational Crisis Communication Theory und analysiert Einflussfaktoren, Kommunikationsstrategien und Strategie-Wahl.
Im siebten Kapitel werden die Besonderheiten der Krisenkommunikation im öffentlichen Sektor betrachtet, insbesondere die Verwaltungsstruktur Deutschlands und die Rolle des staatlichen Krisenmanagements. Die zentralen Annahmen der Arbeit werden in Kapitel 8 vorgestellt, während Kapitel 9 das methodische Vorgehen der Inhaltsanalyse beschreibt, einschließlich des Untersuchungsgegenstands, der Auswahl der Krisen und der Operationalisierung.
Schließlich werden in Kapitel 10 die Ergebnisse der Inhaltsanalyse präsentiert, mit Fokus auf Themen und Akteursstruktur, Krisennarration, Relationen und Interaktion, Strategien, journalistische Kontextualisierung sowie einer Zusammenfassung der zentralen Erkenntnisse. Die Arbeit schließt mit einer Reflexion und einem Ausblick in Kapitel 11.
Schlüsselwörter
Krisenkommunikation, föderaler Verwaltungsaufbau, Lokalberichterstattung, Inhaltsanalyse, Baden-Württemberg, staatliche Krisenkommunikation, narrative Strukturen, relationale Aspekte, strategische Ansätze, journalistische Kontextualisierung, Risikogesellschaft, Medienkatalyse, Public Relations.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der Untersuchung zur staatlichen Krisenkommunikation?
Die Arbeit analysiert krisenübergreifende Schemata staatlicher Kommunikation bei lokalen Ereignissen im föderalen Verwaltungsaufbau von Baden-Württemberg.
Was besagt die Situational Crisis Communication Theory (SCCT)?
Die SCCT liefert einen Rahmen für die Wahl der richtigen Kommunikationsstrategie basierend auf der Krisenart und dem Grad der zugeschriebenen Verantwortung.
Welche Rolle spielen lokale Medien in Krisensituationen?
Sie fungieren als Katalysator und beeinflussen durch ihre Berichterstattung maßgeblich die Wahrnehmung der Krise in der Bevölkerung und den Druck auf die Politik.
Wie beeinflusst der Föderalismus das Krisenmanagement?
Die Aufteilung der Zuständigkeiten zwischen Bund, Ländern und Kommunen erfordert eine komplexe Koordination der Kommunikationsprozesse.
Was sind "Krisennarrationen"?
Es sind die erzählerischen Muster, mit denen staatliche Akteure Ursachen, Verantwortung und Lösungen einer Krise öffentlich darstellen.
Welche vier Krisen wurden in Baden-Württemberg untersucht?
Die Arbeit vergleicht die Berichterstattung zu vier ausgewählten lokalen Krisenfällen, um Unterschiede in der Themen- und Akteursstruktur aufzuzeigen.
- Arbeit zitieren
- Andreas Joos (Autor:in), 2011, Die staatliche Kommunikation in der Berichterstattung zu lokalen Krisen. Krisenkommunikation im föderalistischen Verwaltungsaufbau, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/538222