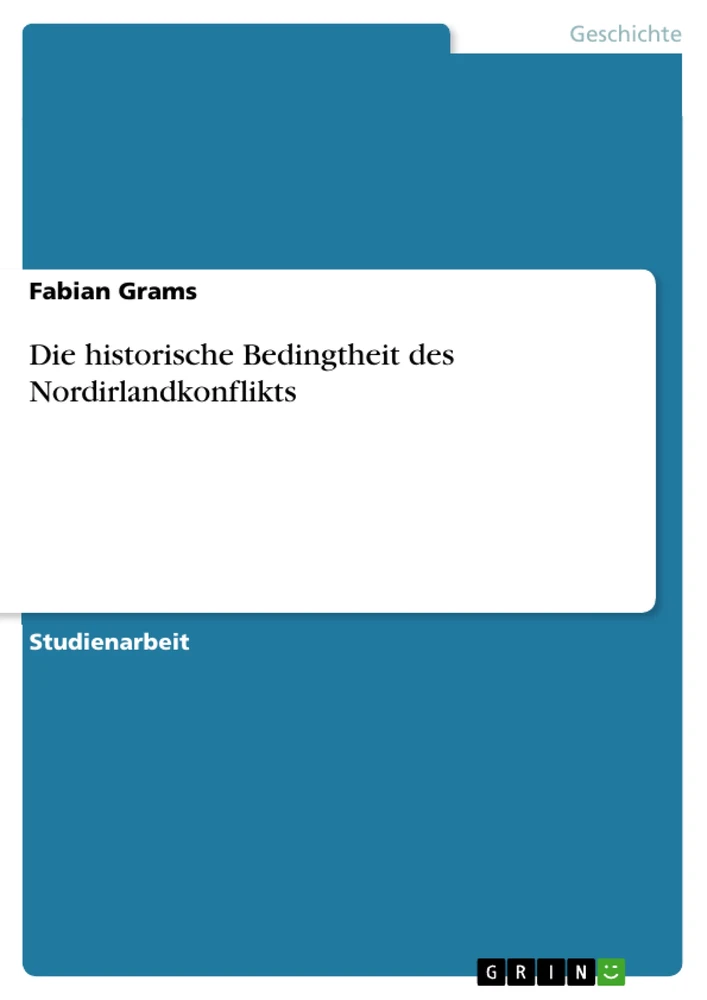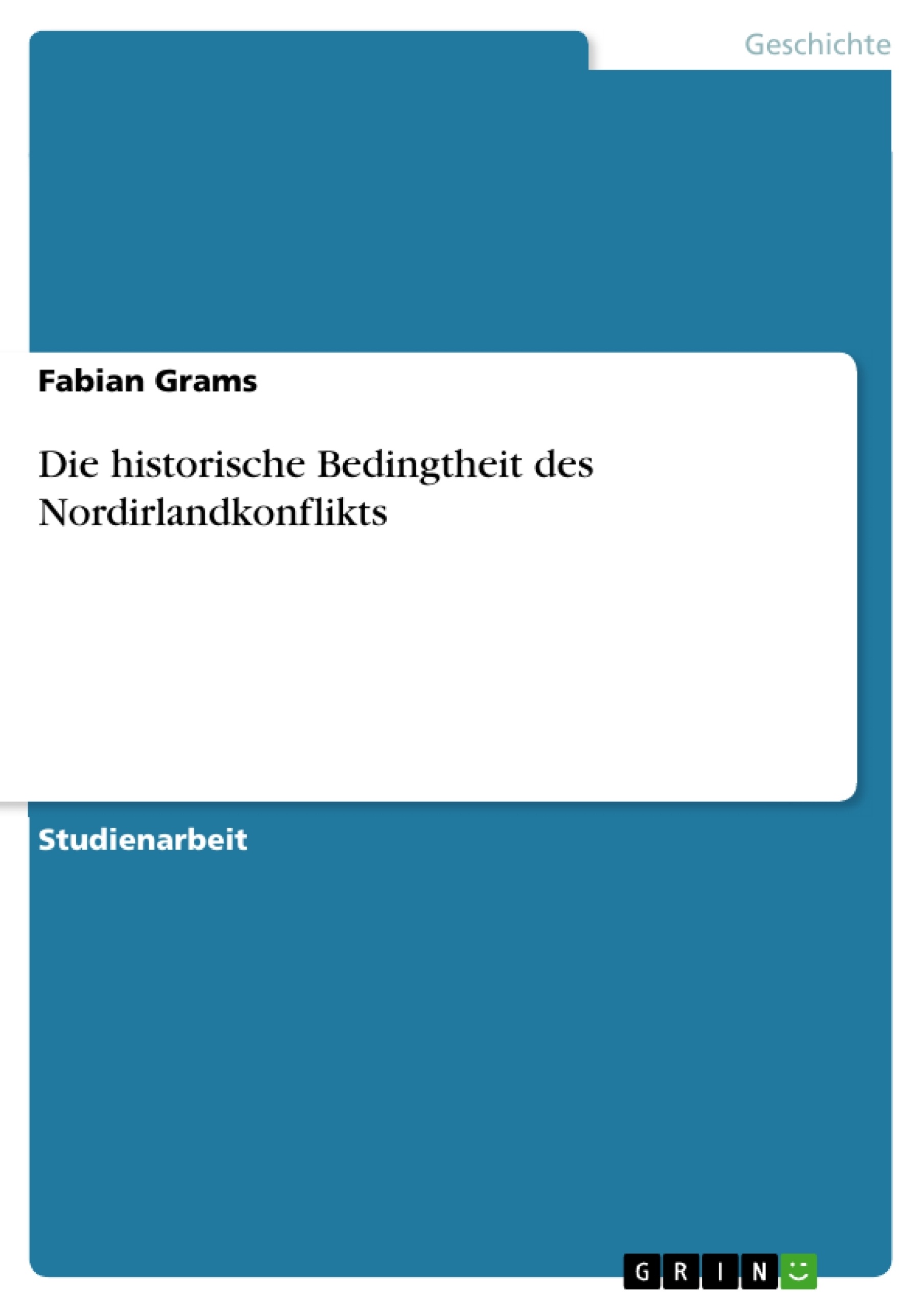Warum sich Protestanten und Katholiken in Nordirland in derart antagonistischer Beziehung entwickelten und sich bewaffnete Gruppen gewaltsam bekämpften, ist nur schwer zu begreifen, wenn nicht die besondere Bedeutung ihrer gemeinsamen Geschichte betrachtet wird. Einerseits prägten die politischen und sozialen Folgen bereits Jahrhunderte zurückliegender Ereignisse und Vorgänge die Bedingungen, die 1969 zur Eskalation der Gewalt führten. Andererseits nimmt die Geschichte in der
Identität der nordirischen Bevölkerung eine zentrale Rolle ein.
Ziel dieser Arbeit wird sein, die historischen Ursachen der strukturellen Bedingungen des Konflikts zu untersuchen. Dabei soll vor allem folgende Frage beantwortet werden: „Inwiefern hatten historische Entwicklungen Einfluss auf die strukturellen Bedingungen, die zur Spaltung der nordirischen Gesellschaft führten?“
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Der koloniale Eingriff Englands
- III. Die konfessionelle Spaltung
- 3.1 Englands Bruch mit Rom
- 3.2 Die Errichtung der protestantischen Hegemonie
- IV. Die politische Spaltung
- 4.1 Der Kampf um Selbstbestimmung
- 4.2 Die Errichtung zweier Staaten
- V. Geschichte als Ideologie
- VI. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die historischen Ursachen der strukturellen Bedingungen des Nordirlandkonflikts. Die zentrale Forschungsfrage lautet: „Inwiefern hatten historische Entwicklungen Einfluss auf die strukturellen Bedingungen, die zur Spaltung der nordirischen Gesellschaft führten?" Die Arbeit analysiert den englischen Kolonialismus in Irland, die konfessionelle Spaltung durch den Bruch mit Rom und die daraus resultierende protestantische Hegemonie, sowie die politische Kontroverse und die Teilung der Insel. Schließlich wird der ideologische Stellenwert der Geschichte für die Konfliktparteien beleuchtet.
- Der koloniale Eingriff Englands in Irland
- Die konfessionelle Spaltung durch den Bruch Englands mit Rom und die Folgen für die irische Bevölkerung
- Die Entwicklung der politischen Spaltung und der Kampf um Selbstbestimmung
- Die Errichtung zweier getrennter Staaten
- Die Rolle der Geschichte als Ideologie im Nordirlandkonflikt
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in den Nordirlandkonflikt ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem Einfluss historischer Entwicklungen auf die gesellschaftliche Spaltung. Sie betont die Bedeutung der historischen Kontextualisierung des Konflikts und skizziert den Aufbau der Arbeit, der sich mit der englischen Expansion, der konfessionellen und politischen Spaltung sowie der ideologischen Rolle der Geschichte auseinandersetzt. Der Bezug zum Brexit und die mögliche Wiederaufleben alter Konflikte wird als aktuelle Relevanz hervorgehoben.
II. Der koloniale Eingriff Englands: Dieses Kapitel untersucht die englische Kolonisierung Irlands ab dem 12. Jahrhundert, beginnend mit der Intervention Heinrichs II. und dem Einfluss von "Strongbow". Es analysiert die Strategien Englands, die Ausnutzung inneririscher Konflikte und die schrittweise Eroberung von Gebieten, die durch Auseinandersetzungen in anderen Regionen Europas behindert wurde. Das Kapitel beleuchtet die Integration der normannischen Eroberer in die irische Gesellschaft und die darauf folgenden Maßnahmen Englands, um die Kontrolle zu sichern und kulturelle Verbindungen zu unterbinden. Die vollständige Unterwerfung Irlands unter englische Herrschaft wird mit der Niederlage von Hugh O'Neill im Neunjährigen Krieg 1603 in Verbindung gebracht. Die Bedeutung dieses Kapitels liegt in der Darstellung der langfristigen Folgen des englischen Kolonialismus für die spätere Entwicklung des Konflikts.
III. Die konfessionelle Spaltung: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die konfessionelle Komponente des Nordirlandkonflikts, die ihren Ursprung im Bruch Heinrichs VIII. mit Rom im Jahre 1534 findet. Es analysiert die geopolitischen Hintergründe von Englands Vorgehen, insbesondere die Angst vor einer Allianz zwischen Spanien und Irland. Das Kapitel beleuchtet die Rolle von Arthur Chichester und dessen Ansicht, dass die Konvertierung der irischen Bevölkerung zum Protestantismus essentiell für die englische Sicherheit sei. Die Weigerung der irischen Bevölkerung, zum Protestantismus zu konvertieren und die Entwicklung einer ablehnenden Haltung gegenüber der englischen Herrschaft werden als zentrale Faktoren für die anhaltende konfessionelle Spaltung hervorgehoben. Der Bruch mit Rom wird als Ursprung des unüberwindlichen Gegensatzes zwischen den katholischen Iren und England dargelegt, der bis in die Gegenwart wirkt.
Schlüsselwörter
Nordirlandkonflikt, englischer Kolonialismus, Konfessionelle Spaltung, Protestantismus, Katholizismus, politische Spaltung, Selbstbestimmung, Geschichte als Ideologie, Identität, Brexit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Text: Ursachen des Nordirlandkonflikts
Was ist der Hauptfokus dieses Textes?
Der Text untersucht die historischen Ursachen des Nordirlandkonflikts und analysiert, wie historische Entwicklungen zu der Spaltung der nordirischen Gesellschaft beigetragen haben. Die zentrale Forschungsfrage lautet: "Inwiefern hatten historische Entwicklungen Einfluss auf die strukturellen Bedingungen, die zur Spaltung der nordirischen Gesellschaft führten?"
Welche Themen werden im Text behandelt?
Der Text behandelt den englischen Kolonialismus in Irland, die konfessionelle Spaltung durch den Bruch mit Rom und die daraus resultierende protestantische Hegemonie, die politische Spaltung und Teilung der Insel, sowie die ideologische Rolle der Geschichte für die Konfliktparteien. Die Kapitel befassen sich detailliert mit der englischen Kolonisierung, den religiösen Konflikten, dem Kampf um Selbstbestimmung und der Entstehung zweier getrennter Staaten.
Wie ist der Text strukturiert?
Der Text ist in Kapitel unterteilt, beginnend mit einer Einleitung und endend mit einem Fazit. Er enthält ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Zielsetzung und der Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter. Jedes Kapitel befasst sich mit einem spezifischen Aspekt der historischen Entwicklungen, die zum Nordirlandkonflikt geführt haben.
Was ist die Bedeutung des englischen Kolonialismus im Kontext des Nordirlandkonflikts?
Der Text argumentiert, dass der englische Kolonialismus in Irland seit dem 12. Jahrhundert langfristige Folgen hatte, die die spätere Entwicklung des Konflikts stark beeinflussten. Die englischen Strategien, die Ausnutzung inneririscher Konflikte und die schrittweise Eroberung von Gebieten werden als zentrale Faktoren analysiert.
Welche Rolle spielte die konfessionelle Spaltung?
Die konfessionelle Spaltung, die ihren Ursprung im Bruch Heinrichs VIII. mit Rom hat, wird als entscheidender Faktor für den Nordirlandkonflikt dargestellt. Die Weigerung der irischen Bevölkerung, zum Protestantismus zu konvertieren, und die daraus resultierende ablehnende Haltung gegenüber der englischen Herrschaft werden als zentrale Ursachen für die anhaltende Spaltung hervorgehoben.
Wie wird die politische Spaltung im Text behandelt?
Der Text analysiert die politische Spaltung und den Kampf um Selbstbestimmung als Folge des englischen Kolonialismus und der konfessionellen Spaltung. Die Errichtung zweier getrennter Staaten wird als Ergebnis dieser Entwicklungen dargestellt.
Welche Rolle spielt die Geschichte als Ideologie?
Der Text betont den ideologischen Stellenwert der Geschichte für die Konfliktparteien. Die unterschiedlichen Interpretationen historischer Ereignisse tragen maßgeblich zum Konflikt bei.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Text?
Schlüsselwörter des Textes sind: Nordirlandkonflikt, englischer Kolonialismus, konfessionelle Spaltung, Protestantismus, Katholizismus, politische Spaltung, Selbstbestimmung, Geschichte als Ideologie, Identität, Brexit.
Welche aktuelle Relevanz hat der Text?
Der Text hebt die aktuelle Relevanz des Themas hervor, insbesondere im Hinblick auf den Brexit und die mögliche Wiederaufleben alter Konflikte.
- Quote paper
- Fabian Grams (Author), 2019, Die historische Bedingtheit des Nordirlandkonflikts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/537659