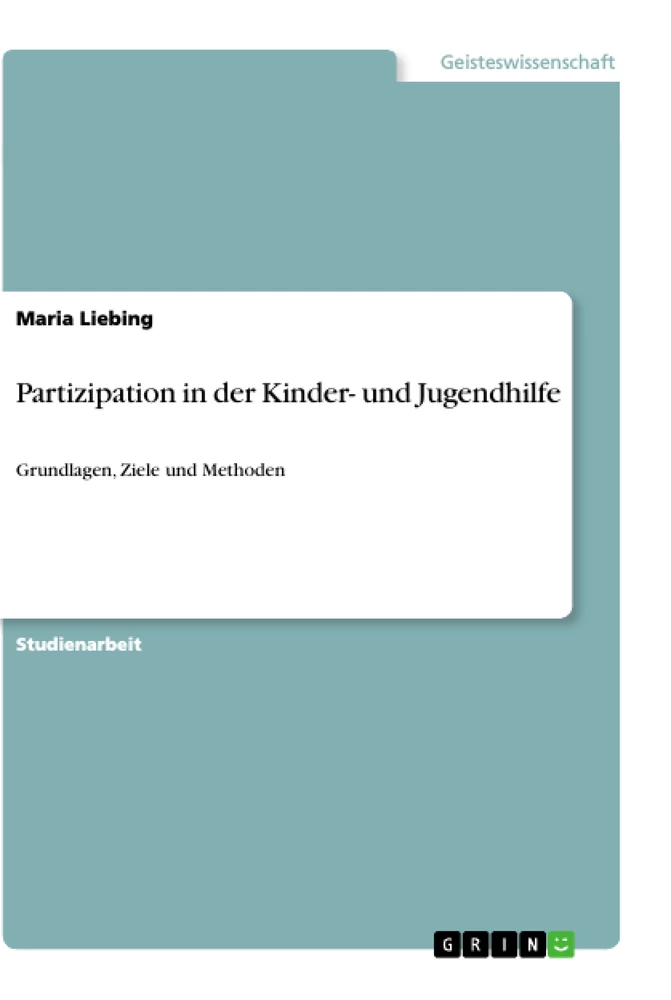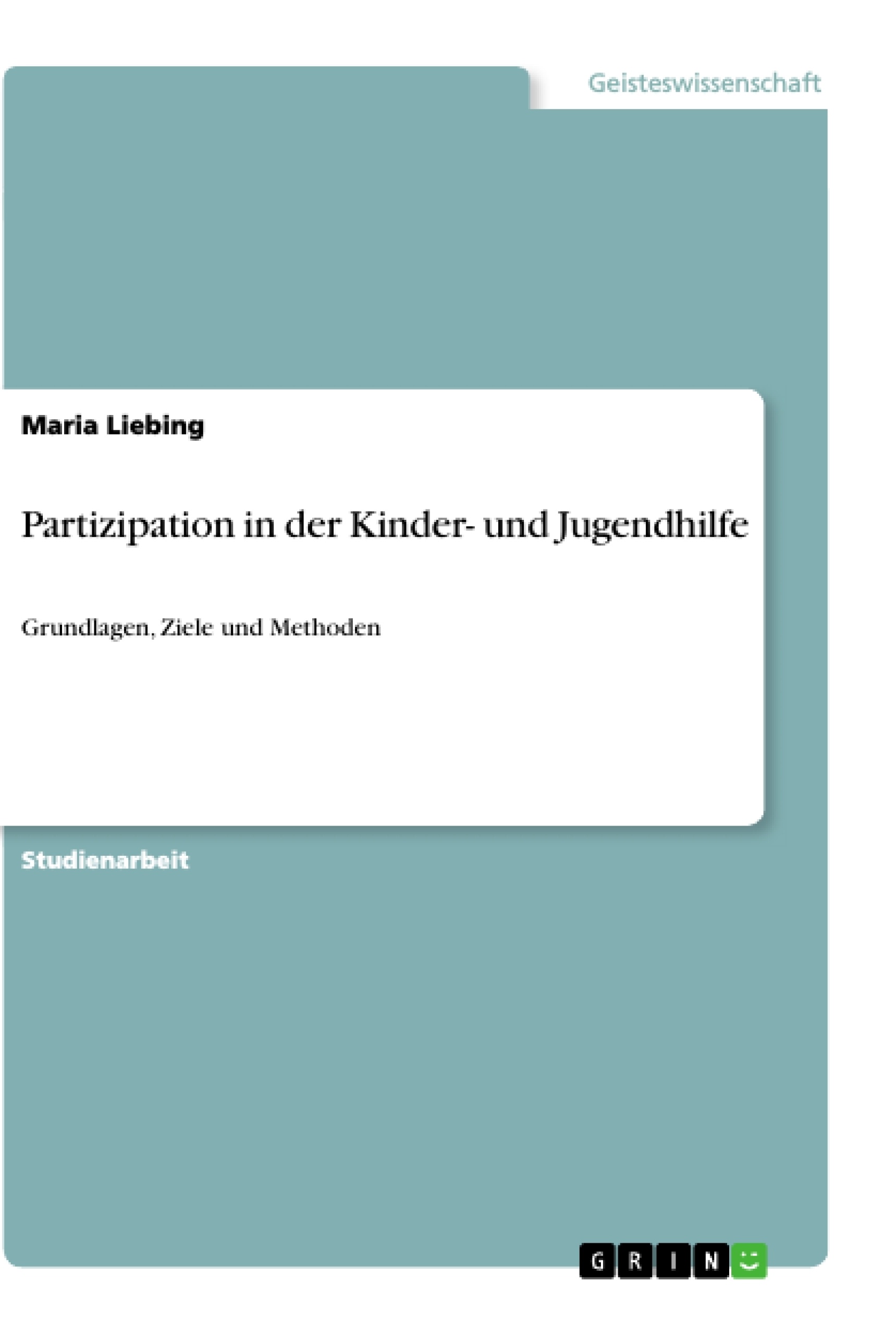Denkt man an Partizipation von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, so fragt man sich sofort: Was können Kinder und Jugendliche entscheiden und was nicht? Stellt man sich diese Frage im Team, werden sofort Ideen, aber auch Ängste laut. Die Befürchtungen reichen oftmals bis hin zu Bildern von anarchischen Zuständen. Dabei werden Kinder und Jugendliche oft unterschätzt. Junge Menschen wollen mitbestimmen und teilhaben. Sie wollen Entscheidungen für sich selbst treffen und Verantwortung übernehmen. Dabei liegt die Schwierigkeit darin, das Maß zu bestimmen.
Diese Arbeit soll dazu beitragen, ein Verständnis dafür zu entwickeln, was Partizipation ist und wie diese im Alltag von Institutionen der Kinder- und Jugendhilfe gelebt werden kann. Zu diesem Zweck wird der Begriff der Partizipation näher definiert, Ziele aufgezeigt und die rechtlichen Grundlagen vorgestellt. Zudem werden verschiedene Partizipationsmethoden anhand der verschiedenen Institutionen der Kinder- und Jugendhilfe vorgestellt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffsklärung und Grundlagen
- 3. Ziele
- 4. Methoden
- Mitwirkung
- Mitbestimmung
- Selbstbestimmung
- 5. Besonderheiten im stationären Hilfekontext
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit zielt darauf ab, Partizipation von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe zu verstehen und deren Umsetzung im Alltag zu beleuchten. Der Begriff Partizipation wird definiert, rechtliche Grundlagen vorgestellt, und die Ziele partizipativer Ansätze werden erläutert. Verschiedene Partizipationsmethoden werden anhand unterschiedlicher Einrichtungen vorgestellt und anhand von Praxisbeispielen illustriert.
- Definition und rechtliche Grundlagen von Partizipation
- Ziele der Partizipation in der Kinder- und Jugendhilfe
- Partizipationsmethoden in verschiedenen Einrichtungen
- Praxisbeispiele für Partizipation
- Zukünftige Perspektiven der Partizipation in der Jugendhilfe
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Partizipation von Kindern und Jugendlichen in der Kinder- und Jugendhilfe ein und stellt die zentrale Frage nach dem angemessenen Maß an Mitbestimmung. Sie skizziert die Zielsetzung der Arbeit: ein Verständnis für Partizipation und deren praktische Umsetzung in Institutionen zu entwickeln. Der einleitende Zitat von John Naisbitt betont die Wichtigkeit der Beteiligung Betroffener an Entscheidungsprozessen, die ihr Leben betreffen. Die Einleitung verdeutlicht die Notwendigkeit, Kinder und Jugendliche nicht zu unterschätzen und ihre Bereitschaft zur Mitbestimmung und Verantwortung zu berücksichtigen.
2. Begriffsklärung und Grundlagen: Dieses Kapitel definiert den Begriff Partizipation als Mitgestaltung, Mitwirkung, Mitbestimmung und Mitverantwortung. Es verankert das Konzept in den rechtlichen Grundlagen, insbesondere im Grundgesetz (Art. 1 Abs. 1, Art. 2 Abs. 1) und dem SGB VIII (§ 1), die das Recht auf Selbstbestimmung und Würde aller Menschen, einschließlich Kindern und Jugendlichen, betonen. Weiterhin werden internationale Gesetze wie die UN-Kinderrechtskonvention erwähnt, die die partizipativen Rechte von Kindern und Jugendlichen unterstreichen und die Einbindung in Bildung, Entwicklung und Teilhabe hervorheben.
3. Ziele: Dieses Kapitel beschreibt die Ziele von Partizipation. Es geht darum, die Rechte junger Menschen in allen Lebensbereichen zu stärken und sie darin zu unterstützen, diese Rechte einzufordern. Besonders wichtig ist die Partizipation in Institutionen, da Kinder und Jugendliche dort möglicherweise nur wenige Erfahrungen mit Beteiligung sammeln konnten. Partizipation fördert das Empowerment, wirkt Benachteiligungen entgegen und unterstützt Integration und Inklusion. Ein weiteres Ziel ist die Demokratiebildung, da Kinder und Jugendliche lernen, ihre Umwelt aktiv mitzugestalten und Einfluss zu nehmen. Schließlich profitiert auch das Fachpersonal von Partizipation durch einen besseren Einblick in die Lebenswelten, Wünsche und Vorstellungen der jungen Menschen.
4. Methoden: Dieses Kapitel beleuchtet verschiedene partizipative Methoden und Ansätze. Es betont, dass Partizipation ein Recht jedes Menschen ist, unabhängig von Alter, Behinderung oder kognitiven Fähigkeiten. Die Methoden variieren je nach Institution und Bereich. Ein grundlegender Ansatz besteht darin, Macht von den Fachkräften an die jungen Menschen abzugeben. Es werden drei Stufen der Beteiligung nach Roeder beschrieben: Mitwirkung (Mitsprache, Entscheidung liegt bei den Fachkräften), Mitbestimmung (Einflussnahme durch Stimmrechte) und Selbstbestimmung (alleiniges Entscheidungsrecht). Das Kapitel veranschaulicht diese Stufen anhand von Beispielen wie der Ferienplanung in der stationären Jugendhilfe. Die Herausforderungen der Partizipation in verschiedenen Einrichtungen (Kindertageseinrichtungen, offene Kinder- und Jugendarbeit, stationäre Jugendhilfe) werden ebenfalls erörtert.
5. Besonderheiten im stationären Hilfekontext: Das Kapitel konzentriert sich auf die besonderen Herausforderungen partizipativer Arbeit in stationären Einrichtungen. Es betont die Notwendigkeit, die Bedürfnisse des Einzelnen und der Gruppe in Einklang zu bringen und eine sensible Kommunikation zu gewährleisten. Erfolgreiche Hilfen setzen die aktive Mitwirkung der Hilfeempfänger voraus, was im stationären Setting einen besonderen Stellenwert erhält, da die jungen Menschen dort leben. Die Bedeutung der Partizipation im gesamten Hilfeprozess, von Beginn bis zum Ende der Hilfe, wird unterstrichen, und das Mitspracherecht im Hilfeplanverfahren ( §§ 5, 36 SGB VIII) wird hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Partizipation, Kinderrechte, Jugendhilfe, Selbstbestimmung, Mitbestimmung, Mitwirkung, Empowerment, Demokratiebildung, Methoden der Beteiligung, Institutionen der Jugendhilfe, Kindertageseinrichtungen, offene Kinder- und Jugendarbeit, stationäre Jugendhilfe, Inklusion, Integration.
Häufig gestellte Fragen zu: Partizipation von Kindern und Jugendlichen in der Kinder- und Jugendhilfe
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich mit der Partizipation von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe. Sie untersucht den Begriff der Partizipation, die rechtlichen Grundlagen, Ziele partizipativer Ansätze und verschiedene Partizipationsmethoden in unterschiedlichen Einrichtungen. Die Arbeit beleuchtet die praktische Umsetzung von Partizipation im Alltag und betrachtet die Besonderheiten im stationären Kontext.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition und rechtliche Grundlagen von Partizipation, Ziele der Partizipation in der Kinder- und Jugendhilfe, Partizipationsmethoden in verschiedenen Einrichtungen (mit Praxisbeispielen), die Herausforderungen der Partizipation in unterschiedlichen Settings (Kindertageseinrichtungen, offene Kinder- und Jugendarbeit, stationäre Jugendhilfe), und zukünftige Perspektiven der Partizipation in der Jugendhilfe. Besonderer Fokus liegt auf den drei Stufen der Beteiligung nach Roeder: Mitwirkung, Mitbestimmung und Selbstbestimmung.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Das Hauptziel ist es, ein umfassendes Verständnis für Partizipation von Kindern und Jugendlichen in der Kinder- und Jugendhilfe zu entwickeln und deren praktische Umsetzung zu beleuchten. Die Arbeit möchte die Bedeutung von Partizipation für die Stärkung der Rechte junger Menschen, die Förderung von Empowerment, die Bekämpfung von Benachteiligungen und die Unterstützung von Integration und Inklusion hervorheben. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Demokratiebildung bei Kindern und Jugendlichen.
Welche Methoden der Partizipation werden vorgestellt?
Die Arbeit beschreibt verschiedene partizipative Methoden und Ansätze, die je nach Institution und Kontext variieren. Ein zentraler Aspekt ist die Abgabe von Macht von den Fachkräften an die jungen Menschen. Es werden die drei Stufen der Beteiligung nach Roeder (Mitwirkung, Mitbestimmung, Selbstbestimmung) anhand von Praxisbeispielen, z.B. der Ferienplanung in der stationären Jugendhilfe, erläutert.
Welche rechtlichen Grundlagen werden berücksichtigt?
Die Arbeit verankert das Konzept der Partizipation in den rechtlichen Grundlagen, insbesondere im Grundgesetz (Art. 1 Abs. 1, Art. 2 Abs. 1) und dem SGB VIII (§ 1), die das Recht auf Selbstbestimmung und Würde aller Menschen betonen. Internationale Gesetze wie die UN-Kinderrechtskonvention, die die partizipativen Rechte von Kindern und Jugendlichen unterstreichen, werden ebenfalls erwähnt.
Welche Besonderheiten gibt es im stationären Hilfekontext?
Das Kapitel zum stationären Kontext betont die besonderen Herausforderungen partizipativer Arbeit in solchen Einrichtungen. Es unterstreicht die Notwendigkeit, die individuellen Bedürfnisse der jungen Menschen mit den Bedürfnissen der Gruppe in Einklang zu bringen und eine sensible Kommunikation zu gewährleisten. Die aktive Mitwirkung der Hilfeempfänger im gesamten Hilfeprozess, insbesondere im Hilfeplanverfahren (§§ 5, 36 SGB VIII), wird hervorgehoben.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Partizipation, Kinderrechte, Jugendhilfe, Selbstbestimmung, Mitbestimmung, Mitwirkung, Empowerment, Demokratiebildung, Methoden der Beteiligung, Institutionen der Jugendhilfe, Kindertageseinrichtungen, offene Kinder- und Jugendarbeit, stationäre Jugendhilfe, Inklusion, Integration.
- Quote paper
- Maria Liebing (Author), 2017, Partizipation in der Kinder- und Jugendhilfe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/537647