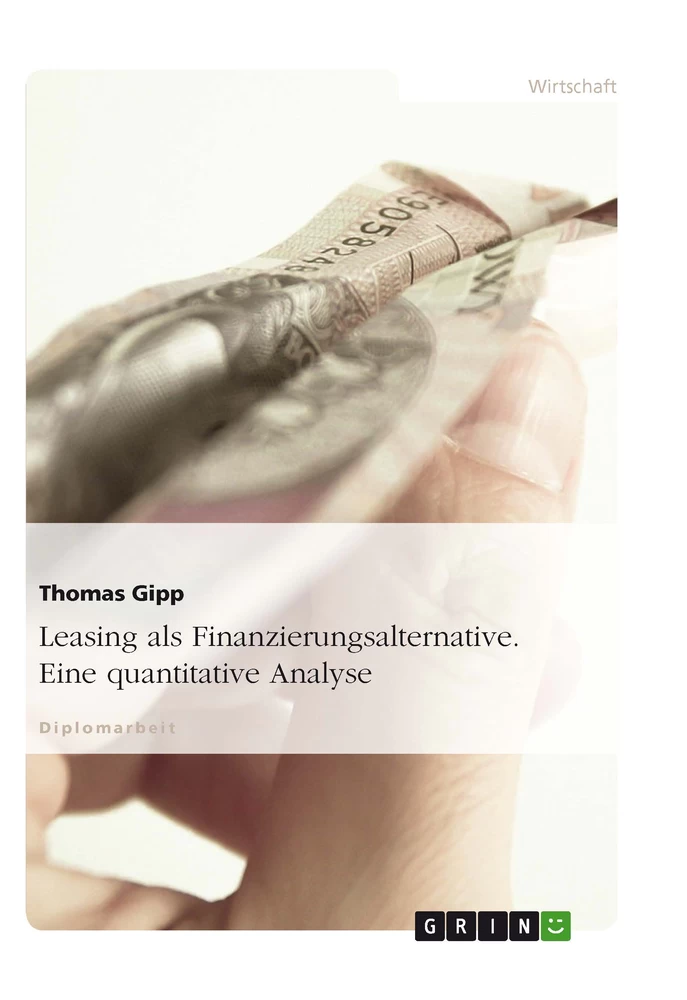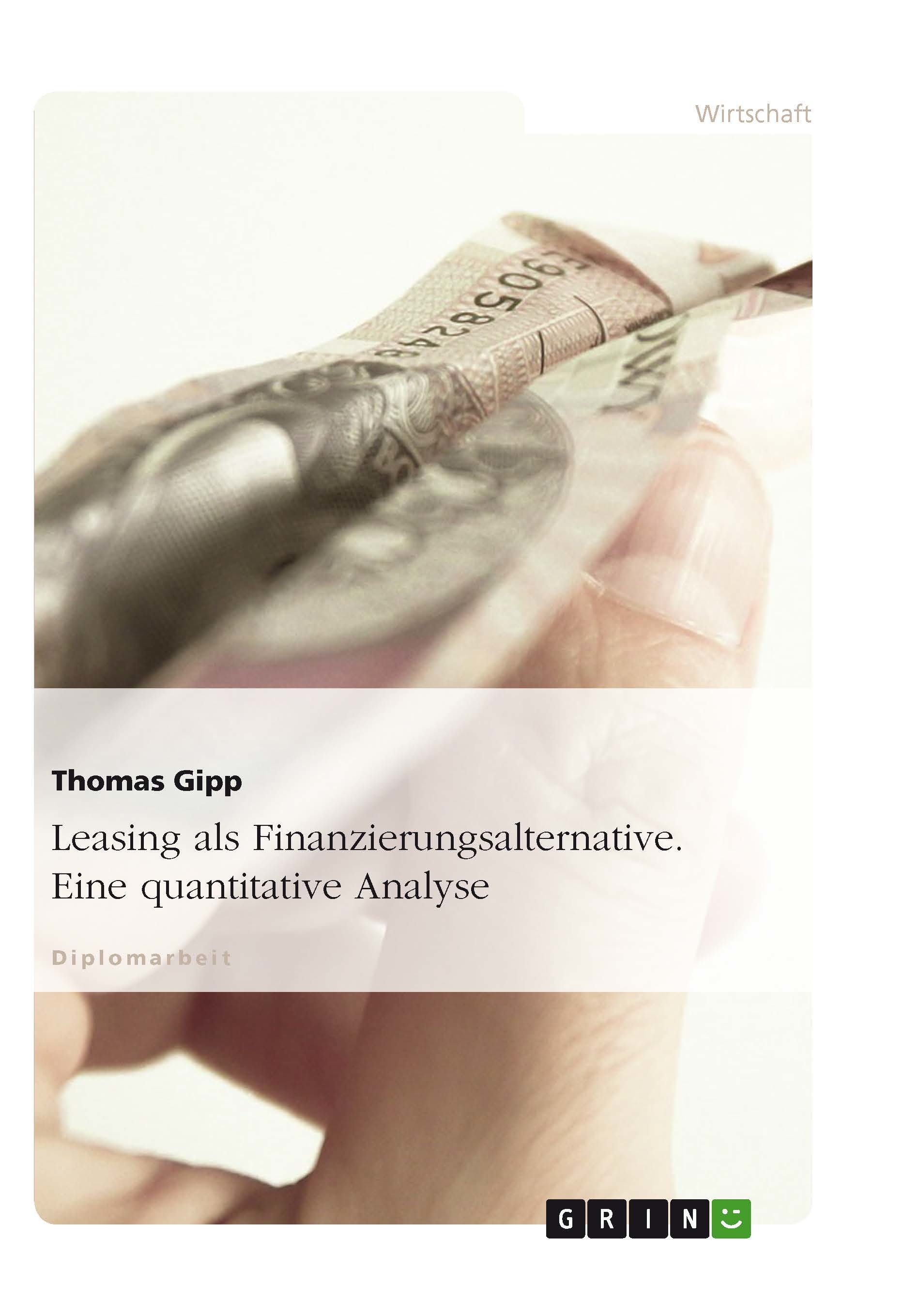In den USA wurden zu Beginn dieses Jahrhunderts etwa 30% aller Neuwagen und 66% des Absatzes der Computerindustrie mittels Leasing finanziert . Auch in Deutschland hat Leasing als Finanzierungs-alternative gegenwärtig eine beachtliche Größenordnung erreicht. Aus der betrieblichen Praxis ist diese Finanzierungsform nicht mehr wegzudenken . Unternehmen haben deswegen häufig zu entscheiden, ob eine Investition mit Kreditmitteln durchgeführt werden soll oder ob die Finanzierung mittels Leasing günstiger ist . Dabei sind quantitative und qualitative Argumente zu berücksichtigen . Die Analysen in dieser Arbeit beschränken sich auf quantitative Faktoren.
Im Hauptteil dieser Arbeit wird ein Entscheidungsmodell entwickelt, das die unterschiedlichen Wirkungen bei Leasing und Kreditkauf berücksichtigt. Das Modell beschreibt die quantitativen Folgen der jeweiligen Finanzierungsart beim Investor. Die Konsequenzen beim Leasing- oder Kreditgeber werden in die Analyse nicht einbezogen. Der Investor soll anhand gegebener Kredit- und Leasingangebote entscheiden können, welche Finanzierungsform für ihn vorteilhaft ist. Es werden unter Zugrundelegung des Kapitalwertkriteriums wohldefinierte Auszahlungsbarwerte verglichen, die aus den jeweils relevanten Zahlungsströmen abgeleitet sind. Auf dieser Basis wird dann als Entscheidungskriterium die kritische Leasingrate, bei der die Belastung zwischen Leasing und Kreditkauf gerade gleich ist, hergeleitet. Steuerliche Unterschiede zwischen Leasing und Kreditkauf werden oft als die Ursache für die Existenz des Leasingmarkts angesehen . Besonderer Wert wird daher auf die Darstellung der steuerlichen Argumente des Vorteilhaftigkeitsvergleichs gelegt. Dabei wird vom aktuellen Rechtsstand des Steuerrechts in Deutschland ausgegangen. Durch die Beschreibung der Auswirkungen von Abschreibungswahlrechten und Subventionserlangungsmöglichkeiten wird der bedeutende Einfluss des Steuerrechts auf den Vorteilhaftigkeitsvergleich skizziert.
Im Rahmen der abschließenden Sensitivitätsanalysen wird untersucht, wie sich die Vorteilhaftigkeit ändert, wenn einzelne Inputfaktoren des Modells für beide Finanzierungsalternativen gleichermaßen variiert werden. Es wird verdeutlicht, wie stark der Einfluss der einzelnen Faktoren ist und ob sich die Vorteilhaftigkeit im relevanten Inputbereich ändert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundlagen
- Begriff des Leasings
- Erscheinungsformen des Leasings
- Bilanzielle Zurechnung von Leasingobjekten
- Operate-Leasing-Verträge
- Vollamortisations-Finanzierungsleasingverträge
- Teilamortisations-Finanzierungsleasingverträge
- Quantitative Analyse aus Sicht des Leasingnehmers
- Prämissen des Vorteilhaftigkeitsvergleichs
- Bestimmung des Vorteilhaftigkeitskriteriums
- Quantitative Analyse ohne Steuern
- Einbeziehung von Steuerwirkungen in die Analyse
- Prämissen und Eingrenzungen
- Verkehrs- und Substanzsteuern
- Analyse der Ertragsteuerwirkungen
- Gewerbesteuer
- Körperschaftsteuer
- Bestimmung des Nettokalkulationszinssatzes
- Wohldefinierter Auszahlungsbarwert bei Leasing
- Wohldefinierter Auszahlungsbarwert bei Kreditkauf
- Belastungsgleiche bzw. kritische Leasingrate
- Möglichkeiten der Abschreibungsgestaltung
- Investitionszulagen und Investitionszuschüsse
- Sensitivitätsanalysen
- Begriff und Annahmen
- Variation des Gewerbesteuerhebesatzes
- Variation des Hebesatzes bei Leasing
- Variation des Hebesatzes bei Kreditkauf
- Vergleich der Gewerbesteuerhebesatzeinflüsse
- Variation des Zinsniveaus
- Variation des Zinsniveaus bei Leasing
- Variation des Zinsniveaus bei Kreditkauf
- Vergleich der Zinseinflüsse
- Variation des kalkulierten Restwerts
- Variation der Nutzungsdauer
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit untersucht Leasing als Finanzierungsalternative mittels einer quantitativen Analyse. Ziel ist es, die Vorteilhaftigkeit von Leasing im Vergleich zum Kreditkauf unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren zu ermitteln.
- Vergleich von Leasing und Kreditkauf
- Einfluss von Steuern auf die Vorteilhaftigkeit
- Sensitivitätsanalysen zu verschiedenen Parametern
- Bestimmung kritischer Leasingraten
- Bilanzielle Darstellung von Leasingverträgen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Diplomarbeit ein und beschreibt die Zielsetzung der quantitativen Analyse von Leasing als Finanzierungsalternative im Vergleich zum Kreditkauf. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und benennt die wichtigsten Fragestellungen, die im Laufe der Arbeit beantwortet werden sollen. Der Fokus liegt auf der Untersuchung der ökonomischen Aspekte und der Berücksichtigung steuerlicher Auswirkungen.
Grundlagen: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für die spätere quantitative Analyse. Es definiert den Begriff des Leasings, beschreibt verschiedene Erscheinungsformen (z.B. Operate-Leasing, Finanzierungsleasing) und erläutert die bilanzielle Zurechnung von Leasingobjekten. Die verschiedenen Leasingarten werden detailliert beschrieben und ihre jeweiligen Auswirkungen auf die Bilanz des Leasingnehmers werden herausgearbeitet. Dies bildet die essentielle Basis für das Verständnis der nachfolgenden Analysen.
Quantitative Analyse aus Sicht des Leasingnehmers: Der Schwerpunkt dieses Kapitels liegt auf der quantitativen Analyse der Vorteilhaftigkeit von Leasing im Vergleich zum Kreditkauf aus Sicht des Leasingnehmers. Es werden zunächst die Prämissen des Vorteilhaftigkeitsvergleichs definiert und ein geeignetes Kriterium festgelegt. Die Analyse erfolgt zunächst ohne Berücksichtigung von Steuern und wird anschließend um steuerliche Aspekte erweitert. Hier werden die Einflüsse der Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer und anderer Steuerarten untersucht. Es werden Sensitivitätsanalysen durchgeführt, um die Auswirkungen von Veränderungen verschiedener Parameter (z.B. Gewerbesteuerhebesatz, Zinsniveau, Restwert, Nutzungsdauer) auf die Vorteilhaftigkeit beider Finanzierungsalternativen zu ermitteln. Der Vergleich von Leasing und Kreditkauf wird anhand des Auszahlungsbarwerts durchgeführt und kritische Leasingraten werden berechnet.
Schlüsselwörter
Leasing, Kreditkauf, Finanzierungsalternative, quantitative Analyse, Steuerwirkungen, Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Sensitivitätsanalyse, Vorteilhaftigkeitsvergleich, Auszahlungsbarwert, kritische Leasingrate, Abschreibung.
Häufig gestellte Fragen zur Diplomarbeit: Quantitative Analyse von Leasing im Vergleich zum Kreditkauf
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht Leasing als Finanzierungsalternative im Vergleich zum Kreditkauf mittels einer quantitativen Analyse. Ziel ist die Ermittlung der Vorteilhaftigkeit von Leasing unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren, insbesondere steuerlicher Auswirkungen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit umfasst einen Vergleich von Leasing und Kreditkauf, den Einfluss von Steuern (Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer etc.) auf die Vorteilhaftigkeit, Sensitivitätsanalysen zu verschiedenen Parametern (z.B. Zinsniveau, Restwert, Nutzungsdauer), die Bestimmung kritischer Leasingraten und die bilanzielle Darstellung von Leasingverträgen.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Grundlagenkapitel (Definition von Leasing, Arten von Leasingverträgen, bilanzielle Zurechnung), ein Kapitel zur quantitativen Analyse (mit und ohne Steuerwirkungen, Sensitivitätsanalysen), und eine Zusammenfassung. Die quantitative Analyse betrachtet den Vorteilhaftigkeitsvergleich aus Sicht des Leasingnehmers und berechnet den Auszahlungsbarwert für beide Finanzierungsformen.
Welche Arten von Leasing werden betrachtet?
Die Arbeit behandelt verschiedene Erscheinungsformen des Leasings, darunter Operate-Leasing, Vollamortisations-Finanzierungsleasingverträge und Teilamortisations-Finanzierungsleasingverträge. Die jeweiligen Auswirkungen auf die Bilanz des Leasingnehmers werden detailliert erläutert.
Welche Steuerwirkungen werden berücksichtigt?
Die Analyse beinhaltet die Berücksichtigung von Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer und anderen relevanten Steuerarten. Es wird untersucht, wie diese Steuerarten die Vorteilhaftigkeit von Leasing im Vergleich zum Kreditkauf beeinflussen.
Welche Sensitivitätsanalysen werden durchgeführt?
Sensitivitätsanalysen werden durchgeführt, um die Auswirkungen von Veränderungen verschiedener Parameter auf die Vorteilhaftigkeit zu untersuchen. Dies beinhaltet die Variation des Gewerbesteuerhebesatzes, des Zinsniveaus, des kalkulierten Restwerts und der Nutzungsdauer, jeweils für Leasing und Kreditkauf.
Was sind kritische Leasingraten?
Die Arbeit berechnet kritische Leasingraten, die den Punkt angeben, an dem Leasing und Kreditkauf aus finanzieller Sicht gleichwertig sind.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für die Arbeit?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind Leasing, Kreditkauf, Finanzierungsalternative, quantitative Analyse, Steuerwirkungen, Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Sensitivitätsanalyse, Vorteilhaftigkeitsvergleich, Auszahlungsbarwert, kritische Leasingrate und Abschreibung.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für alle, die sich mit den finanziellen Aspekten von Leasing und Kreditkauf auseinandersetzen, insbesondere für Studierende, Wissenschaftler und Praktiker im Finanzwesen.
Wo finde ich den vollständigen Text der Diplomarbeit?
Der vollständige Text der Diplomarbeit ist nicht in diesem FAQ enthalten. Dieser Auszug dient lediglich als Zusammenfassung der wichtigsten Punkte.
- Quote paper
- Thomas Gipp (Author), 2004, Leasing als Finanzierungsalternative. Eine quantitative Analyse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/53642