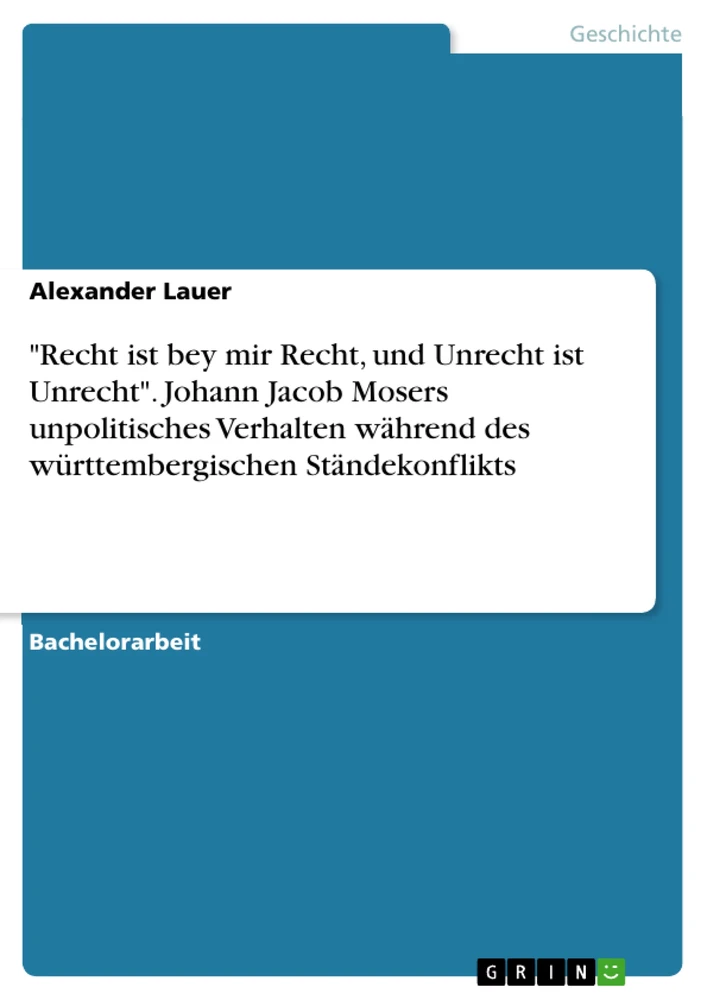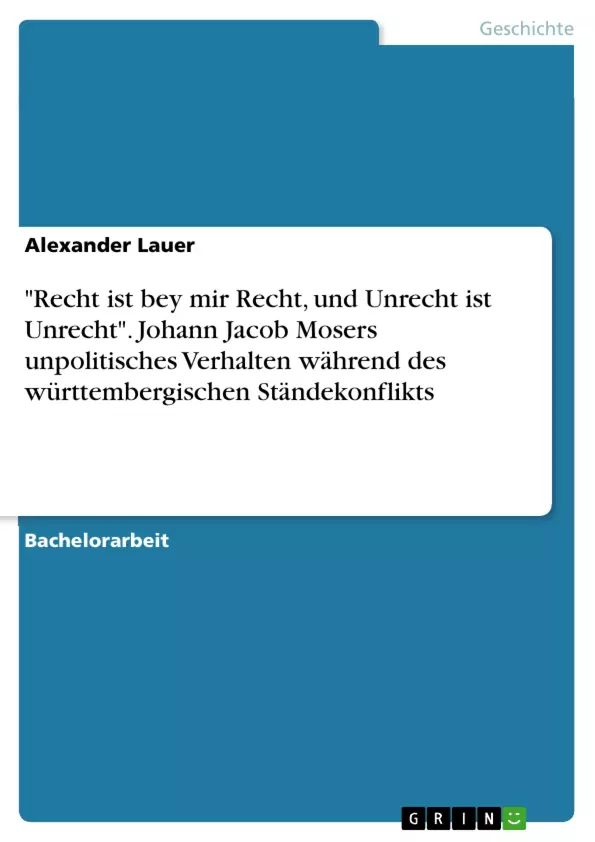Im Jahr 1751 kehrte der aus Stuttgart stammende Jurist Johann Jacob Moser (1701–1785) nach 15-jähriger Abwesenheit in seine Heimatstadt zurück, um dort das Amt des Rechtsberaters der württembergischen Landstände anzutreten. Als er 19 Jahre später offiziell wieder daraus verabschiedet wurde, hatte er bereits seit einigen Jahren den Großteil seines Einflusses auf die Landstände und deren Politik gegenüber Herzog Carl Eugen (1728/1737–1793) verloren. Während dieser Zeit spielte sich der württembergische Ständekonflikt ab, in dem Moser zunächst eine wichtige Rolle einnahm, an dessen Ende er sich jedoch resigniert ins Privatleben zurückziehen musste, was auf den ersten Blick überrascht. Denn immerhin waren die Landstände, in deren Diensten Moser offiziell stand, ‚siegreich‘ aus der Auseinandersetzung mit dem Herzog hervorgegangen. In dieser Arbeit soll daher der Frage nachgegangen werden, warum Moser schließlich sein Amt verlor.
Am Anfang wird in Kapitel I zunächst ein Überblick über die Funktionsweise und Rechtsstellung der württembergischen Landstände gegeben; denn um Mosers Rolle im Ständekonflikt verstehen zu können, muss man die institutionellen Bedingungen kennen, mit denen er es zu tun hatte. Ferner ist für eine Darstellung der diesbezüglichen Verhältnisse in Württemberg während Mosers Amtszeit auch ein Blick auf die württembergische Politik der Jahre vor 1751 notwendig. Analoges gilt für die Zusammenfassung von Mosers Leben und Werk in Kapitel II. Schließlich sind in Kapitel III die ‚äußeren‘ Ereignisse zu skizzieren, die sich von 1751 bis 1770 in der württembergischen Politik beziehungsweise in der Interaktion zwischen Herzog und Landschaft abspielten, wobei das Augenmerk vor allem auf Mosers Rolle liegen wird. Daraufhin sind auf der Grundlage von Mosers eigenen Äußerungen seine persönlichen Positionen in den Problembereichen des Ständekonflikts darzustellen, um schließlich in einem dritten Schritt die Frage zu beantworten, inwiefern diese Positionen zu Mosers ‚Schicksal‘ beitrugen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Landstände und Herzog im Württemberg des 18. Jahrhunderts
- 1. Landtag und Landstände
- a) Zusammensetzung
- b) Mitwirkungsrechte
- c) Ausschüsse
- 2. Verhältnis zwischen Herzog und Landschaft
- a) Carl Alexander
- b) Erste Regierungsjahre Carl Eugens
- II. Leben und Schaffen Johann Jacob Mosers
- 1. Zur Familie
- 2. Studium und Wanderjahre
- a) Ausbildung und erste Lehrtätigkeit in Tübingen
- b) Schnelle Wechsel zwischen Wien, Stuttgart und Tübingen
- c) Von Frankfurt über Ebersdorf und Hanau zurück nach Stuttgart
- 3. Zum Werk
- a) Arbeitsgebiete
- b) Wissenschaftliche Grundsätze am Beispiel des Hauptwerks
- III. Johann Jacob Moser im württembergischen Ständekonflikt
- 1. Ereignisverlauf
- a) Moser und die Landschaft bis 1756
- b) Herzogliche Politik bis zum Siebenjährigen Krieg
- c) Verschärfung des Konflikts nach Kriegsausbruch
- d) Eskalation: Berufung Montmartins und Verhaftung Mosers
- e) Mosers Haft auf dem Hohentwiel
- f) Vom Wendepunkt des Kriegsendes bis zu Mosers vergeblichem Comeback
- g) Erbvergleich, weitere Entwicklung und Mosers letzte Jahre
- 2. Mosers Grundsätze und Meinung zu den Landständen
- a) Charaktereigenschaften und Amtsverständnis
- b) Haltung zur Arbeitsweise der Landschaft
- c) Anforderungen an Herzog und Landschaft
- 3. Deutung von Mosers Verhalten
- a) Mosers eigene Bewertung
- b) Mosers „Abrechnung“ mit dem Engeren Ausschuss
- c) Gründe für Mosers Scheitern
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Gründe für den Verlust des Amtes von Johann Jacob Moser als Rechtsberater der württembergischen Landstände während des Ständekonflikts. Sie hinterfragt die gängige Darstellung Mosers als reinen Märtyrer des ständischen Widerstands und beleuchtet seine komplexe Rolle im Konflikt. Der Fokus liegt auf den persönlichen Faktoren, die zu seinem Scheitern beitrugen.
- Die Funktionsweise und Rechtsstellung der württembergischen Landstände im 18. Jahrhundert
- Das Leben und Werk von Johann Jacob Moser
- Der Verlauf des württembergischen Ständekonflikts
- Mosers Verhältnis zu den Landständen und zum Herzog Carl Eugen
- Analyse von Mosers Persönlichkeit und deren Einfluss auf sein Handeln
Zusammenfassung der Kapitel
I. Landstände und Herzog im Württemberg des 18. Jahrhunderts: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die Struktur und die Machtverhältnisse zwischen den württembergischen Landständen und dem Herzog im 18. Jahrhundert. Es beschreibt die Zusammensetzung, die Rechte und die Arbeitsweise der Landstände sowie das wechselhafte Verhältnis zwischen ihnen und den jeweiligen Herzögen, insbesondere Carl Alexander und Carl Eugen. Die Darstellung der institutionellen Rahmenbedingungen ist essentiell, um Mosers spätere Rolle im Ständekonflikt zu verstehen und einzuordnen. Der Fokus liegt auf der Beschreibung der politischen Machtstrukturen und der Entscheidungsfindungsprozesse.
II. Leben und Schaffen Johann Jacob Mosers: Dieses Kapitel zeichnet ein umfassendes Bild von Mosers Leben und Werk. Es beleuchtet seine familiäre Herkunft, seinen Ausbildungsweg mit Stationen in Tübingen, Wien, Stuttgart und Frankfurt, sowie seine vielseitigen Tätigkeiten als Jurist und Publizist. Besondere Aufmerksamkeit gilt seinen wissenschaftlichen Grundsätzen und Arbeitsgebieten, um seine theoretischen Positionen und sein Verständnis von Recht und Politik zu verstehen. Die Kapitelzusammenfassung verdeutlicht die Entwicklung von Mosers Denken und Wirken, bevor er in den Württembergischen Ständekonflikt involviert war.
III. Johann Jacob Moser im württembergischen Ständekonflikt: Dieses Kapitel beschreibt Mosers aktive Rolle im württembergischen Ständekonflikt, beginnend mit seinen frühen Jahren im Amt bis zu seinem Rückzug. Es analysiert den chronologischen Verlauf des Konflikts, Mosers Positionen und seine Beziehungen zu den beteiligten Parteien, sowie die Gründe für sein letztendliches Scheitern. Es analysiert Mosers eigenes Verständnis seiner Rolle im Konflikt, seine Kritik am Engeren Ausschuss, und die unterschiedlichen Interpretationen seines Verhaltens durch die Nachwelt. Das Kapitel betont die komplexen Ursachen für Mosers Misserfolg, die weit über eine einfache Darstellung von "Erfolg" und "Niederlage" hinausgehen.
Schlüsselwörter
Johann Jacob Moser, Württembergischer Ständekonflikt, Landstände, Herzog Carl Eugen, Rechtsberater, Pietismus, Staatsrecht, Konfliktlösung, Persönlichkeit, politisches Scheitern.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Johann Jacob Moser im württembergischen Ständekonflikt
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Gründe für den Verlust des Amtes von Johann Jacob Moser als Rechtsberater der württembergischen Landstände während des Ständekonflikts im 18. Jahrhundert. Sie hinterfragt die gängige Darstellung Mosers als reinen Märtyrer und beleuchtet seine komplexe Rolle im Konflikt, mit Fokus auf persönlichen Faktoren, die zu seinem Scheitern beitrugen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Funktionsweise und Rechtsstellung der württembergischen Landstände im 18. Jahrhundert, das Leben und Werk von Johann Jacob Moser, den Verlauf des württembergischen Ständekonflikts, Mosers Verhältnis zu den Landständen und Herzog Carl Eugen, sowie eine Analyse von Mosers Persönlichkeit und deren Einfluss auf sein Handeln.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in drei Kapitel: Kapitel I beschreibt die Landstände und den Herzog im Württemberg des 18. Jahrhunderts, inklusive der Zusammensetzung, der Rechte und des Verhältnisses zwischen Herzog und Landständen. Kapitel II beleuchtet Leben und Werk Johann Jacob Mosers, seine Ausbildung, seine Tätigkeiten und seine wissenschaftlichen Grundsätze. Kapitel III analysiert Mosers Rolle im württembergischen Ständekonflikt, den chronologischen Verlauf, seine Positionen und die Gründe für sein Scheitern, inklusive seiner eigenen Bewertung und der Interpretationen seines Verhaltens durch die Nachwelt.
Welche Rolle spielte Johann Jacob Moser im Ständekonflikt?
Johann Jacob Moser war Rechtsberater der württembergischen Landstände. Die Arbeit untersucht seine aktive Rolle im Konflikt, seine Positionen und Beziehungen zu den beteiligten Parteien, sowie die komplexen Ursachen für sein letztendliches Scheitern, die über eine einfache Darstellung von "Erfolg" und "Niederlage" hinausgehen.
Welche Quellen werden verwendet?
Die genaue Quellenangabe ist nicht in diesem Preview enthalten. Der Preview umfasst lediglich eine Übersicht über den Inhalt der Arbeit.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit hinterfragt die vereinfachte Darstellung Mosers als Märtyrer und zeigt die Komplexität seiner Rolle im Konflikt auf. Die genauen Schlussfolgerungen sind nicht im Preview enthalten.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Johann Jacob Moser, Württembergischer Ständekonflikt, Landstände, Herzog Carl Eugen, Rechtsberater, Pietismus, Staatsrecht, Konfliktlösung, Persönlichkeit, politisches Scheitern.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für akademische Zwecke gedacht, um die Themen im Kontext des württembergischen Ständekonflikts strukturiert und professionell zu analysieren.
Wo finde ich den vollständigen Text?
Der vollständige Text ist nicht in diesem Preview enthalten. Weitere Informationen zum Zugriff auf die vollständige Arbeit sind nicht verfügbar.
- Citation du texte
- B. A. Alexander Lauer (Auteur), 2017, "Recht ist bey mir Recht, und Unrecht ist Unrecht". Johann Jacob Mosers unpolitisches Verhalten während des württembergischen Ständekonflikts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/535729