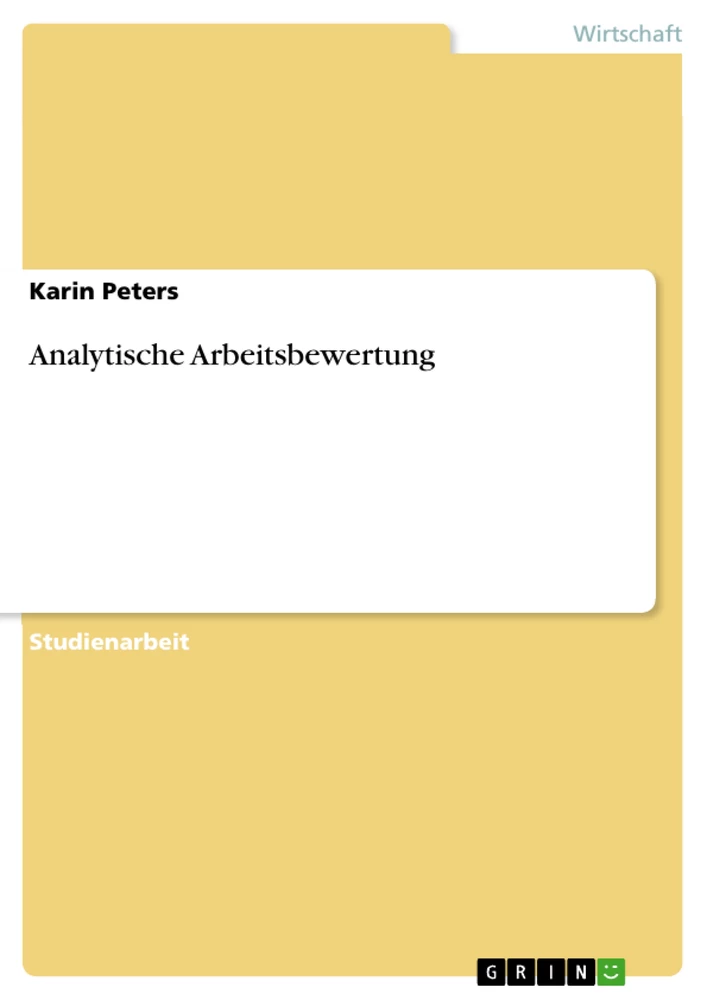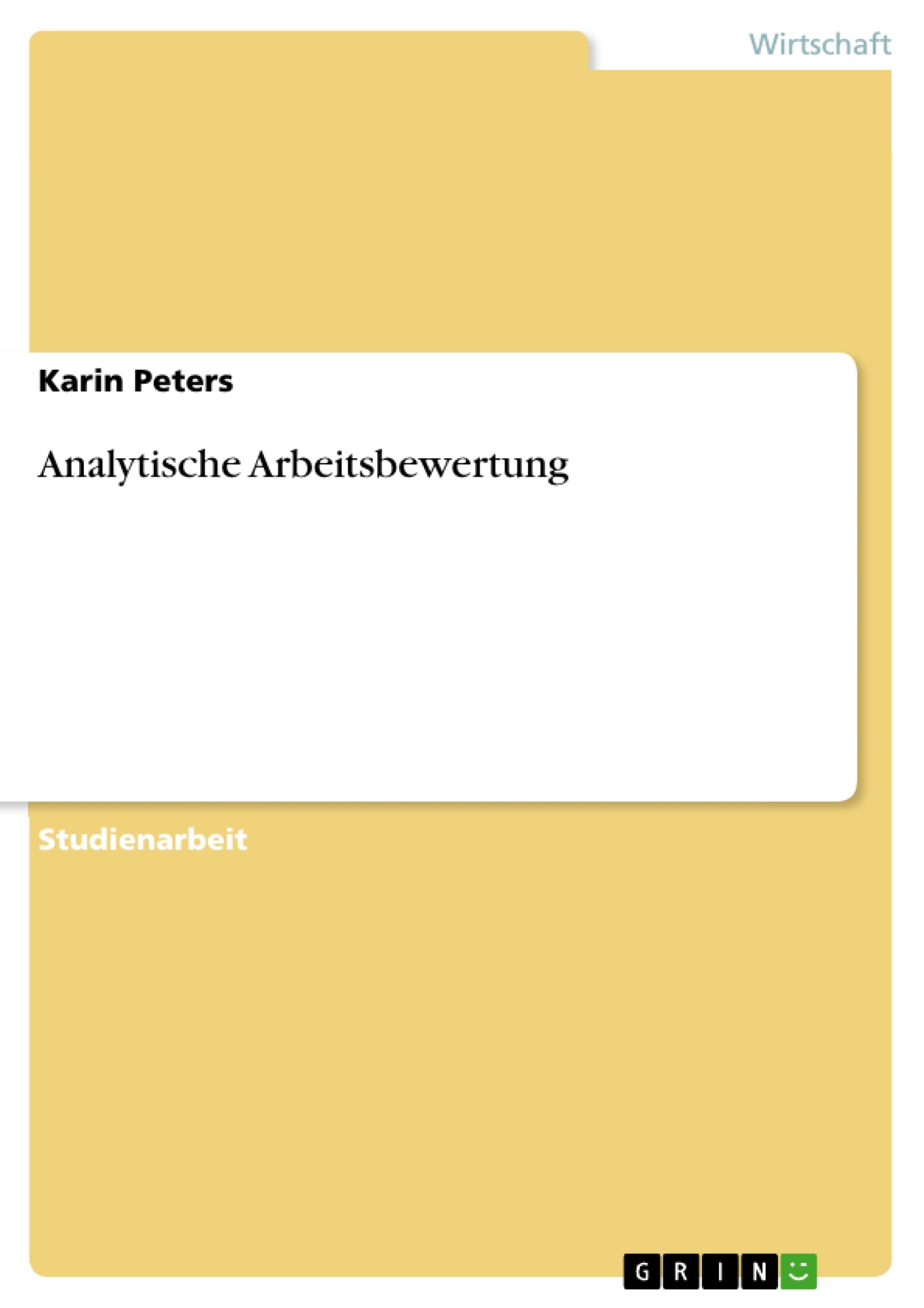Wie fast alles in Deutschland, wird die Pflicht zur Entlohnung von Arbeit per Gesetz geregelt. Das Bürgerliche Gesetzbuch übernimmt diese Aufgabe mit dem § 611. Demnach besteht die Hauptpflicht seitens des Arbeitgebers darin, die „vereinbarte Vergütung“ zu leisten. Im Gegenzug hierzu hat der Arbeitnehmer die dafür versprochene Arbeitsleistung zu erbringen. Die Personalentlohnung steht daher im Mittelpunkt. Mit ihr sollte jedoch nicht nur die Arbeitsleistung des Arbeitnehmers vergütet werden, sie hat auch die Aufgabe, dem Arbeitnehmer als Anreiz zu dienen. In jedem Fall ist es so, dass eine empfundene Lohngerechtigkeit starken Einfluss auf das Leistungsverhalten eines Arbeitnehmers hat. Denn wie Wöhe betont, begründet sich eine effiziente Leistungserstellung in der Motivation der Mitarbeiter (vgl. Wöhe, Günther 2000, S. 254).
Aus betriebswirtschaftlicher Sicht hat der Arbeitgeber natürlich das Ziel der Gewinnmaximierung vor Augen. Dennoch lässt sich diese langfristig nur dann erreichen, wenn seine Lohnempfänger auch entsprechend zur Arbeitsbereitschaft motiviert sind. Hier sieht man deutlich, dass die beiden augenscheinlich gegnerischen Parteien, den als für beide Seiten gerecht empfundenen Lohn zum Ziel haben.
Ein Arbeitsbewertungsverfahren, das von beiden Seiten als gerecht und sinnvoll empfunden wird, könnte diesen immerwährenden Konflikt zwischen Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften entschärfen. Die Arbeitsbewertung stützt sich dabei auf die Bewertung der Arbeitsschwierigkeit, unabhängig von der Person, die sie ausführt (vgl. Bisani, Fritz 1995, S. 439): Also wird die geforderte Arbeitsleistung somit normiert und der Mensch, welcher die Arbeit zu erbringen hat, wird zunächst nicht betrachtet. In der Vergangenheit haben sich zwei Verfahren zur Arbeitsbewertung herausgebildet, die summarische und die analytische Arbeitsbewertung.
Wie aktuell dieser Konflikt ist, wird uns durch die Tarifverhandlungen in der Metallbranche vor Augen geführt. Denn eine einmal vereinbarte Entlohnung muss stets den veränderten Bedingungen angepasst werden, damit sie auch weiterhin als gerecht empfunden wird und in ausreichendem Maße zur Motivation beiträgt.
Die vorliegende Hausarbeit soll nicht nur die Methoden der analytischen Arbeitsbewertung aufzeigen, sondern sie soll zur verständlicheren und vollständigeren Darstellung auch Thematiken wie Entgelt, Entgeltformen, Lohngerechtigkeit und vor allem die summarische Arbeitsbewertung beinhalten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Entgeltarten und -formen sowie die Differenzierung zwischen Lohn und Gehalt
- Entgeltgerechtigkeit und die motivationalen Wirkungen des Entgelts
- Der Ablauf der Arbeitsbewertung
- Das Genfer Schema
- Die Stellenbeschreibung als Grundlage für den Entgeltfindungsprozess
- Die summarische Arbeitsbewertung
- Das Rangfolgeverfahren
- Das Katalog- bzw. Lohngruppenverfahren
- Die Probleme und Grenzen der summarischen Arbeitsbewertung
- Die analytische Arbeitsbewertung
- Die Anforderungsarten
- Die Gewichtung
- Das Rangreihenverfahren
- Das Stufenwertzahlverfahren
- Schlusswort: Probleme und Grenzen der analytischen Arbeitsbewertung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Arbeit ist es, die Methoden der analytischen Arbeitsbewertung aufzuzeigen und zu erläutern. Darüber hinaus sollen Thematiken wie Entgelt, Entgeltformen, Lohngerechtigkeit und die summarische Arbeitsbewertung zur verständlicheren und vollständigeren Darstellung mit einbezogen werden.
- Entgeltarten und -formen: Definition und Unterscheidung zwischen Lohn und Gehalt
- Entgeltgerechtigkeit und ihre motivationalen Wirkungen
- Der Ablauf der Arbeitsbewertung: Genfer Schema und Stellenbeschreibung
- Die summarische Arbeitsbewertung: Rangfolgeverfahren, Katalogverfahren und deren Probleme
- Die analytische Arbeitsbewertung: Anforderungsarten, Gewichtung, Rangreihenverfahren und Stufenwertzahlverfahren
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Das Kapitel beschreibt die rechtliche Grundlage der Entlohnung von Arbeit in Deutschland und die Bedeutung der Entgeltfindung für die Motivation der Arbeitnehmer. Es wird der Konflikt zwischen Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften in Bezug auf die Entlohnung beleuchtet und die Entstehung der summarischen und analytischen Arbeitsbewertung als Lösungsansätze dargestellt.
- Entgeltarten und -formen sowie die Differenzierung zwischen Lohn und Gehalt: Das Kapitel beschäftigt sich mit der Unterscheidung zwischen Naturallohn und monetärem Entgelt. Es wird betont, dass die Entlohnung nicht nur die Arbeitsleistung vergüten, sondern auch als Anreiz dienen soll. Weiterhin werden verschiedene Entgeltarten und die daraus resultierenden Entgeltformen, wie Lohn für Arbeiter, Gehalt für Angestellte und Besoldung für Beamte, vorgestellt. Die historische Unterscheidung zwischen Lohn und Gehalt wird dargelegt, jedoch auch die zunehmende Verschmelzung dieser beiden Entgeltbereiche im Zuge des technologischen Fortschritts und gesellschaftlichen Wandels.
- Entgeltgerechtigkeit und die motivationalen Wirkungen des Entgelts: Dieses Kapitel beleuchtet die Bedeutung von Entgeltzufriedenheit für die Motivation der Arbeitnehmer. Es wird die Optimierung der relativen Entgeltzufriedenheit im Vergleich zu anderen Mitarbeitern gleicher oder ähnlicher Qualifikation, Leistung und Anforderungen betont. Der gesellschaftliche Wertewandel im Laufe der Zeit wird diskutiert und die Bedeutung von Konsum, Prestige, Selbstverwirklichung und Identifikation mit der Arbeit im Hinblick auf die Motivation der Arbeitnehmer hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Entgeltfindung, Arbeitsbewertung, Lohngerechtigkeit, Motivation, Anreizsysteme, summarische Arbeitsbewertung, analytische Arbeitsbewertung, Genfer Schema, Rangfolgeverfahren, Katalogverfahren, Anforderungsarten, Gewichtung, Rangreihenverfahren und Stufenwertzahlverfahren. Dabei steht die Frage nach einer gerechten und effizienten Entlohnung von Arbeitsleistung im Vordergrund.
- Quote paper
- Dipl.-Betriebswirtin Karin Peters (Author), 2005, Analytische Arbeitsbewertung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/52432