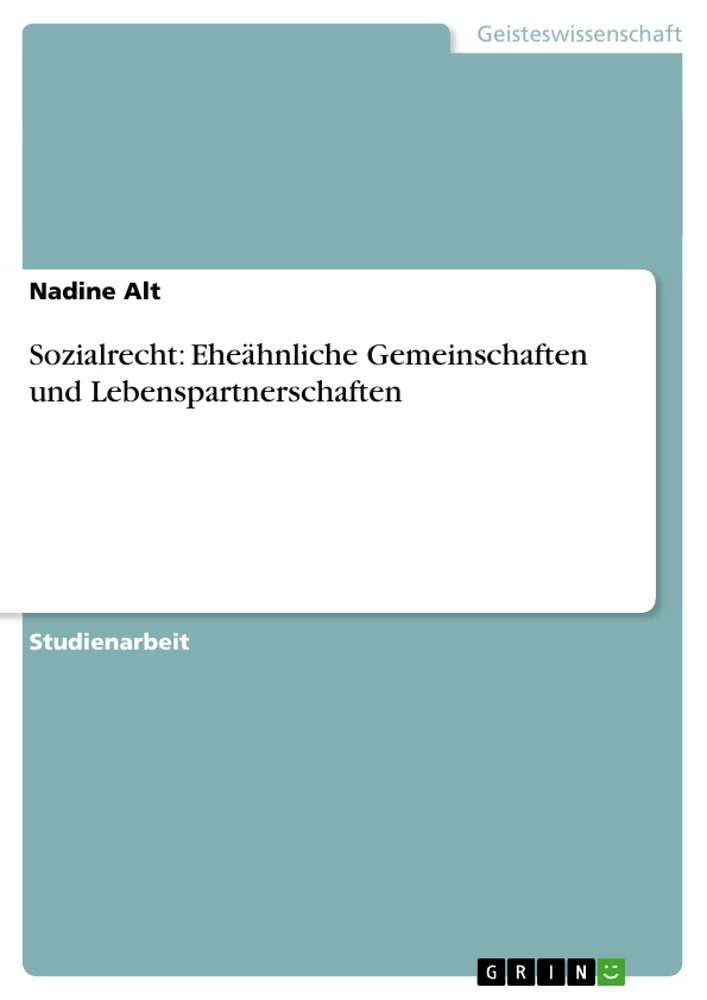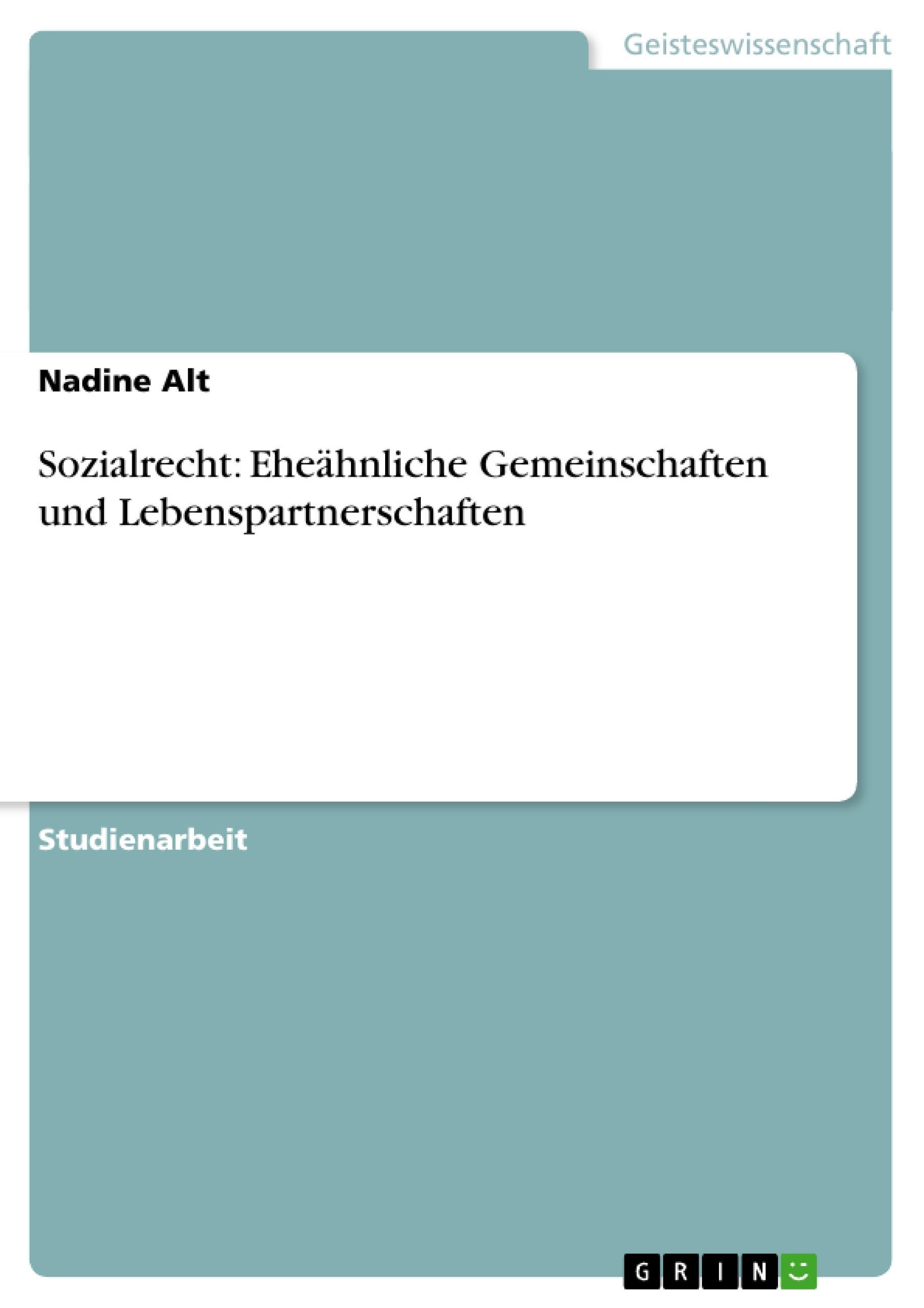Mehr als 10% aller Paare in Deutschland leben in nicht-ehelichen Lebensgemeinschaften. Etwa die Hälfte aller eheähnlichen Gemeinschaften münden in der Ehe. Eine eheähnliche Gemeinschaft zwischen Mann und Frau besteht, wenn es sich um eine auf Dauer angelegte Lebensgemeinschaft handelt, die sich im Sinne einer Verantwortungs- und Einstehensgemeinschaft durch innere Bindung auszeichnet und die ein gegenseitiges Einsetzten der Partner füreinander begründet.
Nach der Rechtsprechung des BverfG dürfen eheähnliche Gemeinschaften zwischen Männern und Frauen nicht besser gestellt werden, als Ehen. Auch für den sozialrechtlichen Bereich gilt, dass Ehen und Familien wegen Art.6 Abs. 1 GG nicht schlechter gestellt werden dürfen, als nicht verheiratete Lebenspartner.
„Personen, die in eheähnlicher Gemeinschaft leben, dürfen hinsichtlich der Voraussetzungen sowie des Umfanges der Sozialhilfe nicht besser gestellt werden als Ehegatten.“
Für die Zusammenlebenden ist es von Vorteil, nicht als eheähnliche Gemeinschaft eingestuft zu werden, da der Hilfebedürftige höhere Leistungen bezieht, wenn keine eheähnliche Gemeinschaft angenommen wird. Falls einer der Partner erwerbstätig ist, kommt hinzu, dass sein Verdienst oberhalb eines niedrigen Freibetrages vom Gesamtanspruch abgezogen wird. Der erwerbstätige Partner muss somit nach § 19 SGB XII für den Lebensunterhalt des hilfebedürftigen Partners aufkommen. Wenn hingegen keine eheähnliche Gemeinschaft angenommen wird, bekommt der Nachfragende den vollen Regelsatz und der vermögende Partner kann nicht herangezogen werden.
Inhaltsverzeichnis
- I. Die eheähnliche Gemeinschaft
- 1.1 Der Begriff der eheähnlichen Gemeinschaft
- 1.2 Problematik
- 1.3 Die Beweispflicht der Behörden
- 1.4 Hinweistatsachen
- 1.4.1 Wohngemeinschaft
- 1.4.2 Wirtschaftsgemeinschaft
- 1.4.3 Verantwortungs- und Einstehensgemeinschaft
- 1.4.4 Enge Bindung
- 1.4.5 Sicherung des gemeinsamen Lebensunterhaltes
- 1.4.6 Konkrete Lebenssituation und Intensität der Gemeinschaft
- 1.5 Der Hausbesuch
- 1.6 Zusammenfassung
- II. Die Lebenspartnerschaft
- 2.1 Der Begriff der Lebenspartnerschaft
- 2.2 Geschichtliche Entstehung
- 2.3 Das Lebenspartnerschaftsgesetz
- 2.4 Unterscheidung eheähnliche Gemeinschaft und Lebenspartnerschaft
- III. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die sozialrechtliche Behandlung eheähnlicher Gemeinschaften und Lebenspartnerschaften. Ziel ist es, die Unterschiede und Gemeinsamkeiten beider Modelle im Kontext des Sozialhilferechts zu beleuchten und die Herausforderungen bei der Feststellung einer eheähnlichen Gemeinschaft für die Behörden zu analysieren.
- Definition und Abgrenzung eheähnlicher Gemeinschaften
- Beweispflicht der Behörden bei der Feststellung eheähnlicher Gemeinschaften
- Sozialrechtliche Konsequenzen der Anerkennung einer eheähnlichen Gemeinschaft
- Das Lebenspartnerschaftsgesetz und seine Auswirkungen
- Vergleich zwischen eheähnlicher Gemeinschaft und Lebenspartnerschaft
Zusammenfassung der Kapitel
I. Die eheähnliche Gemeinschaft: Dieses Kapitel definiert den Begriff der eheähnlichen Gemeinschaft und beleuchtet die damit verbundenen Problematiken. Es wird detailliert auf die Beweispflicht der Behörden eingegangen, welche Schwierigkeiten bei der Feststellung innerer Bindungen und der damit verbundenen wirtschaftlichen Aspekte aufweist. Die Bedeutung von Hinweistatsachen wie Wohngemeinschaft, Wirtschaftsgemeinschaft, Verantwortungs- und Einstehensgemeinschaft sowie die enge Bindung der Partner werden ausführlich erörtert. Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und die damit verbundene Abkehr von rein wirtschaftlichen Kriterien werden dargestellt und ihre Auswirkungen auf die Sozialhilfeleistungen analysiert. Der Hausbesuch als Mittel der Ermittlung wird ebenfalls thematisiert.
II. Die Lebenspartnerschaft: Dieses Kapitel widmet sich dem Begriff der Lebenspartnerschaft, ihrer geschichtlichen Entwicklung und dem Lebenspartnerschaftsgesetz. Es wird ein Vergleich zwischen der eheähnlichen Gemeinschaft und der Lebenspartnerschaft im sozialrechtlichen Kontext gezogen, wobei die Unterschiede in der rechtlichen Anerkennung und den daraus resultierenden Konsequenzen für die Sozialhilfeleistungen im Vordergrund stehen. Die Kapitel untersucht, wie das Lebenspartnerschaftsgesetz die rechtliche Situation gleichgeschlechtlicher Paare verändert und welche Auswirkungen dies auf die Sozialhilfe hat.
Schlüsselwörter
Eheähnliche Gemeinschaft, Lebenspartnerschaft, Sozialhilfe, SGB XII, Beweispflicht, Behörden, Rechtsprechung, Bundesverfassungsgericht, Wirtschaftsgemeinschaft, Verantwortungsgemeinschaft, Lebensunterhalt, Sozialrecht.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Eheähnliche Gemeinschaften und Lebenspartnerschaften im Sozialrecht
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die sozialrechtliche Behandlung eheähnlicher Gemeinschaften und Lebenspartnerschaften. Sie beleuchtet die Unterschiede und Gemeinsamkeiten beider Modelle im Kontext des Sozialhilferechts und analysiert die Herausforderungen bei der Feststellung einer eheähnlichen Gemeinschaft für die Behörden.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition und Abgrenzung eheähnlicher Gemeinschaften, die Beweispflicht der Behörden bei deren Feststellung, die sozialrechtlichen Konsequenzen der Anerkennung einer eheähnlichen Gemeinschaft, das Lebenspartnerschaftsgesetz und seine Auswirkungen sowie einen Vergleich zwischen eheähnlicher Gemeinschaft und Lebenspartnerschaft.
Wie wird der Begriff der "eheähnlichen Gemeinschaft" definiert und welche Problematiken sind damit verbunden?
Kapitel I definiert den Begriff der eheähnlichen Gemeinschaft und erörtert die Schwierigkeiten bei der Feststellung. Die Beweispflicht der Behörden, die Auslegung von Hinweistatsachen (Wohngemeinschaft, Wirtschaftsgemeinschaft, Verantwortungs- und Einstehensgemeinschaft, enge Bindung, Sicherung des gemeinsamen Lebensunterhalts) und die Berücksichtigung der konkreten Lebenssituation werden detailliert analysiert. Der Hausbesuch als Ermittlungsmittel wird ebenfalls thematisiert.
Welche Rolle spielt die Beweispflicht der Behörden bei der Feststellung einer eheähnlichen Gemeinschaft?
Die Beweispflicht der Behörden stellt eine zentrale Herausforderung dar. Die Seminararbeit untersucht, wie die Behörden die inneren Bindungen und die damit verbundenen wirtschaftlichen Aspekte nachweisen müssen und welche Schwierigkeiten sich dabei ergeben. Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und deren Auswirkungen auf die Sozialhilfeleistungen werden ebenfalls beleuchtet.
Was ist das Lebenspartnerschaftsgesetz und wie unterscheidet es sich von der eheähnlichen Gemeinschaft?
Kapitel II befasst sich mit dem Lebenspartnerschaftsgesetz, seiner geschichtlichen Entwicklung und seinen Auswirkungen. Es wird ein Vergleich zwischen der eheähnlichen Gemeinschaft und der Lebenspartnerschaft im sozialrechtlichen Kontext gezogen, wobei die Unterschiede in der rechtlichen Anerkennung und den daraus resultierenden Konsequenzen für die Sozialhilfeleistungen im Vordergrund stehen. Die Auswirkungen auf die Sozialhilfe für gleichgeschlechtliche Paare werden analysiert.
Welche Schlüsselwörter sind für die Seminararbeit relevant?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Eheähnliche Gemeinschaft, Lebenspartnerschaft, Sozialhilfe, SGB XII, Beweispflicht, Behörden, Rechtsprechung, Bundesverfassungsgericht, Wirtschaftsgemeinschaft, Verantwortungsgemeinschaft, Lebensunterhalt, Sozialrecht.
Welche Kapitel umfasst die Seminararbeit und worum geht es in den einzelnen Kapiteln?
Die Arbeit gliedert sich in drei Kapitel: Kapitel I behandelt die eheähnliche Gemeinschaft, Kapitel II die Lebenspartnerschaft und Kapitel III bildet den Schluss. Die Kapitelzusammenfassungen bieten detaillierte Informationen zu den jeweiligen Inhalten.
- Citar trabajo
- Nadine Alt (Autor), 2006, Sozialrecht: Eheähnliche Gemeinschaften und Lebenspartnerschaften, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/52371