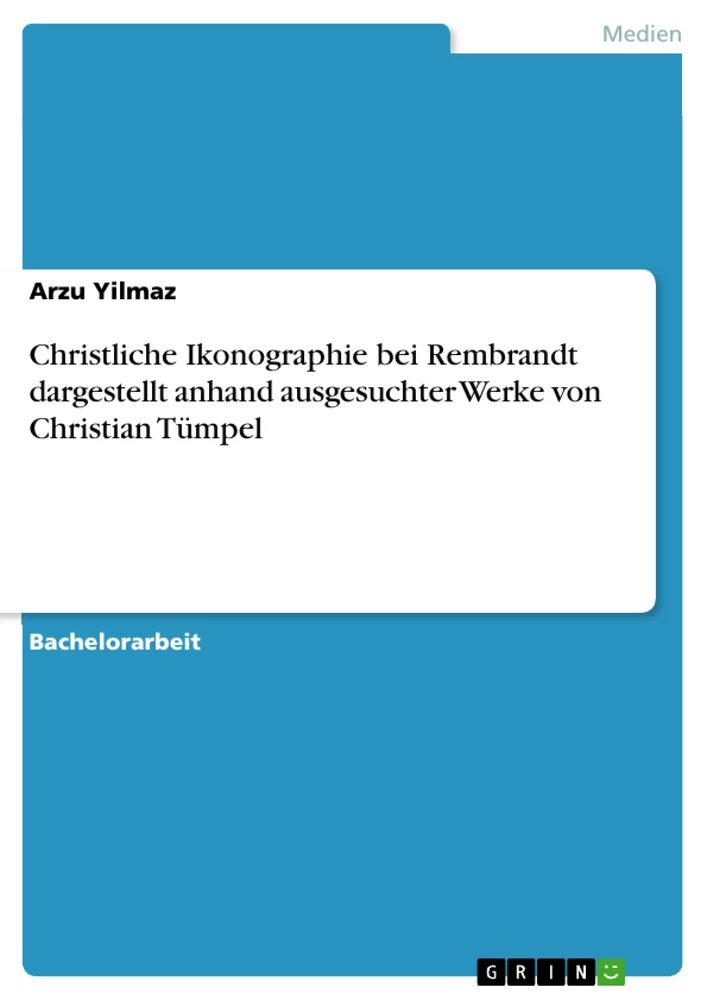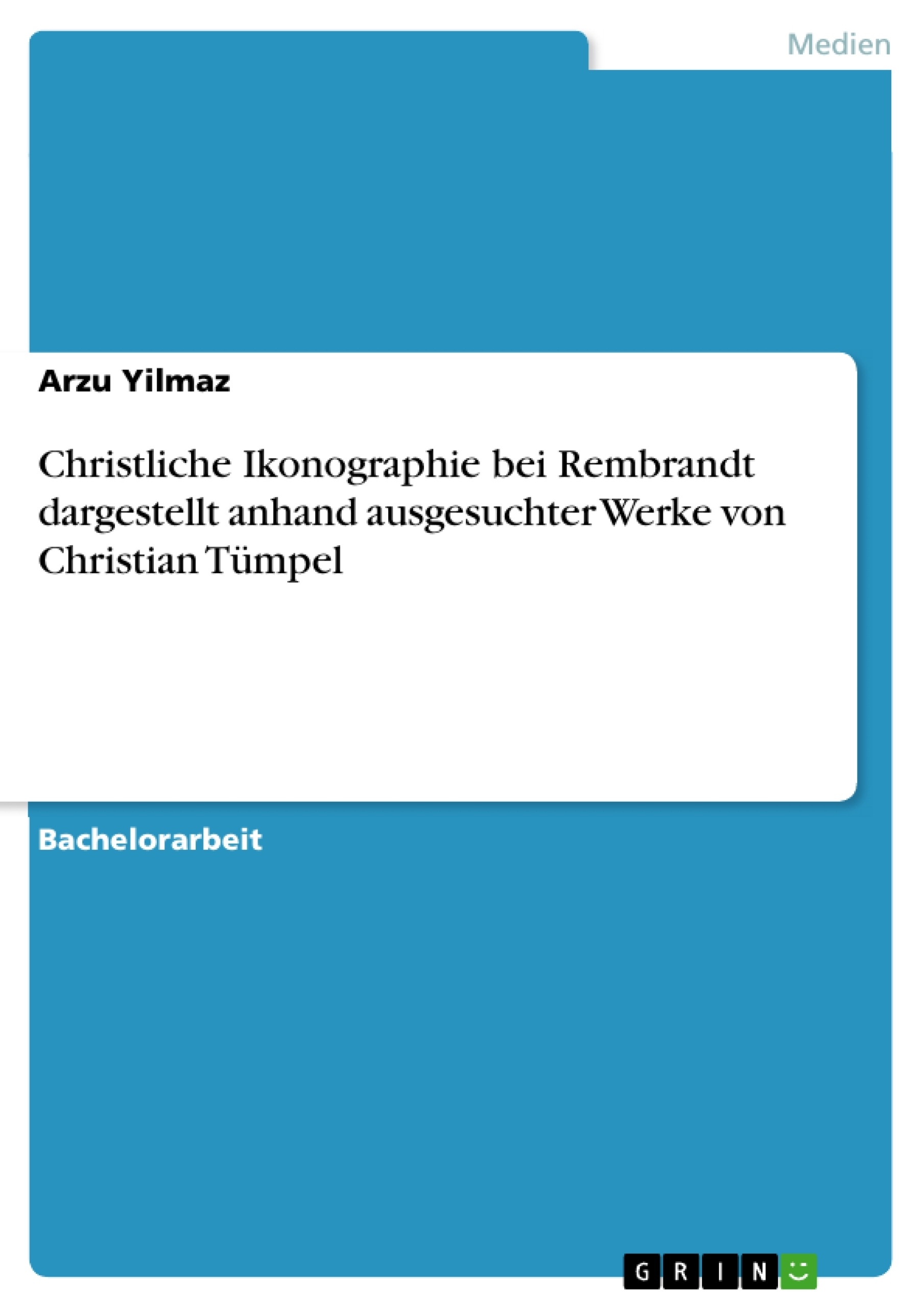"„Rembrandt-Entmythologisierung“ – heißt das Schlagwort der Stunde. Man wünscht Objektivität in jeder Hinsicht, und auch die Echtheitskritik will sich in den Dienst der Bestrebungen stellen. Was die Interpretation betrifft, werden die zeitbedingten oder individuellen Deutungen der Persönlichkeit Rembrandts und seiner Kunst zurückgewiesen. Nur historische Wahrheit soll gelten. Demgemäß geht es darum, das Oeuvre des Meisters von allen trübenden Bestandteilen, von Schülerarbeiten und Imitationen, zu reinigen. Denn es herrscht die Überzeugung, daß die Leistungen der Echtheitskritik, an den Fortschritten ikonographischer, lebens- und wirkungsgeschichtlicher Forschung gemessen, äußerst bescheiden waren."
Was hier m. E. nach mit viel Unmut von dem Kunsthistoriker Werner Sumowski festgestellt wird, nämlich daß die Werke Rembrandts und sein künstlerisches Schaffen objektiv zu betrachten seien, hat dazu geführt, daß viele Werke des Künstlers richtig gedeutet und ihm entweder zugesprochen oder abgesprochen wurden. Der Rembrandt – Forschung ist es im Laufe des 20. Jahrhunderts, dank einer moderneren Betrachtungsweise der Kunstwissenschaft, gelungen, Rembrandt von Mythen und Legenden, die ihn umrankten, größtenteils zu befreien. Von den 700 Gemälden, die dem Meister aus Leiden zugeschrieben wurden, sind es noch rund 300, die er gemalt haben soll. Diese Untersuchungsergebnisse resultieren aus wissenschaftlichen Methoden wie Röntgenstrahlen und Infrarot- und Farbanalyse, die in der Forschung angewendet werden. Vor allem arbeitet das Rembrandt Research Project (RRP) u.a. mit diesen Methoden. Das RRP besteht aus einer Gruppe von Kunsthistorikern, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, nach objektiven Untersuchungen der malerischen Fakten die eigenhändigen Werke von Rembrandt aus den Unmengen von Gemälden herauszufiltern, die unter seinem Namen bekannt sind. Jedoch sind es nicht nur die naturwissenschaftlichen Methoden gewesen, die Erkenntnisse in Rembrandts Oeuvre gebracht haben, sondern auch die zeitgenössischen Urkunden und viele weitere Quellen (wie z.B. Bilder anderer Künstler, die vor oder zeitgleich mit ihm gewirkt hatten) aus Archiven und Bibliotheken. Diese gewährten einen besseren Einblick in Rembrandts Leben, seine Persönlichkeit, seine Vorgehensweise und über sein soziales Leben. Dadurch, daß man Rembrandt näher „kennengelernt“ hatte, war man in der Lage, Bildinhalte zu erkennen und zu deuten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Zusammenfassender Überblick der Werke Tümpels
- 2.1. Tümpels Thesen zusammengefaßt
- 2.2.1. Simultan – Darstellungen
- 2.2.2. Herauslösung
- 3. Diskussion über die „Eigentümlichkeit“ Rembrandts
- 3.1. Rembrandts Lehrer und die sog. Prärembrandtisten
- 3.1.1. Rembrandts Lehrer: Jacob Isaacz. van Swanenburgh
- 3.1.2. Rembrandts Lehrer: Pieter Lastman
- 3.1.2. Die „Prärembrandtisten“
- 4. Die Ikonographie Rembrandts
- 4.1. Die Barockikonographie
- 5. Vergleich und Analyse der Werke Christian Tümpels / Schlußbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit „Christliche Ikonographie bei Rembrandt: Dargestellt anhand ausgesuchter Werke von Christian Tümpel“ befasst sich mit dem Werk des niederländischen Malers Rembrandt van Rijn und analysiert dessen ikonographische Gestaltung anhand der Interpretationen von Christian Tümpel. Die Arbeit verfolgt das Ziel, Tümpels Thesen und Analysen zu präsentieren und deren Beitrag zur Rembrandt-Forschung aufzuzeigen.
- Die Entwicklung der Ikonographie in der Kunst Rembrandts
- Die Interpretation und Deutung der Bildinhalte in Rembrandts Werken
- Die Bedeutung von Rembrandts Maltechniken (Simultandarstellung, Herauslösung)
- Die Einbettung von Rembrandts Werken in eine literarisch-religiöse Tradition
- Der Vergleich und die Analyse von Rembrandts Werken im Kontext der Barockikonographie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und beleuchtet den aktuellen Stand der Rembrandt-Forschung. Sie fokussiert auf die Bedeutung von Objektivität und die Herausforderungen bei der Interpretation von Rembrandts Kunst. Kapitel 2 bietet einen Überblick über die Werke von Christian Tümpel und stellt dessen wichtige Thesen zusammen. Es werden insbesondere die Maltechniken der Simultandarstellung und der Herauslösung im Werk Rembrandts diskutiert.
Kapitel 3 befasst sich mit dem Mythos der „Eigentümlichkeit“ Rembrandts und prüft verschiedene Ansichten aus der Rembrandt-Forschung des 19. und 20. Jahrhunderts. Es werden Rembrandts Lehrer und die „Prärembrandtisten“ kurz vorgestellt, um zu zeigen, dass Rembrandt von anderen Künstlern beeinflusst wurde.
Kapitel 4 widmet sich dem Hauptthema der Arbeit: der Ikonographie Rembrandts. Es untersucht die Entwicklung der Darstellung biblischer Themen in der Kunst und geht der Frage nach, welche Vorlagen Rembrandt für seine Werke nutzte und wie er biblische Inhalte dargestellt hat.
Kapitel 5 bietet einen Vergleich und eine Analyse der Werke von Christian Tümpel und stellt eine Schlussbetrachtung der Arbeit dar. Dieser Teil der Arbeit enthält jedoch keine Details und sollte daher nicht in der Vorschau aufgeführt werden.
Schlüsselwörter
Die Arbeit „Christliche Ikonographie bei Rembrandt: Dargestellt anhand ausgesuchter Werke von Christian Tümpel“ befasst sich mit den Schlüsselthemen Ikonographie, Rembrandt, Maltechnik, Simultan-Darstellung, Herauslösung, Barockkunst, religiöse Bildsprache und Christian Tümpel. Die Analyse der Bildinhalte in Rembrandts Werken führt die Relevanz der ikonographischen Forschung für ein tieferes Verständnis von Kunst und Kultur vor Augen.
- Quote paper
- Arzu Yilmaz (Author), 2005, Christliche Ikonographie bei Rembrandt dargestellt anhand ausgesuchter Werke von Christian Tümpel, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/52340