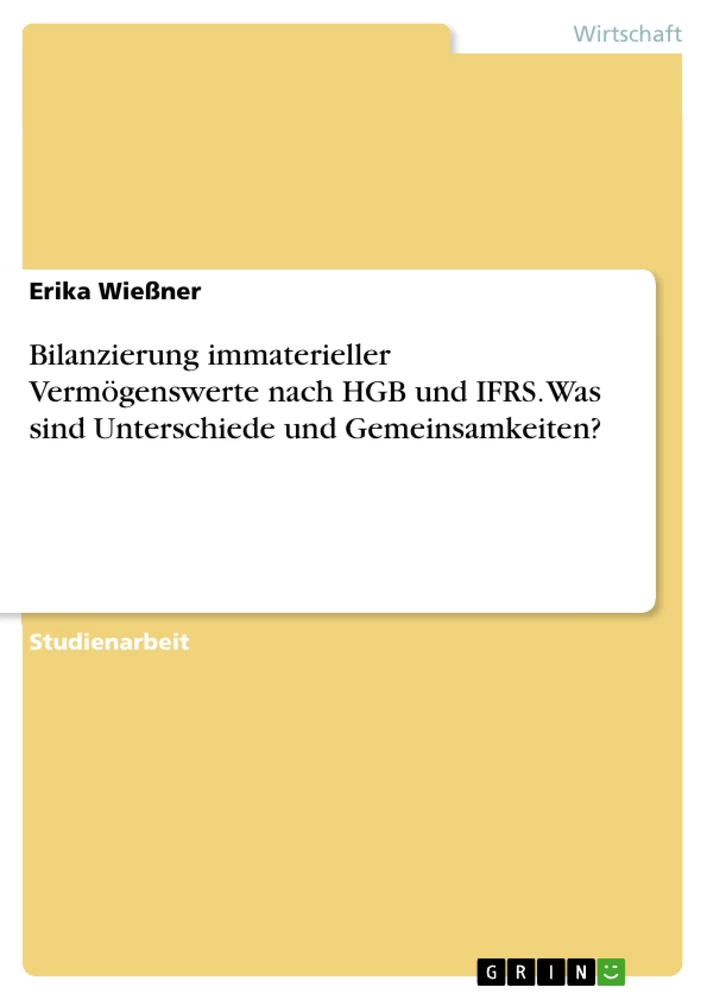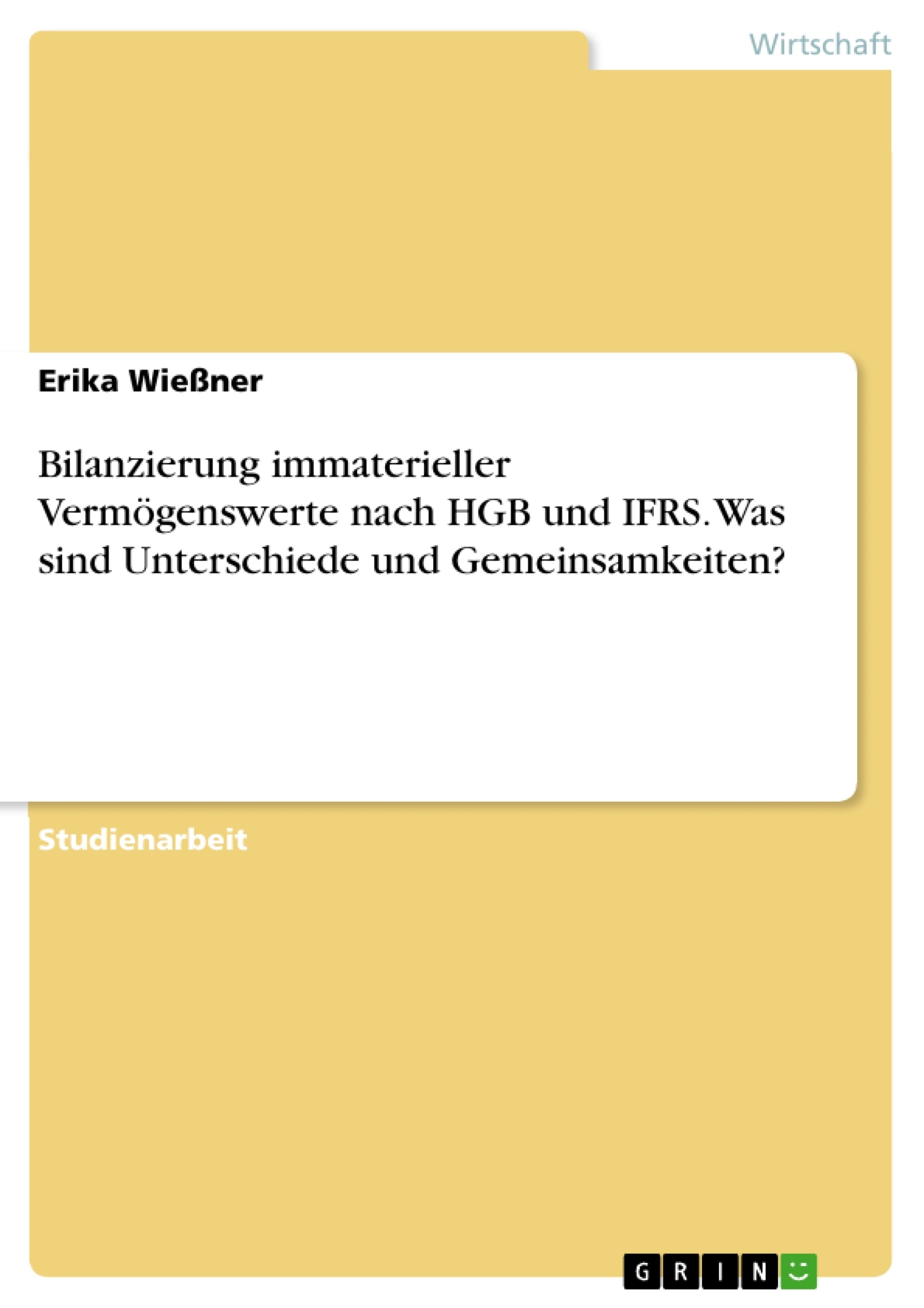Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Bilanzierung immaterieller Vermögenswerte nach HGB und IFRS zu analysieren und zu erläutern.
Immateriellen Vermögenswerten kommt in der Wirtschaft als Werttreiber für Unternehmen eine zentrale Bedeutung zu. Bei deutschen Unternehmen aus dem Medien-, Software- und Telekommunikationssektor liegt der durchschnittliche Anteil immaterieller Vermögenswerte an der Bilanzssume bei 40%. Beispiele für immaterielle Vermögenswerte sind Patente, Software, Ausgaben für Entwicklung, Kunden- und Lieferantenbeziehungen sowie der Markenname eines Unternehmens. Die herausragende Bedeutung immaterieller Vermögenswerte lässt sich anhand des US-amerikanischen Unternehmens Coca Cola verdeutlichen, dessen Markenname Coca-Cola auf über 70 Milliarden USD geschätzt wird.
Die Bilanzierung immaterieller Vermögenswerte nach nationalen und internationalen Standards wird zunehmend als unzulänglich kritisiert und vermehrt zur Diskussion über eine verbesserte Darlegung immaterieller Vermögenswerte im Jahresabschluss aufgerufen. Die letzte Reform des deutschen Handelsrechts fand im Jahr 2009 durch das Bilanzierungsmodernisierungsgesetz (BilMoG) statt. Mit dem BilMoG wollte der Gesetzgeber die Rechnungslegung des Handelsgesetzbuches (HGB) grundlegend weiterentwickeln und verändern. Sie sollte eine wettbewerbsfähige Alternative zur Bilanzierung nach den IFRS darstellen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition immaterieller Vermögenswerte nach HGB und IFRS
- Bilanzierung immaterieller Vermögenswerte nach HGB
- Aktivierungsvoraussetzungen
- Ansatz und Erstbewertung
- Folgebewertung
- Bilanzierung immaterieller Vermögenswerte nach IFRS
- Aktivierungsvoraussetzungen
- Ansatz und Erstbewertung
- Folgebewertung
- Wesentliche Unterschiede in der Bilanzierung immaterieller Vermögenswerte nach HGB und IFRS
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Bilanzierung immaterieller Vermögenswerte nach HGB und IFRS. Ziel ist es, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede dieser beiden Bilanzierungsstandards aufzuzeigen und zu analysieren. Dabei werden die Aktivierungsvoraussetzungen, der Ansatz und die Erst- und Folgebewertung von immateriellen Vermögenswerten im Detail betrachtet.
- Definition des Begriffs „immaterieller Vermögenswert“ nach HGB und IFRS
- Aktivierungsvoraussetzungen immaterieller Vermögenswerte nach HGB und IFRS
- Ansatz und Erstbewertung immaterieller Vermögenswerte nach HGB und IFRS
- Folgebewertung immaterieller Vermögenswerte nach HGB und IFRS
- Wesentliche Unterschiede in der Bilanzierung immaterieller Vermögenswerte nach HGB und IFRS
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Bedeutung immaterieller Vermögenswerte in der heutigen Wirtschaft und die aktuelle Diskussion um die Verbesserung der Bilanzierung dieser Werte. Anschließend werden im zweiten Kapitel die Definitionen des Begriffs „immaterieller Vermögenswert“ nach HGB und IFRS vorgestellt. Die Kapitel drei und vier widmen sich dann den Aktivierungsvoraussetzungen, dem Ansatz und der Erst- und Folgebewertung von immateriellen Vermögenswerten nach HGB und IFRS. Das fünfte Kapitel zeigt die wesentlichen Unterschiede in der Bilanzierung immaterieller Vermögenswerte nach HGB und IFRS auf. Das Fazit fasst die wichtigsten Ergebnisse und Erkenntnisse der Arbeit zusammen und gibt einen Ausblick für die Zukunft.
Schlüsselwörter
Immaterielle Vermögenswerte, Bilanzierung, HGB, IFRS, Aktivierungsvoraussetzungen, Ansatz, Erstbewertung, Folgebewertung, Unterschiede, Gemeinsamkeiten.
Häufig gestellte Fragen
Was sind immaterielle Vermögenswerte?
Dazu gehören nicht-physische Werte wie Patente, Software, Markenrechte, Lizenzen und Kundenbeziehungen.
Wie unterscheidet sich die Bilanzierung nach HGB und IFRS?
Ein wesentlicher Unterschied liegt in den Aktivierungswahlrechten für selbst geschaffene immaterielle Werte, die unter IFRS oft strenger oder anders geregelt sind als im HGB.
Was änderte das BilMoG für immaterielle Werte?
Mit dem Bilanzmodernisierungsgesetz (2009) wurde im HGB ein Aktivierungswahlrecht für selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens eingeführt.
Warum sind diese Werte für Medien- und Softwareunternehmen so wichtig?
In diesen Sektoren machen immaterielle Werte oft bis zu 40 % der Bilanzsumme aus, da sie die primären Werttreiber des Geschäftsmodells sind.
Wie erfolgt die Folgebewertung immaterieller Vermögenswerte?
Sie werden planmäßig über ihre Nutzungsdauer abgeschrieben. Bei dauerhafter Wertminderung müssen außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen werden.
- Quote paper
- Erika Wießner (Author), 2020, Bilanzierung immaterieller Vermögenswerte nach HGB und IFRS. Was sind Unterschiede und Gemeinsamkeiten?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/520362