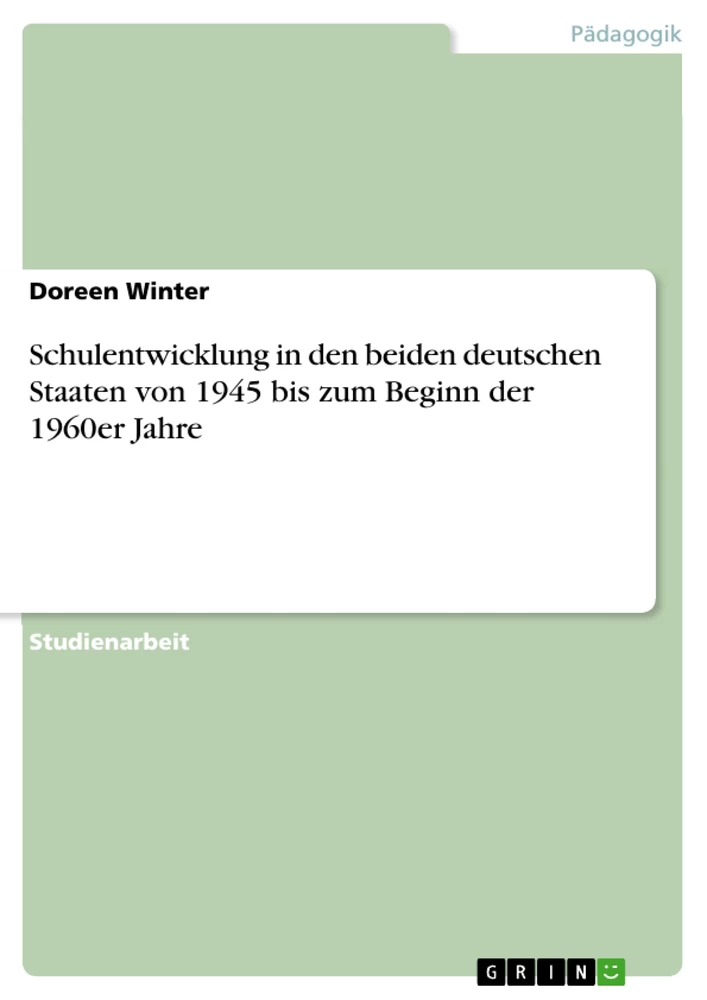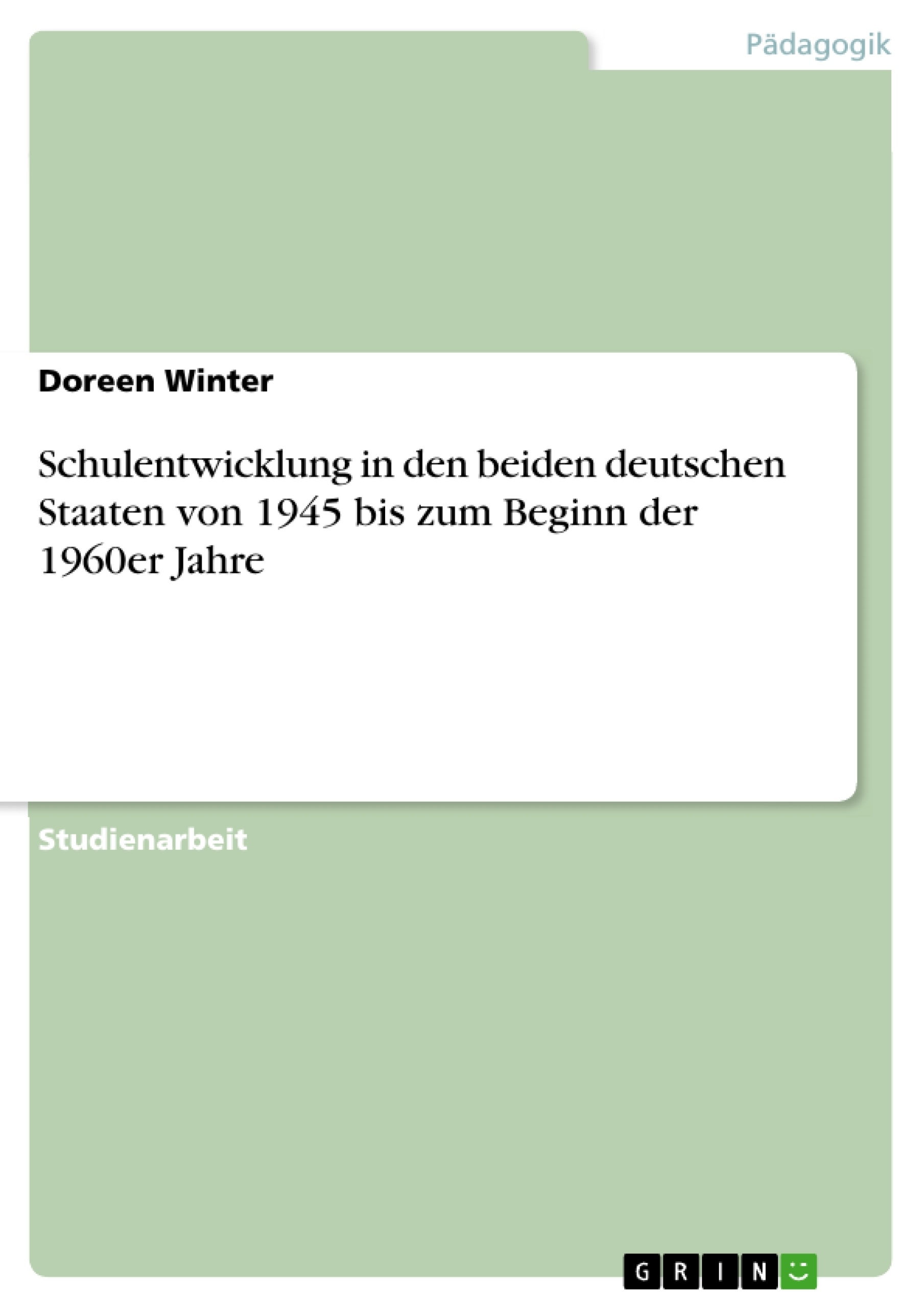Einleitung
Mit der Kapitulation der deutschen Streitkräfte am 7. und 8. Mai 1945 endete das „Großdeutsche Reich“. Zu der militärischen Niederlage kam eine gravierende Katastrophe für das deutsche Volk. Viele Menschen waren in den Kriegshandlungen ums Leben gekommen, befanden sich in Kriegsgefangenschaft oder waren schwer verletzt worden. Schon während des Krieges war die Armut der Menschen unermesslich geworden. Für sie begann ein Kampf um das bloße Überleben und die Sorge um die gesellschaftliche und wirtschaftliche Zukunft. In den meisten Stätten waren Schulen und Hochschulen zerstört, es mangelte an Unterrichtsräumen, Lehrern und Lehrmaterialien. Die einst so patriotischen nationalpolitischen Bildungsziele waren zerfallen. Deutschland musste wieder aufgebaut werden. Für die vier alliierten Besatzungsmächte hatte besonders der Aufbau eines demokratischen Bildungswesen, um eine „Umerziehung zur Demokratie“ zu vollziehen, ein sehr große Bedeutung.
Diese Arbeit befasst sich mit der Entwicklung des Schulwesens von 1945 bis zum Beginn der 1960er Jahre. Dabei soll vor allem die Frage, worin sich die Schulsysteme der beiden Staaten unterscheiden, beantwortet werden? Im Rahmen dieser Fragestellung soll zudem aufgezeigt werden, wie das Schulwesen nach dem 2. Weltkrieg wieder aufgebaut wurde, welche Probleme dabei eine Rolle spielten und wie die Schulsysteme weiterentwickelt wurden. Weil vor allem die Entwicklungen im Schulwesen im Mittelpunkt dieser Arbeit stehen sollen, kann nur andeutungsweise auf die politischen Entwicklungen, sowie die Gründungen der Parteien und der daraus resultierenden Machtveränderungen, eingegangen werden. Auch das Hochschulwesen, die berufliche Ausbildung, die Sonderschulen für Behinderte sowie Reformansätze für das Schulwesen, können hier nur am Rande erwähnt werden. Diese Arbeit gliedert sich in zwei Phasen, die zudem in verschiedene Unterpunkte unterteilt sind. In jedem der Gliederungspunkte wird zunächst auf die Gesamtsituation der beiden Staaten eingegangen, um in den darauf folgenden Unterpunkten detaillierte Aussagen über die Entwicklungen in jeweils einem der beiden Staaten zu treffen. In einem ersten Punkt, werden die Periodeneinteilung und die damit verbundenen Schwierigkeiten thematisiert. Außerdem wird vor allem dort das methodische Vorgehen des Vergleiches, der unterschiedlich verlaufenden Entwicklungen bezüglich des Schulwesens in den beiden Staaten, festgelegt...
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Periodeneinteilung
- Die erste Phase: Nachkriegssituation und Weichenstellung 1945 bis 1949
- Das Vorgehen der westlichen drei Besatzungsmächte
- Das gegliederte Schulwesen
- Die Wiedereröffnung der Schulen in der sowjetischen Besatzungszone
- „Gesetz zur Demokratisierung der Deutschen Schule“ (1946)
- Die Währungsreformen und die Gründung der beiden deutschen Staaten
- Das Vorgehen der westlichen drei Besatzungsmächte
- Die zweite Phase: 1949 bis 1961/1962
- Vereinheitlichung auf dem Gebiet des Schulwesens
- Das Düsseldorfer Abkommen
- Der Aufbau der sozialistischen Schule in der Deutschen Demokratischen Republik
- Die polytechnische Bildungsreform
- Vereinheitlichung auf dem Gebiet des Schulwesens
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Entwicklung des Schulwesens in Deutschland von 1945 bis zum Beginn der 1960er Jahre. Der Schwerpunkt liegt auf dem Vergleich der Schulsysteme in der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik. Dabei werden insbesondere die Unterschiede der beiden Systeme, der Wiederaufbau des Schulwesens nach dem Zweiten Weltkrieg, die damit verbundenen Herausforderungen und die Weiterentwicklung der Schulsysteme analysiert.
- Der Wiederaufbau des Schulwesens in den beiden deutschen Staaten nach 1945
- Die Unterschiede in der Entwicklung der Schulsysteme in der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik
- Die Herausforderungen, denen sich das Schulwesen in beiden Staaten nach dem Krieg gegenüber sah
- Die Weiterentwicklung der Schulsysteme in der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik bis in die 1960er Jahre
- Die politische und bildungspolitische Einflussnahme der Besatzungsmächte auf die Entwicklung des Schulwesens
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit gliedert sich in zwei Phasen, die die Nachkriegssituation und die Weichenstellung (1945-1949) sowie die Entwicklungen von 1949 bis zum Beginn der 1960er Jahre abdecken.
In der ersten Phase wird die schwierige Situation des Schulwesens in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg beleuchtet. Die Arbeit behandelt die Aufteilung Deutschlands in Besatzungszonen und die unterschiedlichen Ansätze der alliierten Besatzungsmächte in Bezug auf den Wiederaufbau des Schulwesens. Dabei wird das Vorgehen der westlichen drei Besatzungsmächte sowie die Wiedereröffnung der Schulen in der sowjetischen Besatzungszone im Detail betrachtet.
Die zweite Phase analysiert die Entwicklungen in den beiden deutschen Staaten nach ihrer Gründung. Es werden die Bemühungen um eine Vereinheitlichung des Schulwesens in der Bundesrepublik Deutschland und der Aufbau der sozialistischen Schule in der Deutschen Demokratischen Republik beleuchtet.
Im Mittelpunkt der Untersuchung stehen dabei die Herausforderungen und Chancen, die sich aus der jeweiligen politischen und gesellschaftlichen Situation für die Entwicklung des Schulwesens ergeben. Die Arbeit zeigt, wie sich die beiden Schulsysteme unter dem Einfluss verschiedener Faktoren, wie z.B. der politischen Ideologie und der wirtschaftlichen Entwicklung, entwickelten.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beleuchtet die Entwicklung des Schulwesens in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, insbesondere die Unterschiede der Bildungssysteme in der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik. Wichtige Themen sind der Wiederaufbau des Schulwesens, die Rolle der Besatzungsmächte, die Entwicklung des Schulwesens bis in die 1960er Jahre sowie die politische und gesellschaftliche Einflussnahme auf die Bildungssysteme.
- Citar trabajo
- Doreen Winter (Autor), 2006, Schulentwicklung in den beiden deutschen Staaten von 1945 bis zum Beginn der 1960er Jahre, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/51721