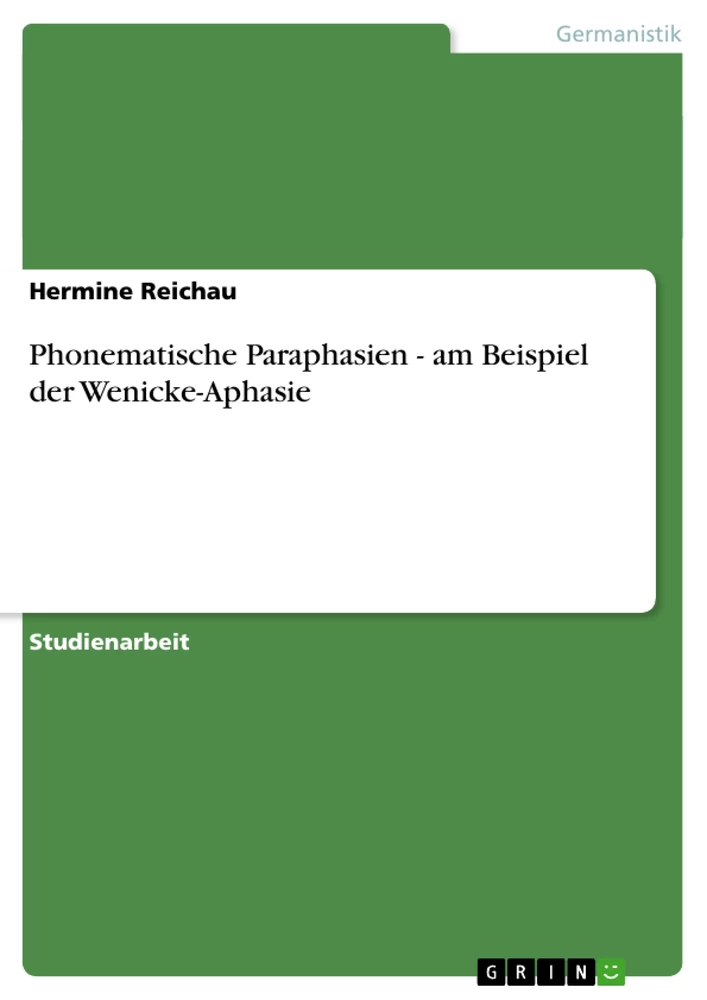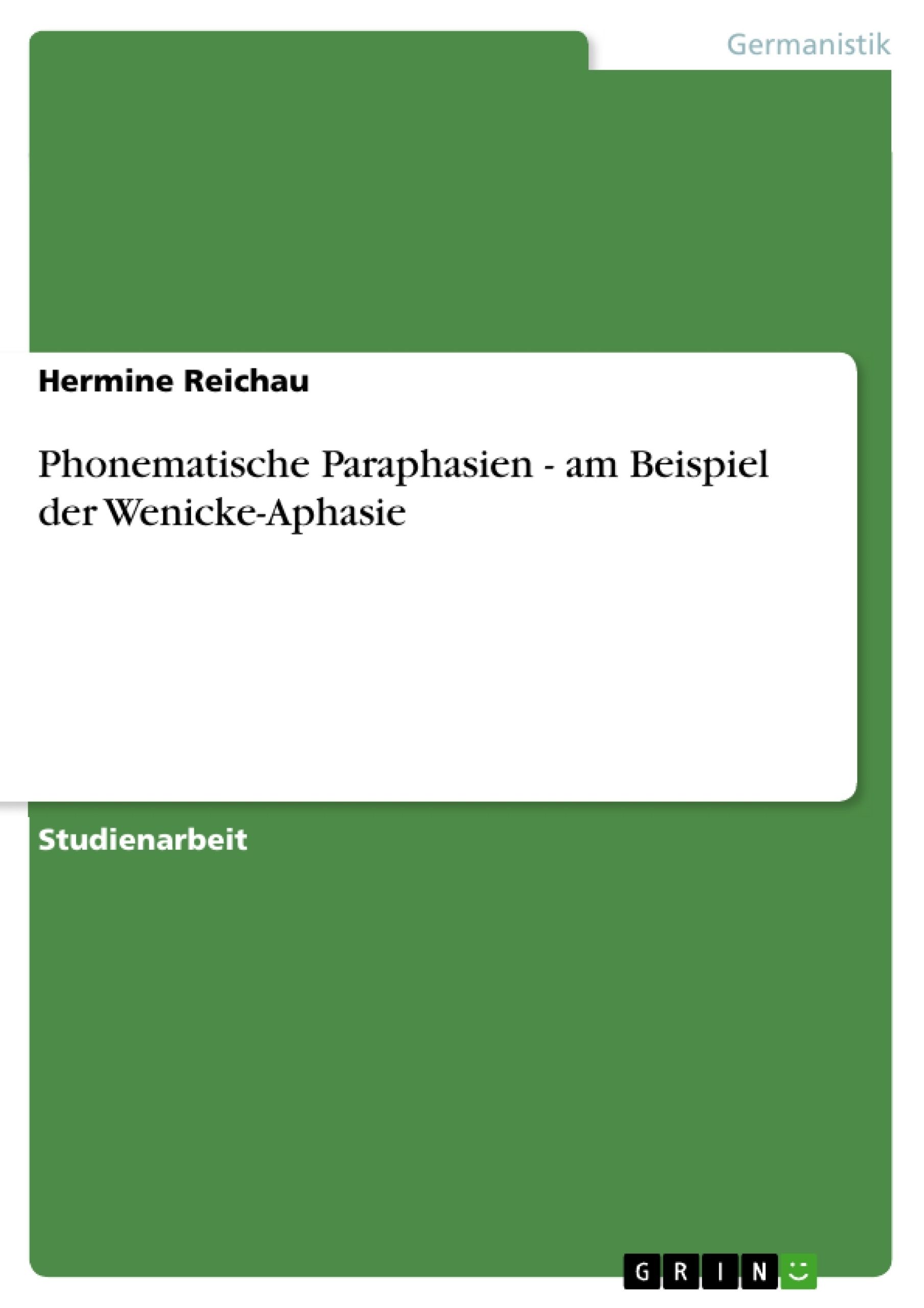Die vorliegende Arbeit will ein zusammenfassendes Gesamtbild phonematischer Paraphasien entwerfen. Hierzu werden, nach einer kurzen Einleitung zur Wernicke-Aphasie, phonematische Paraphasien zunächst in ihren verschiedenen Erscheinungsformen vorgestellt. Anhand einiger empirischer Untersuchungen soll gezeigt werden, worin sich phonematische Paraphasien von sprachgesunden Versprechern unterscheiden und welche charakteristischen Eigenschaften phonematische Paraphasien zueigen sind. Auf der Basis eines modularen Sprachproduktionsmodells soll dann geklärt werden, wie phonematische Paraphasien im Sprachproduktionsprozess entstehen können.
Die Beispieldaten sind sämtlich der angegebenen Literatur entnommen. Sie stammen ausschließlich von Wernicke-Aphasikern. Die Wernicke-Aphasie wurde hier speziell heraus gehoben, da für sie eine ausgeprägte Jargonbildung charakteristisch ist, welche im besonderen auch durch ein gehäuftes Auftreten von Neologismen gekennzeichnet ist. Phonematische Neologismen werden im Rahmen einer Relevanz für phonematische Paraphasien in dieser Arbeit ebenfalls berücksichtigt.
Inhaltsverzeichnis
- 0.1 Problemstellung und Thematische Abgrenzung
- 1. kurze Einleitung zum Wernicke-Syndrom
- 1.1 Allgemeines
- 1.2 die Wernicke-Aphasie
- 2. phonematische Paraphasien
- 2.1 Klassifizierung
- 2.1.1 Substitutionen
- 2.1.2 Addition und Tilgung
- 2.1.3 Neologismen
- 2.1.4 Zusammenfassung
- 2.2 Strukturelle Analyse phonematischer Paraphasien
- 2.2.1 natürliche Beschränkungen des phonologischen Systems
- 2.2.2 segmentale Fehler
- 2.2.3 strukturelle Fehler
- 2.2.4 Zusammenfassung
- 2.1 Klassifizierung
- 3. ein psycholinguistischer Ansatz zur Erklärung phonematischer Paraphasien
- 3.1 Konzepte eines modularen Sprachproduktionsmodells
- 3.1.1 Garretts Modell der Satzproduktion
- 3.1.2 das erweiterte slots-and-fillers Modell nach Shattuk-Huffnagel
- 3.2 phonematische Fehlberechnungen im Modell
- 3.2.1 Substitutionen
- 3.2.2 Addition und Tilgung
- 3.2.3 Neologismen
- 3.2.4 Zusammenfassung
- 3.1 Konzepte eines modularen Sprachproduktionsmodells
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit verfolgt das Ziel, ein umfassendes Verständnis phonematischer Paraphasien zu entwickeln. Sie untersucht die verschiedenen Erscheinungsformen dieser Sprachstörung, insbesondere im Kontext der Wernicke-Aphasie. Durch den Vergleich mit sprachgesunden Fehlern werden die charakteristischen Merkmale phonematischer Paraphasien herausgearbeitet. Schließlich wird ein psycholinguistisches Modell herangezogen, um die Entstehung dieser Paraphasien im Sprachproduktionsprozess zu erklären.
- Klassifizierung und Charakterisierung phonematischer Paraphasien
- Unterscheidung von phonematischen Paraphasien und sprachgesunden Versprechern
- Analyse der strukturellen Eigenschaften phonematischer Paraphasien
- Erklärung der Entstehung phonematischer Paraphasien anhand eines Sprachproduktionsmodells
- Bedeutung von Neologismen im Kontext phonematischer Paraphasien
Zusammenfassung der Kapitel
0.1 Problemstellung und Thematische Abgrenzung: Diese Einleitung skizziert die Zielsetzung der Arbeit: die umfassende Darstellung phonematischer Paraphasien. Es wird die Fokussierung auf die Wernicke-Aphasie begründet, da diese durch eine ausgeprägte Jargonbildung und ein häufiges Auftreten von Neologismen charakterisiert ist. Die Arbeit untersucht die Unterschiede zwischen aphasischen und gesunden Sprachfehlern und erklärt die Entstehung der Paraphasien mithilfe eines psycholinguistischen Modells. Die Datenbasis besteht ausschließlich aus Beispielen von Wernicke-Aphasikern aus der angegebenen Literatur.
1. kurze Einleitung zum Wernicke-Syndrom: Dieses Kapitel bietet eine kurze Einführung in das Wernicke-Syndrom. Es definiert Aphasie als zentrale Sprachstörung, die durch Läsionen oder Durchblutungsstörungen in der linken Gehirnhälfte entsteht. Es werden verschiedene Ursachen wie Schlaganfall, Traumata oder Tumore genannt. Der Fokus liegt auf den verschiedenen Komponenten des Sprachsystems, die von Aphasien betroffen sein können (Semantik, Syntax, Lexikon, Phonologie). Der Abschnitt führt zur Wernicke-Aphasie hin, die aufgrund ihrer phonologischen Störungen im weiteren Verlauf genauer untersucht wird.
2. phonematische Paraphasien: Dieses Kapitel widmet sich der detaillierten Beschreibung phonematischer Paraphasien. Die verschiedenen Erscheinungsformen (Substitutionen, Additionen, Tilgungen, Neologismen) werden klassifiziert und anhand empirischer Studien charakterisiert. Es wird untersucht, wie sich diese Fehler von gesunden Sprachfehlern unterscheiden und welche spezifischen Eigenschaften phonematische Paraphasien aufweisen. Die strukturelle Analyse betrachtet sowohl natürliche Beschränkungen des phonologischen Systems als auch segmentale und strukturelle Fehler.
3. ein psycholinguistischer Ansatz zur Erklärung phonematischer Paraphasien: Dieses Kapitel präsentiert einen psycholinguistischen Ansatz zur Erklärung der Entstehung phonematischer Paraphasien. Es werden Konzepte modularer Sprachproduktionsmodelle, insbesondere das Modell von Garrett und das erweiterte slots-and-fillers Modell nach Shattuk-Huffnagel, vorgestellt. Die verschiedenen Arten von phonematischen Fehlern (Substitutionen, Additionen, Tilgungen, Neologismen) werden im Rahmen dieser Modelle erklärt und eingeordnet. Das Kapitel bietet somit einen Erklärungsrahmen für die im vorherigen Kapitel beschriebenen Phänomene.
Schlüsselwörter
Phonematische Paraphasien, Wernicke-Aphasie, Sprachproduktion, Psycholinguistik, Sprachstörungen, Aphasietherapie, modulare Modelle, Sprachfehler, Neologismen, Jargon.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Phonematische Paraphasien im Kontext der Wernicke-Aphasie
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich umfassend mit phonematischen Paraphasien, einer Art von Sprachstörung, die insbesondere bei der Wernicke-Aphasie auftritt. Sie untersucht die verschiedenen Erscheinungsformen dieser Paraphasien, analysiert ihre strukturellen Eigenschaften und erklärt ihre Entstehung mithilfe eines psycholinguistischen Modells.
Was sind phonematische Paraphasien?
Phonematische Paraphasien sind Sprachfehler, bei denen einzelne Laute (Phoneme) eines Wortes falsch ausgesprochen, hinzugefügt oder weggelassen werden. Beispiele hierfür sind Substitutionen (Austausch von Lauten), Additionen (Hinzufügen von Lauten) und Tilgungen (Weglassen von Lauten). Ein Sonderfall sind Neologismen, bei denen völlig neue, nicht existierende Wörter gebildet werden.
Welche Rolle spielt die Wernicke-Aphasie?
Die Wernicke-Aphasie ist eine Form der Aphasie, die durch Schädigungen im Wernicke-Areal des Gehirns verursacht wird. Sie ist charakterisiert durch einen flüssigen, aber sinnlosen Sprachfluss, der oft von phonematischen Paraphasien und Neologismen geprägt ist. Diese Arbeit konzentriert sich auf phonematische Paraphasien im Kontext der Wernicke-Aphasie, um die spezifischen Eigenschaften dieser Sprachstörung zu untersuchen.
Wie werden phonematische Paraphasien klassifiziert?
Die Arbeit klassifiziert phonematische Paraphasien anhand verschiedener Kategorien: Substitutionen (Austausch von Phonemen), Additionen (Hinzufügen von Phonemen), Tilgungen (Weglassen von Phonemen) und Neologismen (Bildung neuer Wörter). Diese Klassifizierung dient als Grundlage für die weitere Analyse der strukturellen Eigenschaften dieser Fehler.
Wie unterscheidet sich die Analyse von phonematischen Paraphasien von anderen Sprachfehlern?
Die Arbeit untersucht die Unterschiede zwischen phonematischen Paraphasien bei Aphasikern und Sprachfehlern bei gesunden Sprechern. Dabei werden die strukturellen Eigenschaften der Fehler analysiert und verglichen, um die spezifischen Merkmale aphasischer Sprachfehler herauszuarbeiten.
Welches psycholinguistische Modell wird verwendet?
Die Arbeit verwendet modulare Sprachproduktionsmodelle, insbesondere das Modell von Garrett und das erweiterte slots-and-fillers Modell nach Shattuk-Huffnagel, um die Entstehung phonematischer Paraphasien im Sprachproduktionsprozess zu erklären. Diese Modelle erlauben es, die verschiedenen Arten von phonematischen Fehlern im Rahmen eines kognitiven Prozesses zu verstehen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: 0.1 Problemstellung und Thematische Abgrenzung; 1. kurze Einleitung zum Wernicke-Syndrom; 2. phonematische Paraphasien; 3. ein psycholinguistischer Ansatz zur Erklärung phonematischer Paraphasien.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Phonematische Paraphasien, Wernicke-Aphasie, Sprachproduktion, Psycholinguistik, Sprachstörungen, Aphasietherapie, modulare Modelle, Sprachfehler, Neologismen, Jargon.
Welche Datenbasis wird verwendet?
Die Datenbasis besteht ausschließlich aus Beispielen von Wernicke-Aphasikern aus der angegebenen Literatur.
Welches ist das übergeordnete Ziel der Arbeit?
Das übergeordnete Ziel der Arbeit ist es, ein umfassendes Verständnis phonematischer Paraphasien zu entwickeln und deren Entstehung im Sprachproduktionsprozess mithilfe eines psycholinguistischen Modells zu erklären.
- Quote paper
- Dipl. Inf. Hermine Reichau (Author), 2002, Phonematische Paraphasien - am Beispiel der Wenicke-Aphasie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/5159