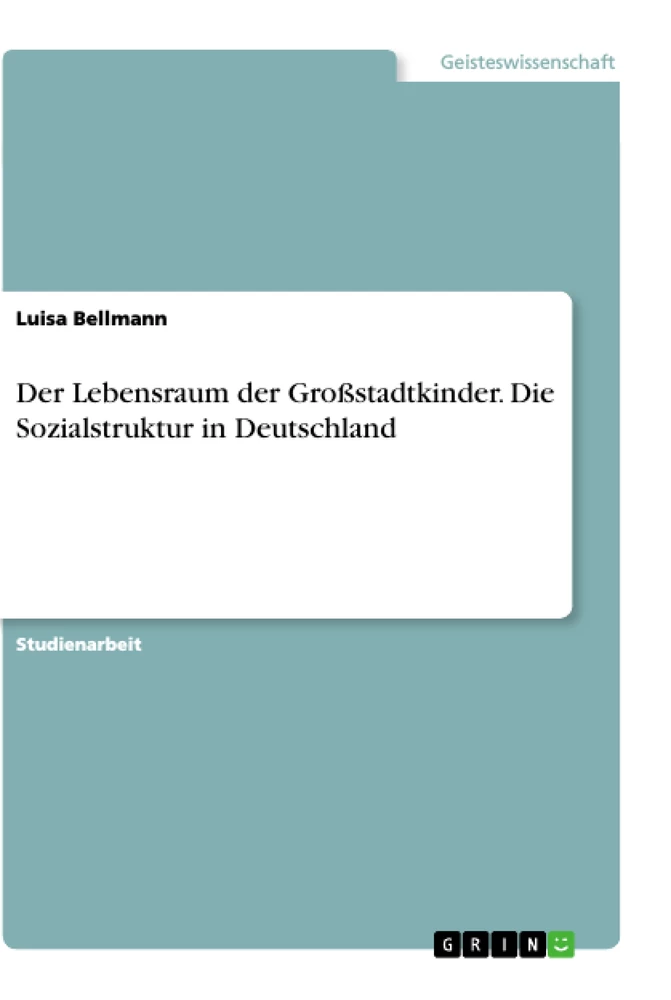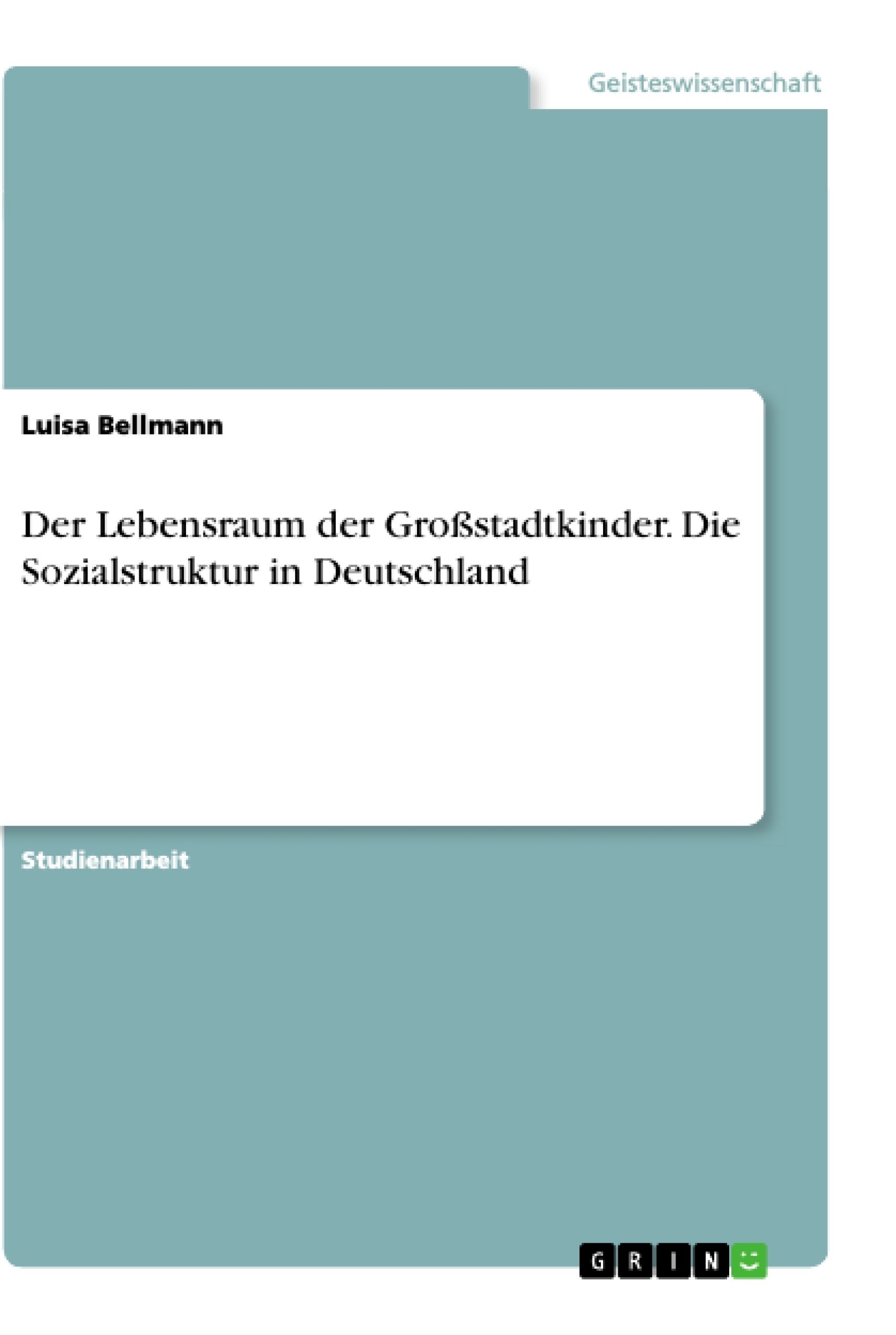In der Arbeit betrachtet der Autor die Veränderungen der Kindheitsbedingungen in den letzten Jahrzehnten, die Problematik des öffentlichen Raumes für Kinder und deren soziale Beziehungen. In erster Linie bezieht sich der Autor hierbei auf "Orte und Zeiten der Kinder" von Hartmut J. Zeiher und Helga Zeiher und auf "Der Lebensraum des Großstadtkindes" von Martha Muchow und Hans Heinrich Muchow. Des Weiteren werden Vergleiche und Standpunkte aus der Arbeit "Die Großstädte und das Geistesleben" von Georg Simmels herbeigezogen
Hierfür gibt der Autor einen kurzen Einblick in die Sozialstruktur Deutschlands, insbesondere auf den Strukturwandel der Familie. Das soll veranschaulichen, wo die Entdeckung der Kindheit entstand und in welcher Weise die Altersstruktur einen Einfluss auf die Bevölkerung ausübt. Anschließend geht der Autor auf die die Faktoren Raum und Zeit in der Kindheit ein.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die historische Ausgangssituation
- Die Sozialstruktur Deutschlands
- Kindliche Lebenswelten
- Kinder in "postmodernen" Gesellschaften
- Die ökonomische Situation von Kindern
- Kinder als Gegenstand wissenschaftlicher Betrachtung
- Orte und Zeiten der Kinder
- Veränderung räumlicher Bedingungen in den letzten Jahrzehnten
- Funktionstrennung und Spezialisierung
- Öffentlicher Raum
- Die Straße als Lebensraum
- Die Verinselung - Zwei Lebensraum Modelle
- Zeitraster der Kindheit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Veränderungen der Kindheitsbedingungen in den vergangenen Jahrzehnten. Sie fokussiert dabei auf die Problematik des öffentlichen Raumes für Kinder und deren sozialen Beziehungen, wobei die Analyse auf die Werke von Hartmut J. Zeiher, Helga Zeiher und Martha Muchow, Hans Heinrich Muchow sowie auf Georg Simmels „Die Großstädte und das Geistesleben“ zurückgreift.
- Entwicklung der Sozialstruktur Deutschlands und der Familie
- Veränderungen in der Lebenswelt von Kindern im Kontext von „postmodernen“ Gesellschaften
- Die ökonomische Situation von Kindern und ihre Benachteiligung
- Die räumliche Entwicklung von Kindern und die Spezialisierung des öffentlichen Raumes
- Die Rolle der Straßen und die Verinselung von Kindern in verschiedenen Lebensräumen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der sich verändernden Kindheitsbedingungen ein und benennt die zentralen Werke, auf die sich die Analyse stützt. Das zweite Kapitel beleuchtet die historische Ausgangssituation, indem es die Sozialstruktur Deutschlands und die Entwicklung der Familie in den Blick nimmt. Besonderes Augenmerk liegt hierbei auf der „Entdeckung der Kindheit“ und deren Einfluss auf die gesellschaftliche Wahrnehmung von Kindern. Im dritten Kapitel werden die Veränderungen der räumlichen Bedingungen in den letzten Jahrzehnten analysiert. Die Spezialisierung von Räumen, die Funktionstrennung in Wohnsiedlungen und die Herausforderungen des öffentlichen Raumes für Kinder stehen im Vordergrund.
Schlüsselwörter
Kindheitsbedingungen, öffentlicher Raum, soziale Beziehungen, Sozialstruktur Deutschlands, Familie, „postmoderne“ Gesellschaften, ökonomische Benachteiligung, Spezialisierung, Funktionstrennung, Verinselung, Lebensraum, Zeitraster der Kindheit.
Häufig gestellte Fragen
Wie hat sich der Lebensraum von Kindern in der Stadt verändert?
Es hat eine Spezialisierung und Funktionstrennung stattgefunden; freie Spielräume auf der Straße verschwinden zugunsten von verplanten "Inseln" wie Spielplätzen oder Vereinen.
Was bedeutet der Begriff "Verinselung"?
Er beschreibt, dass kindliche Lebenswelten in räumlich getrennte, spezialisierte Bereiche zerfallen, zwischen denen Kinder oft von Erwachsenen hin- und hergefahren werden müssen.
Welchen Einfluss hat der Strukturwandel der Familie?
Veränderte Familienstrukturen in der postmodernen Gesellschaft führen zu neuen ökonomischen Bedingungen und einer anderen zeitlichen Organisation des kindlichen Alltags.
Warum ist die Straße als Lebensraum für Kinder problematisch geworden?
Durch zunehmenden Verkehr und die Priorisierung ökonomischer Flächennutzung wurde der öffentliche Raum für Kinder unsicherer und weniger zugänglich.
Was versteht man unter dem "Zeitraster der Kindheit"?
Es bezeichnet die zunehmende Taktung und Verplanung der kindlichen Freizeit durch institutionelle Vorgaben, was den Raum für freies, unstrukturiertes Spiel einschränkt.
- Citation du texte
- Luisa Bellmann (Auteur), 2006, Der Lebensraum der Großstadtkinder. Die Sozialstruktur in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/514826