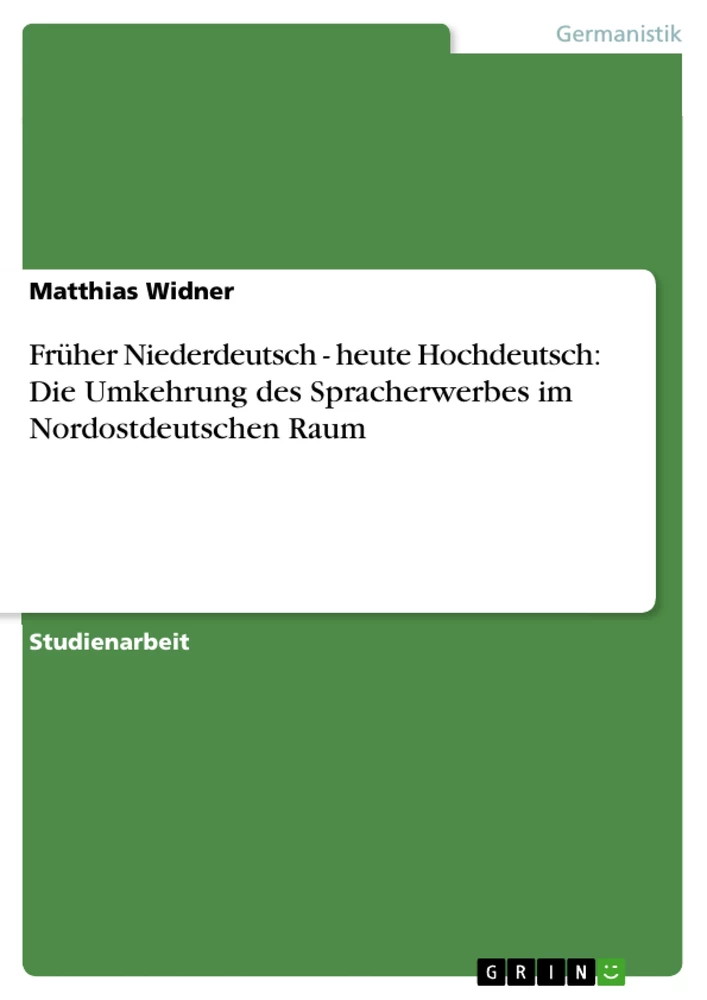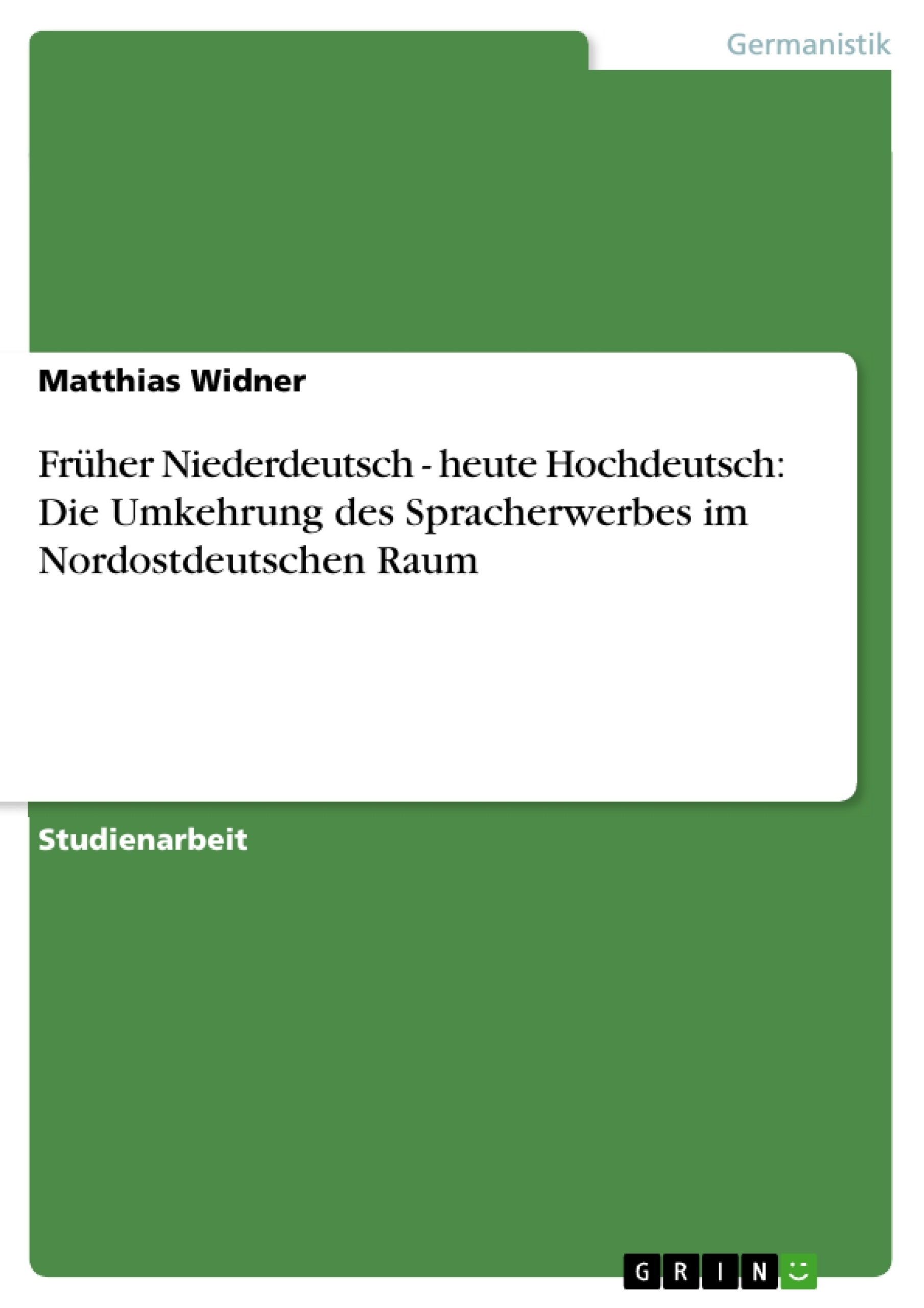Schon im 18. Jahrhundert schrieb Lessing in seinem Werk „Über das Plattdeutsche“: „Die Niedersachsen haben sehr Unrecht, wenn sie für die Verdrängung ihrer Mundart der Reformation Schuld geben. Die Reformation war die Veranlassung, aber die Schuld ist lediglich ihr eigen.“ Bernd-Axel Widmann schlussfolgerte über 230 Jahre später, dass Lessing hier schon den „Kreisschluss eines solchen Problemkreises wie der Mehr- oder Zweisprachigkeit in einem Landstrich umrissen“ hat. Weniger die äußeren Umstände sind für das Verschwinden einer Sprache verantwortlich, als viel mehr die innere Einstellung der Sprecher und Schreiber zu ihrer Sprache.
Die Verwendung der Sprache entscheidet folglich über den primären Spracherwerb der nachwachsenden Generation. Während schon im 18. Jahrhundert der Wandel vom Niederdeutschen zum Hochdeutschen anfing – Lessing gab hier die Meinung an, dass die Reformation ein Katalysator gewesen wäre – erfolgte die vollständige Umkehrung des primären Spracherwerbes im niederdeutschen Raum erst im 20. Jahrhundert. Vor allem auf dem Land sprach man bis in die 60er Jahre des 20. Jahrhunderts hinein im privaten Kreis nur plattdeutsch, während man die hochdeutsche Sprache erst in der Schule korrekt erlernte und häufig nur für die externe Kommunikation außerhalb der eigenen Gemeinde verwendete.
Bevor diese Problematik der Umkehrung des niederdeutschen Spracherwerbes untersucht wird, kommt es vorab zu einer Begriffserklärung. Es soll versucht werden, die niederdeutsche Mundart genau zu definieren.
Das dritte Kapitel soll im vergleichenden Maßstab den Spracherwerb im Zeitraum zwischen dem Ende des Zweiten Weltkrieges und dem Jahr 1960 und der heutigen Sprachpraxis untersuchen. Nach dem gemeinsamen Ausgangspunkt des Kriegsendes entwickelte sich die Bildungspolitik, wie auch der Umgang mit der Mundart in der DDR und der BRD different. Im Kapitel 3.2. soll, dem erklärend, Rechnung getragen werden. Wenn man jedoch den heutigen Sprachgebrauch, der in der Sekundärliteratur interessanter Weise schlechter belegt ist, untersucht, kommt es zu einer Akzentuierung auf die Themen der didaktischen Überlegungen und der allgemeinen Sprachplanung, da nicht nur die Schule für den heutigen Kontakt mit dem Niederdeutschen zuständig sein soll, sondern gleichfalls die sozialisierende Umwelt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffserklärung
- Spracherwerb zwischen 1945 und 1960
- Der niederdeutsche Status nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges
- Wechselwirkung zwischen der Bildungspolitik und dem Spracherwerb
- Spracherwerb heute
- Didaktische Überlegungen
- Allgemeine Sprachplanung
- Schlusswort
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Umkehrung des Spracherwerbs im nordostdeutschen Raum, wobei der Fokus auf dem Übergang vom Niederdeutschen zum Hochdeutschen liegt. Die Untersuchung beleuchtet den Wandel des primären Spracherwerbs im 20. Jahrhundert und analysiert die Faktoren, die diesen Wandel beeinflusst haben, insbesondere die Rolle der Bildungspolitik.
- Die Definition des Niederdeutschen und seine Einordnung als Diasystem
- Die Entwicklung des Spracherwerbs im Zeitraum zwischen 1945 und 1960
- Der Einfluss der Bildungspolitik auf den Spracherwerb
- Die Bedeutung der didaktischen Überlegungen und der allgemeinen Sprachplanung für den heutigen Umgang mit dem Niederdeutschen
- Die Transformation des niederdeutschen Dialekts zu einer norddeutschen Umgangssprache
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die historische Entwicklung des Niederdeutschen und die Bedeutung der inneren Einstellung der Sprecher für das Überleben einer Sprache. Kapitel 2 liefert eine Begriffserklärung des Niederdeutschen und diskutiert die Schwierigkeit, es als einheitliche Sprache zu definieren. Kapitel 3 vergleicht den Spracherwerb im Zeitraum zwischen 1945 und 1960 mit der heutigen Sprachpraxis. Kapitel 3.1 fokussiert auf den Status des Niederdeutschen nach dem Zweiten Weltkrieg, während 3.2 den Einfluss der Bildungspolitik beleuchtet.
Schlüsselwörter
Niederdeutsch, Hochdeutsch, Spracherwerb, Bildungspolitik, Sprachplanung, Umgangssprache, Diasystem, Bidialektalität, Norddeutschland, Zweisprachigkeit
- Quote paper
- Matthias Widner (Author), 2006, Früher Niederdeutsch - heute Hochdeutsch: Die Umkehrung des Spracherwerbes im Nordostdeutschen Raum, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/51360