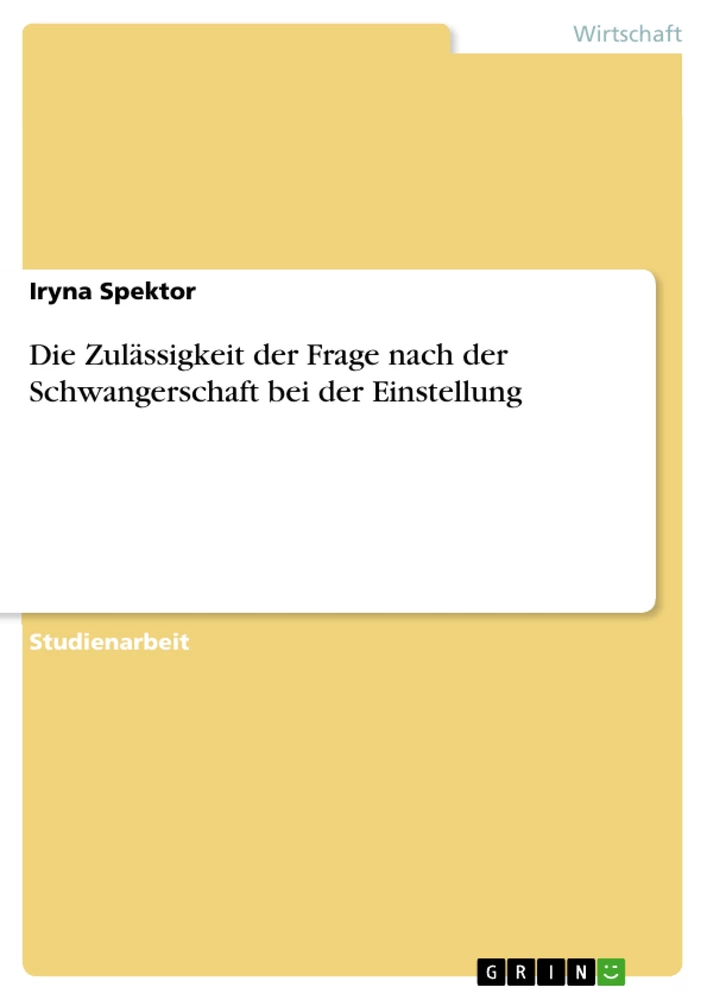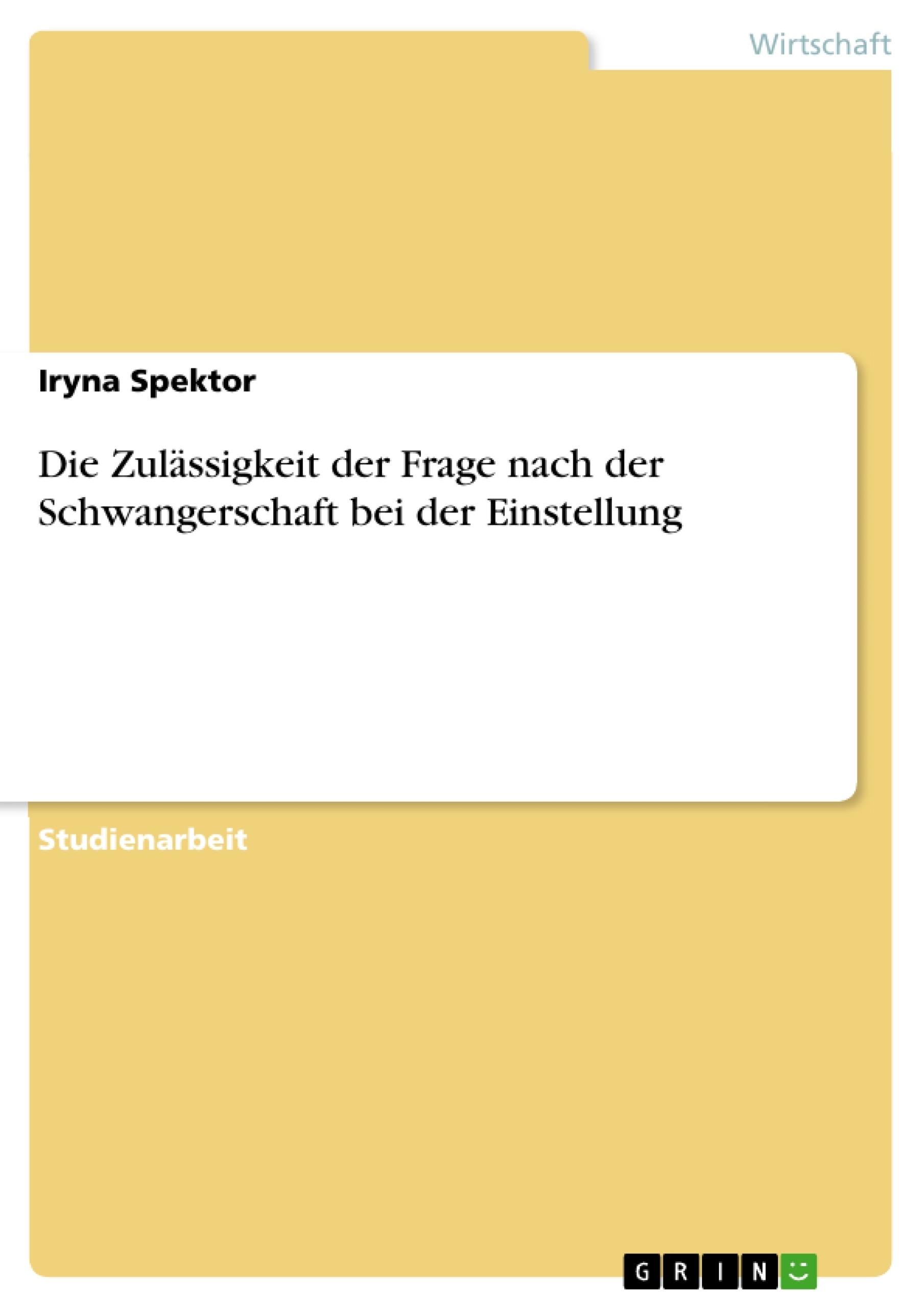Einleitung
Die Souveränität des Arbeitgebers ist insofern eingeschränkt, dass er nur nach solchen Tatsachen fragen darf, die mit der in Aussicht genommenen Beschäftigung zusammenhängen. Nur dann hat er ein berechtigtes Interesse daran, in die Individualsphäre der Bewerberin einzudringen. Unproblematisch ist es mit persönlichen Daten wie Verwandschaftsverhältnissen, Freizeitbeschäftigung und Wohnbedingungen der Bewerberin, auch mit ihren Heiratsabsichten oder Kinderwünschen: All das hat den Arbeitgeber nicht zu interessieren.
Besonders umstrittene Fragen an männliche und weibliche Arbeitspersonen sind zum Beispiel die nach Vorstrafen, Lohnpfändungen, nach der letzten Gehaltshöhe, ehrenamtlichen Funktionen, Kirchenzugehörigkeit und die Frage nach dem Bestehen einer Schwangerschaft. Die Mutterschaft einer Arbeitnehmerin bürdet dem Arbeitgeber nicht nur erhebliche finanzielle Lasten auf, sondern erschwert auch in beträchtlichem Umfang durch Beschäftigungsverbote und – einschränkungen sowie Schutzzeiten den betrieblichen Arbeitsablauf.
Der Arbeitgeber hat der Schwangeren einen Zuschuss zum Mutterschaftsgeld bis zur Höhe des entgangenen Nettoarbeitsentgeltes während der in der Regel 14 Wochen dauernden Schutzfrist zu gewähren und muss außerdem für eine Ersatzkraft bis zum Ende des Erziehungsurlaubes sorgen. Diese Nachteile ergeben sich „aus einer staatlichen Regelung über die Arbeitsunfähigkeit, wonach eine mit Schwangerschaft und Entbindung zusammenhängende Verhinderung an der Arbeitsleistung einer Verhinderung wegen Krankheit gleichsteht.“1
-------
1 Wassmer, FAZ von 03.03.1986; Nr. 52; S.13
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Entwicklung der Rechtsprechung
- Das ,,Recht zur Lüge“
- § 611a BGB Geschlechtsbezogene Benachteiligung
- Das Urteil des BAG vom 20.2.1986
- Das Urteil des BAG vom 20.2.1992
- Arbeitnehmerinnen dürfen Schwangerschaften generell verschweigen
- Das Urteil des BAG vom 06.02.2003
- Über welche Rechtsfrage hat das BAG entschieden?
- Das Urteil des EuGH
- Sanktionen bei Verstoß gegen das Benachteiligungsverbot
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text analysiert die rechtliche Zulässigkeit der Frage nach der Schwangerschaft im Kontext von Bewerbungsgesprächen. Es wird untersucht, inwiefern solche Fragen gegen das Benachteiligungsverbot verstoßen und welche rechtlichen Folgen für Arbeitgeber und Arbeitnehmerinnen entstehen.
- Entwicklung der Rechtsprechung zur Frage nach der Schwangerschaft
- Das Recht zur Lüge bei unzulässigen Fragen
- Anwendbarkeit des § 611a BGB auf die Fragestellung
- Sanktionen bei Verstoß gegen das Benachteiligungsverbot
- Rechtliche Folgen für Arbeitgeber und Arbeitnehmerinnen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Problematik der Frage nach der Schwangerschaft im Bewerbungsgespräch vor und erläutert die rechtliche Problematik im Kontext der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerrechte.
- Die Entwicklung der Rechtsprechung: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung der Rechtsprechung, beginnend mit der Zulässigkeit der Frage nach der Schwangerschaft bis hin zur Anerkennung des Benachteiligungsverbot durch das Gleichbehandlungsgesetz.
- Arbeitnehmerinnen dürfen Schwangerschaften generell verschweigen: Dieses Kapitel analysiert die Rechtsprechung, die die Frage nach der Schwangerschaft im Bewerbungsgespräch als unzulässig erachtet und beleuchtet die Urteile des Bundesarbeitsgerichts (BAG) und des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zu diesem Thema.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen des Textes sind die rechtliche Zulässigkeit der Frage nach der Schwangerschaft im Bewerbungsgespräch, das Benachteiligungsverbot gemäß § 611a BGB, die Entwicklung der Rechtsprechung und die Folgen für Arbeitgeber und Arbeitnehmerinnen.
- Quote paper
- Iryna Spektor (Author), 2005, Die Zulässigkeit der Frage nach der Schwangerschaft bei der Einstellung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/51352