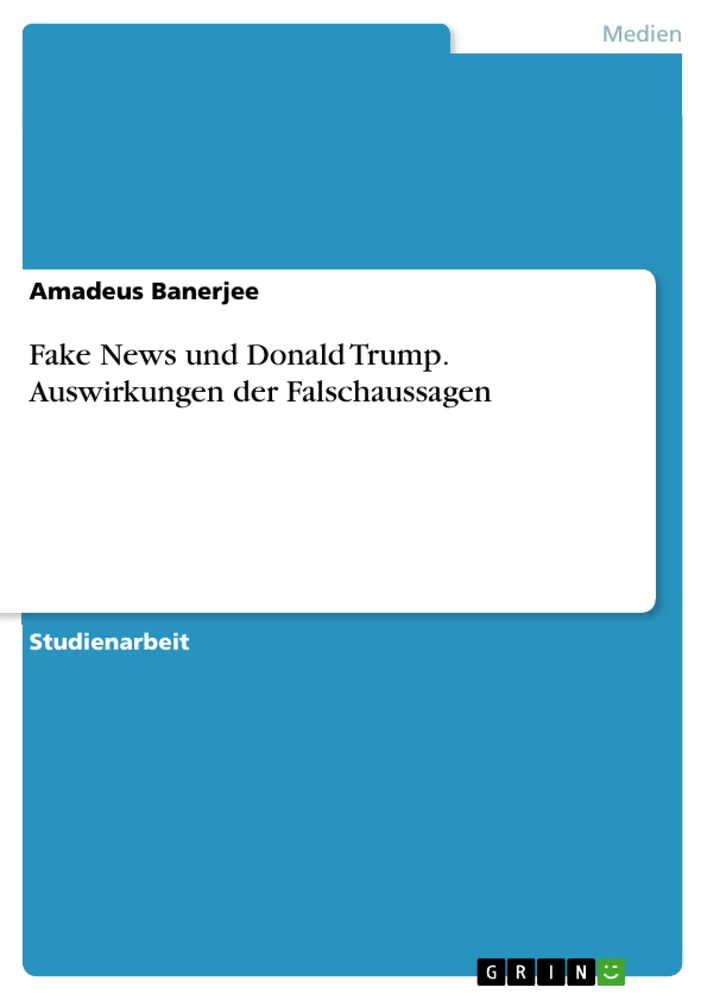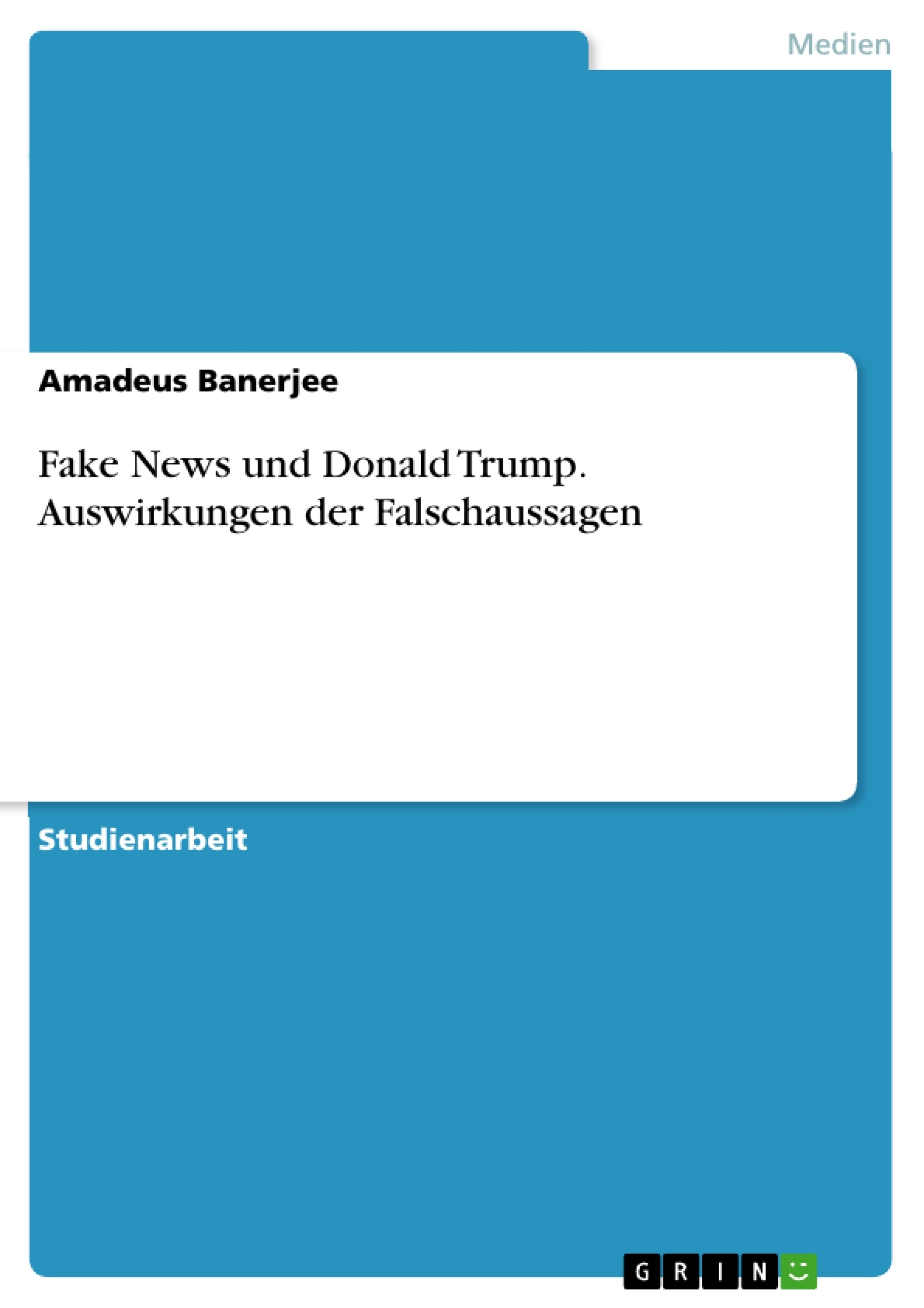Fake News sind spätestens mit dem Regierungswechsel in den USA im Jahr 2017 nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken. "Fake News" stand sogar im Rennen, Unwort des Jahres zu werden, wurde dann aber von dem Begriff "Alternative Fakten" geschlagen. Doch Fake News und Alternative Fakten sind letzten Endes ein und dieselbe Sache.
Der gesunde Menschenverstand lehrt einen schließlich, dass es zu Fakten keine Alternative gibt. Entweder scheint die Sonne oder sie scheint nicht. Wenn die Sonne scheint, dann handelt es sich dabei selbstverständlich um einen Fakt. Überprüfbar und alternativlos. Ein alternativer Fakt ist also nichts weiter, als eine Lüge und damit eine falsche Nachricht - "Fake News".
Dennoch sind eben solche Falschaussagen zur Zeit hoch im Kurs. Gerade Donald Trump beherrscht es wie kaum ein anderer, Sachverhalte zu verdrehen und Unwahrheiten zu verbreiten. Die Washington Post macht sich bereits seit einiger Zeit die Mühe, sämtliche Falschaussagen des Präsidenten zu protokollieren und kommt auf durchschnittlich 300 Lügen pro Monat.
Doch kann die Verbreitung von falschen Aussagen, um sich selbst besser darzustellen, tatsächlich hilfreich sein? Schaden zu häufige, widerlegbare Aussagen der Glaubhaftigkeit eines Politikers nicht viel mehr?
In dieser Hausarbeit soll genau diese Frage beantwortet werden und zudem aufgezeigt werden, wie lange es den Begriff schon gibt.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Geschichte und Definition
- 3 Die Ziele von Fake News
- 4 Wahrnehmung und Wirkung von Fake News
- 5 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Frage, ob die Verbreitung von Falschaussagen, wie sie beispielsweise von Donald Trump praktiziert werden, seinem Ansehen schadet, indem sie sein Vertrauen in der Öffentlichkeit untergraben. Die Arbeit beleuchtet die Geschichte des Begriffs "Fake News", seine Definition und die verschiedenen Ziele, die mit der Verbreitung solcher Nachrichten verfolgt werden.
- Die Geschichte und Definition von "Fake News"
- Die verschiedenen Ziele der Verbreitung von Fake News (Profit, politische Diffamierung, Selbstdarstellung)
- Die Wahrnehmung und Wirkung von Fake News auf die öffentliche Meinung
- Der Einfluss von Fake News auf das Vertrauen in Politiker und Medien
- Der Vergleich der Anfälligkeit für Fake News zwischen Deutschland und den USA
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Fake News ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach den Auswirkungen von Falschaussagen auf das Ansehen von Politikern, am Beispiel Donald Trumps, in den Mittelpunkt. Sie verortet den Begriff "Fake News" im aktuellen politischen Diskurs und hebt dessen Nähe zu "alternativen Fakten" hervor. Die Einleitung legt den Fokus auf die potenziell schädlichen Auswirkungen häufiger, widerlegbarer Aussagen auf die Glaubwürdigkeit eines Politikers und kündigt die Absicht an, diese Frage in der Arbeit zu untersuchen.
2 Geschichte und Definition: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung des Begriffs "Fake News", der bereits im 19. Jahrhundert auftauchte, und seine Verwandtschaft zu älteren Begriffen wie "False News". Es wird die Intention hinter der Verbreitung von Fake News definiert und differenziert zwischen starker Überbetonung bestimmter Themen, Propaganda und gezielter Desinformation. Der Fokus liegt auf der bewussten Verbreitung von Unwahrheiten oder der Schaffung unausgewogener Berichterstattungen, die die Wahrnehmung in der Gesellschaft beeinflussen können. Der Vergleich der Anfälligkeit für Fake News zwischen Deutschland und den USA, basierend auf dem unterschiedlichen Vertrauen in Medien und der Rolle sozialer Netzwerke, ist ein wichtiger Aspekt dieses Kapitels.
3 Die Ziele von Fake News: Dieses Kapitel analysiert die verschiedenen Motive hinter der Erstellung und Verbreitung von Fake News. Es zeigt, dass finanzielle Interessen, wie die Monetarisierung durch Klicks auf Werbeanzeigen, ein starkes Motiv darstellen, insbesondere in Ländern mit weniger strengen medienethischen Standards. Ein weiteres wichtiges Motiv ist die politische Diffamierung von Gegnern durch die Verbreitung von erfundenen Skandalen. Schliesslich wird auch die Nutzung von Fake News zur Selbstdarstellung durch Politiker selbst beleuchtet, anhand des Beispiels Donald Trumps.
Schlüsselwörter
Fake News, Alternative Fakten, Donald Trump, Glaubwürdigkeit, Medien, Propaganda, Desinformation, politische Kommunikation, Vertrauen, soziale Netzwerke, Lüge, Informationsmanipulation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse der Auswirkungen von Falschaussagen auf das Ansehen von Politikern
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Diese Hausarbeit untersucht, ob die Verbreitung von Falschaussagen, wie sie beispielsweise von Donald Trump praktiziert werden, seinem Ansehen schadet, indem sie sein Vertrauen in der Öffentlichkeit untergraben. Die Arbeit analysiert die Geschichte des Begriffs "Fake News", seine Definition und die Ziele der Verbreitung solcher Nachrichten.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die Geschichte und Definition von "Fake News", die verschiedenen Ziele der Verbreitung (Profit, politische Diffamierung, Selbstdarstellung), die Wahrnehmung und Wirkung von Fake News auf die öffentliche Meinung, den Einfluss auf das Vertrauen in Politiker und Medien, sowie einen Vergleich der Anfälligkeit für Fake News zwischen Deutschland und den USA.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, die die zentrale Forschungsfrage einführt. Kapitel 2 behandelt die Geschichte und Definition von "Fake News". Kapitel 3 analysiert die Ziele der Verbreitung von Fake News. Abschließend folgt ein Fazit (Kapitel 5).
Was wird in der Einleitung besprochen?
Die Einleitung führt in das Thema Fake News ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach den Auswirkungen von Falschaussagen auf das Ansehen von Politikern, am Beispiel Donald Trumps, in den Mittelpunkt. Sie verortet den Begriff "Fake News" im aktuellen politischen Diskurs und hebt dessen Nähe zu "alternativen Fakten" hervor. Die Einleitung betont die potenziell schädlichen Auswirkungen häufiger, widerlegbarer Aussagen auf die Glaubwürdigkeit eines Politikers.
Was sind die Kernaussagen von Kapitel 2 ("Geschichte und Definition")?
Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung des Begriffs "Fake News" und seine Verwandtschaft zu älteren Begriffen. Es definiert die Intention hinter der Verbreitung und differenziert zwischen starker Überbetonung, Propaganda und gezielter Desinformation. Ein wichtiger Aspekt ist der Vergleich der Anfälligkeit für Fake News zwischen Deutschland und den USA, basierend auf unterschiedlichem Medienvertrauen und der Rolle sozialer Netzwerke.
Worauf konzentriert sich Kapitel 3 ("Die Ziele von Fake News")?
Kapitel 3 analysiert die Motive hinter der Erstellung und Verbreitung von Fake News. Es werden finanzielle Interessen (Monetarisierung durch Klicks), politische Diffamierung von Gegnern und die Selbstdarstellung von Politikern (am Beispiel Donald Trump) als wichtige Motive beleuchtet.
Welche Schlüsselwörter werden in der Arbeit verwendet?
Schlüsselwörter sind: Fake News, Alternative Fakten, Donald Trump, Glaubwürdigkeit, Medien, Propaganda, Desinformation, politische Kommunikation, Vertrauen, soziale Netzwerke, Lüge, Informationsmanipulation.
Gibt es einen Vergleich zwischen Deutschland und den USA?
Ja, die Arbeit vergleicht die Anfälligkeit für Fake News zwischen Deutschland und den USA, basierend auf dem unterschiedlichen Vertrauen in Medien und der Rolle sozialer Netzwerke in beiden Ländern.
- Quote paper
- Amadeus Banerjee (Author), 2019, Fake News und Donald Trump. Auswirkungen der Falschaussagen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/513218