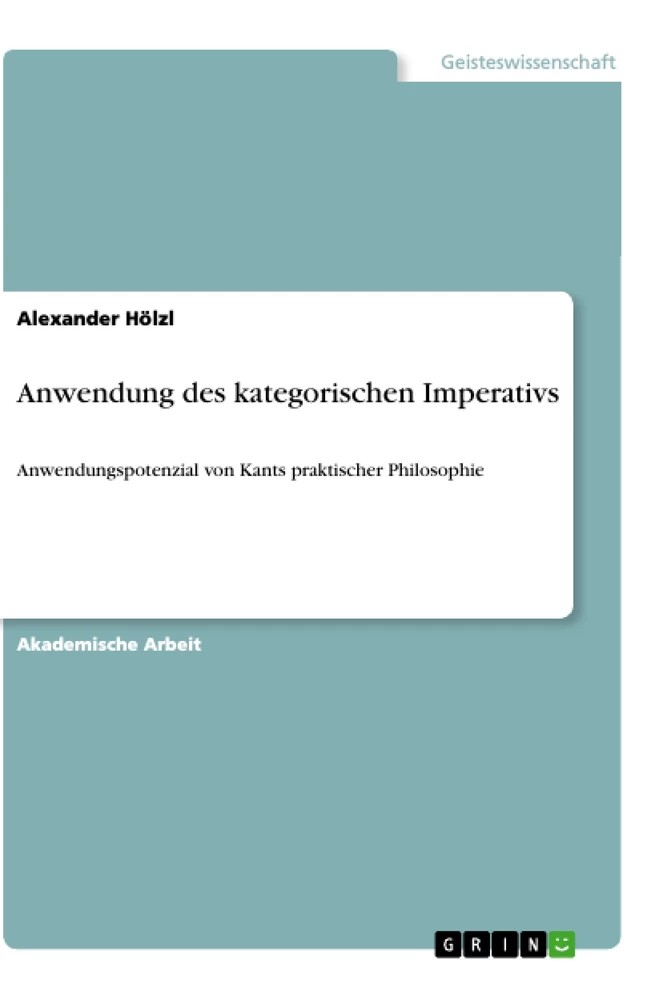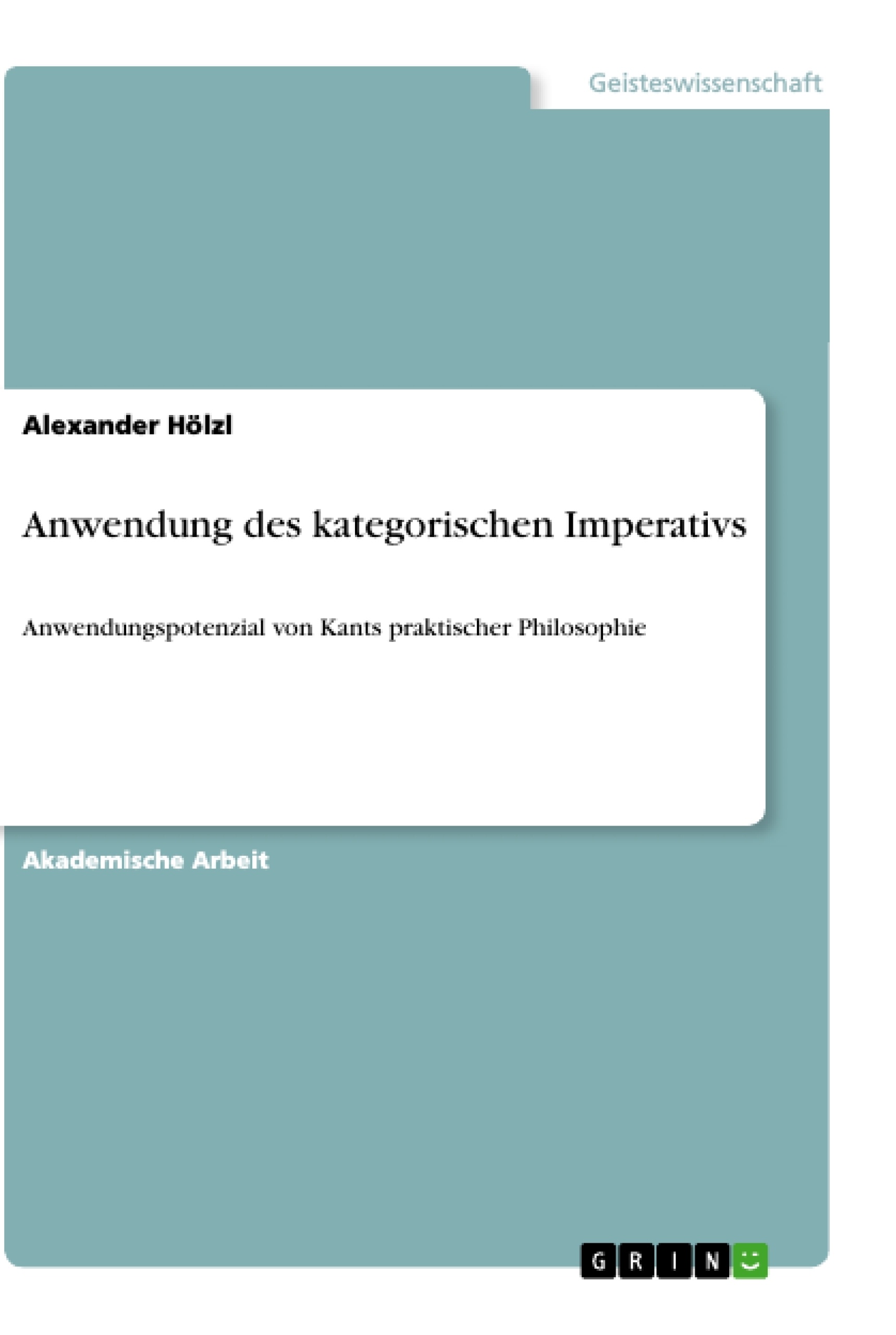Kants praktische Philosophie spielt derzeit nur eine untergeordnete Rolle in der „Angewandten Ethik“. Dies ist wohl auch einem gängigen Vorurteil geschuldet: Der kategorische Imperativ als Moralprinzip sei nicht brauchbar zur „Lösung“ konkreter Fälle, da dieser die „Feinstruktur moralischer Phänomene“ (Pauer-Studer 2006) und die konkrete Lebensrealität der Menschen außer acht lasse. Das Ziel dieser Arbeit ist es, die gängigen Vorurteile in Bezug zur Anwendbarkeit des kategorischen Imperativs zu überwinden und das Anwendungspotenzial von Kants praktischer Philosophie aufzuzeigen.
Zunächst (Kapitel 2) wird der kategorische Imperativ ausführlich behandelt und von hypothetischen Imperativen abgegrenzt. Danach wird anhand von Beispielen gezeigt, wie Kants Maximen-Prüfung (Kapitel 3) auf konkrete Fälle angewandt werden kann. Im letzten Abschnitt (Kapitel 4) wird anhand von drei antiken Tugenden (Tugend der Weisheit, Tugend der Klugheit, Tugend der Tapferkeit) herausgearbeitet, wie das Ergebnis einer Maximen-Prüfung in konkreten Situationen schlussendlich auch realisiert werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der kategorische Imperativ
- Maximen-Prüfung
- Anwendung auf konkrete Situationen
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit widmet sich der Frage nach der Anwendbarkeit des kategorischen Imperativs in der modernen „Angewandten Ethik“. Sie soll gängige Vorurteile in Bezug auf die praktische Relevanz von Kants philosophischer Lehre überwinden und das Anwendungspotenzial des kategorischen Imperativs für konkrete Situationen aufzeigen.
- Abgrenzung des kategorischen Imperativs von hypothetischen Imperativen
- Anwendung der Maximen-Prüfung auf konkrete Fälle
- Realisierung des Ergebnisses einer Maximen-Prüfung in konkreten Situationen
- Bewertung der „Feinstruktur moralischer Phänomene“ im Lichte des kategorischen Imperativs
- Konfrontation der kantianischen Ethik mit utilitaristischen Konzeptionen
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung
- Kapitel 2: Der kategorische Imperativ
- Kapitel 3: Maximen-Prüfung
- Kapitel 4: Anwendung auf konkrete Situationen
In der Einleitung wird die Relevanz von Kants praktischer Philosophie für die „Angewandte Ethik“ beleuchtet und die gängigen Vorurteile gegenüber dem kategorischen Imperativ als unbrauchbar für konkrete Fallbeispiele kritisiert. Die Arbeit setzt sich zum Ziel, das Anwendungspotenzial von Kants Philosophie aufzuzeigen.
Dieses Kapitel beleuchtet den kategorischen Imperativ als grundlegendes Moralprinzip in Kants Philosophie. Es wird von hypothetischen Imperativen abgegrenzt und die Bedeutung von Unbedingtheit, Allgemeinheit und Gesetzmäßigkeit für die praktische Anwendung hervorgehoben.
Anhand von Beispielen wird gezeigt, wie Kants Maximen-Prüfung auf konkrete Fälle angewandt werden kann. Die drei Momente (Unbedingtheit, Allgemeinheit und Gesetzmäßigkeit) werden dabei im Detail betrachtet.
Dieses Kapitel untersucht die Realisierbarkeit der Ergebnisse einer Maximen-Prüfung in konkreten Situationen. Anhand von drei antiken Tugenden wird verdeutlicht, wie die Anwendung des kategorischen Imperativs in der Praxis aussehen kann.
Schlüsselwörter
Kategorischer Imperativ, Hypothetische Imperative, Maximen-Prüfung, praktische Philosophie, angewandte Ethik, Moralprinzip, Unbedingtheit, Allgemeinheit, Gesetzmäßigkeit, „Feinstruktur moralischer Phänomene“, utilitaristische Konzeptionen, „Nutzenmaximierung“.
- Quote paper
- BA Alexander Hölzl (Author), 2019, Anwendung des kategorischen Imperativs, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/512870