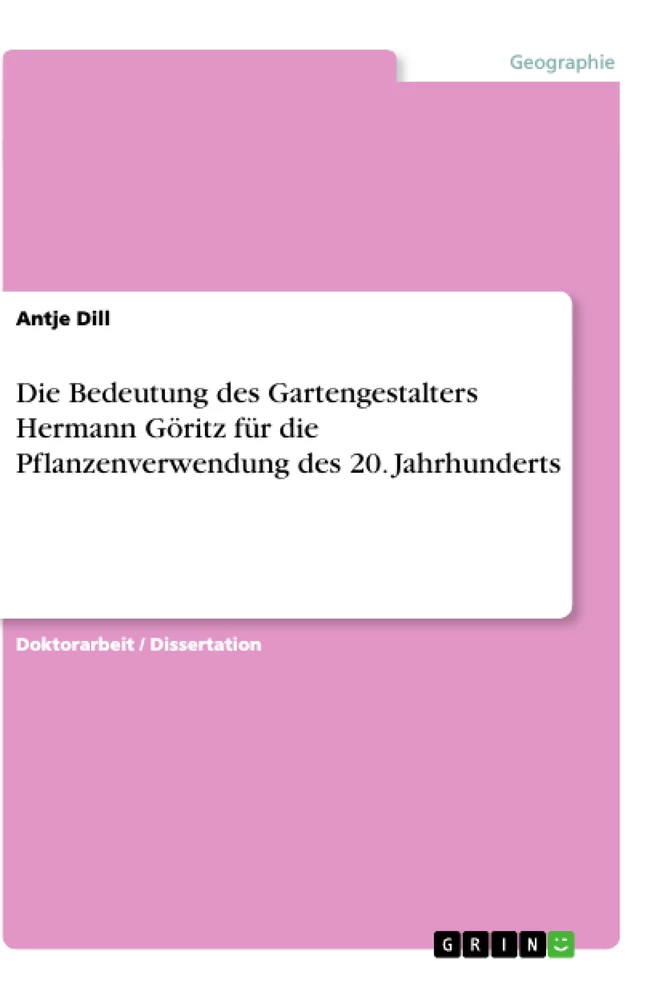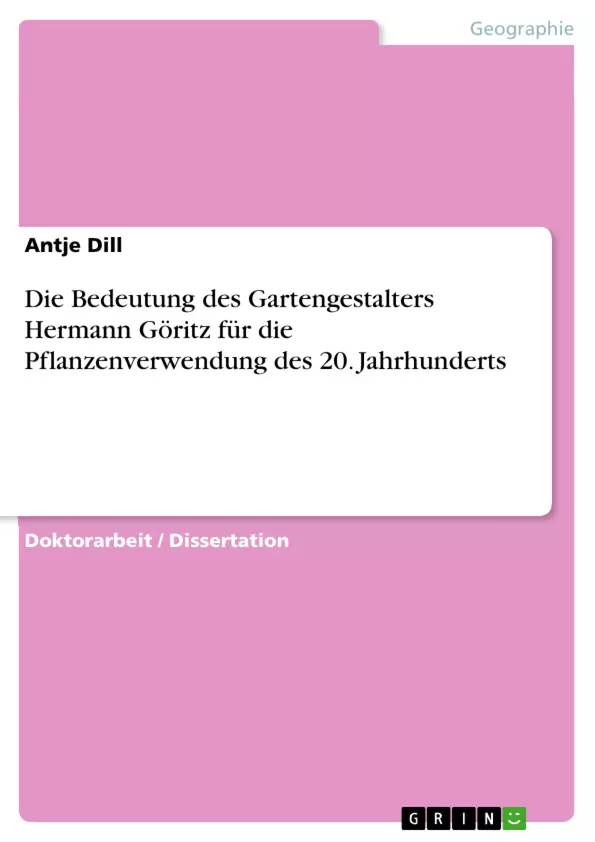Welche Einflüsse und Ideen machten Hermann Göritz zu dem was er geworden ist - ein anerkannter Pflanzenkenner, der als einziger freischaffender Landschaftsarchitekt in der DDR leben und arbeiten konnte.
Ausgehend von der Zeit des direkten Kontaktes mit Foerster, Mattern und Hammerbacher in den 1920er bis 1940er Jahren wird die Verknüpfung der Tätigkeit von Göritz mit diesen drei wesentlich bekannteren Gartenarchitekten untersucht. Dabei wird die sich daraus entwickelnde selbständige Arbeit Göritz aufgezeigt. Welche Themen bearbeitete er im Laufe seines Schaffens? Wie entwickelte er sich hinsichtlich seiner Gestaltungen?
Der Schwerpunkt der Untersuchungen liegt dabei nicht im steten Vergleich, sondern es wird herausgearbeitet, welchen eigenen Weg Göritz ging. Letztlich entsteht eine Gesamtschau des Werkes von Hermann Göritz. Resultierend wird festgestellt, welche Bedeutung die Arbeiten von Göritz heute noch haben - kann man von ihm heute noch lernen, welche Faszination geht von seinen Pflanzungen aus, wo kann man sie noch erleben?
Inhaltsverzeichnis
- Ziel und Hintergrund der Arbeit
- Methodik und Herangehensweise
- I. Hermann Göritz - Lebensdaten
- I.1. Kindheit | Schulzeit 1902-1920
- I.2 Berufsausbildung 1921-1927
- I.3 Tätigkeit 1927-1992
- II. Hermann Göritz und die Arbeitsgemeinschaft Forster-Mattern-Hammerbacher
- II. 0 Ziel, These und Methodik des Kapitels
- II.1 Bornimer Arbeitskreis
- II.1.1 Der Wohngarten zu Beginn des 20. Jahrhunderts - Darstellung der Situation
- II.1.2 Personen
- II.1.3 Philosophie
- II.1.4 Bornimer Stil
- II.1.5 Gestaltungsprinzipien - Mattern, Hammerbacher
- II.2 Stellung von Hermann Göritz innerhalb der Arbeitsgemeinschaft
- II.2.1 Auswahlkriterien
- II.2.2 Formensprache
- II.2.2.1 Mattern und Hammerbacher
- II.2.2.2 Göritz
- II.2.2.3 Vergleich Formensprache - Mattern, Hammerbacher mit Göritz
- II.2.3 Stauden
- II.2.3.1 Pflanzungstypen und Höhenstufen
- II.2.3.2 Kurzdarstellung der Pläne
- II.2.3.3 Farbkonzept - Blühfolgen - Pflanzen
- II.2.3.4 Ergebnis Stauden
- II.2.4 Gehölze
- II.2.4.1 Darstellung der Pläne mit Gehölzen
- II.2.4.2 Gehölzformen und ihre Verwendung
- II.2.4.3 Ergebnis Gehölze
- II.3. Diskussion - Die Rolle von Göritz bei der Arbeitsgemeinschaft FMH
- III. Hermann Göritz als Gestalter im öffentlichen Raum
- III. 0. Ziel, These und Methodik des Kapitels
- III.1 Wohnumfeldgestaltung
- III.1.1 Die Situation im Wohnungsbau in der DDR der 1950er-1970er Jahre
- III.1.2 Freiflächengestaltung im Wohnungsbau der 1950er-1970er Jahre
- III.1.2.1 Regelpflanzungen
- III.1.2.2 Stalinstadt - Eisenhüttenstadt
- III.2 Pflanzungen in öffentlichen Parks
- III.2.1 Gartenschauen - iga Erfurt
- III.2.1.1 Geschichte des Geländes
- III.2.1.2 Neuheiten und bewährte Stauden
- III.2.1.3 Foerster-Garten
- III.2.1.4 Garten der Rosaceen in Erfurt
- III.2.2 Weitere Projekte im öffentlichen Raum
- III.2.1 Gartenschauen - iga Erfurt
- III.3 Diskussion
- IV. Hermann Göritz als Gestalter privater Gärten
- IV. 0 Ziel, These und Methodik des Kapitels
- IV.1 Göritz Tätigkeit als Pflanzplaner nach 1945
- IV.2 Planauswahl
- IV.3 Formensprache
- IV.3.1 Formensprache der 50er Jahre
- IV.3.2 Formensprache der 60er Jahre
- IV.3.3 Formensprache der 70er Jahre
- IV.3.4 Formensprache der 80er Jahre
- IV.3.5 Zusammenfassung Formensprache
- IV.4 Staudenverwendung
- IV.4.1 Einteilung nach Lage und Funktion
- IV.4.1.1 Pflanzungen am Haus
- IV.4.1.2 Pflanzungen an der Terrasse
- IV.4.1.3 Grosse Staudenpflanzung
- IV.4.1.4 Sonderformen Rosenfeld und Preiss
- IV.4.2 Einteilung nach Standort
- IV.4.2.1 Steppe, Sandflur
- IV.4.2.2 Steingarten
- IV.4.2.3 Beet und frei gestaltete Fläche
- IV.4.2.4 Halbschatten und Schatten
- IV.4.2.5 Wasser, Sumpf und Ufer
- IV.4.3 Farben, Beetaufbau, Arten und Sorten in den Pflanzplänen von Hermann Göritz
- IV.4.3.1 Farben
- IV.4.3.2 Beetaufbau und Gestaltungsprinzipien
- IV.4.3.3 Arten und Sorten
- IV.4.3.4 Die Rolle der Gräser
- IV.4.1 Einteilung nach Lage und Funktion
- IV.5 Gehölzverwendung
- IV.5.1 Funktion und Struktur
- IV.5.1.1 Rahmen und Sichtschutz
- IV.5.1.2 Begleitung
- IV.5.1.3 Raumbildung
- IV.5.1.4 Abgrenzung
- IV.5.1 Funktion und Struktur
- IV.6 Bräuer und Petersen - Gegensätzliche Gestaltungen
- IV.7 Kombination von Gehölzen und Stauden
- IV.8 Gestalterische Ansätze von Hermann Göritz bei der Planung von Privatgärten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Leben und Werk des Garten- und Landschaftsarchitekten Hermann Göritz, insbesondere seine Bedeutung für die Pflanzenverwendung im 20. Jahrhundert. Sie beleuchtet seinen Werdegang, seine Zusammenarbeit mit bedeutenden Persönlichkeiten des Bornimer Kreises, und analysiert seine Planungen für private und öffentliche Gärten.
- Göritz' beruflicher Werdegang und seine Entwicklung als Pflanzenexperte
- Der Einfluss des Bornimer Stils auf Göritz' Werk
- Göritz' Gestaltungsprinzipien und -methoden in privaten Gärten
- Analyse von Göritz' Arbeit im öffentlichen Raum (Wohnumfeldgestaltung, Parks, Gartenschauen)
- Die Nachhaltigkeit und Bedeutung von Göritz' Werk für die heutige Gartenkunst
Zusammenfassung der Kapitel
Ziel und Hintergrund der Arbeit: Die Dissertation untersucht das Leben und Werk von Hermann Göritz, einem Landschaftsarchitekten, der trotz der politischen Einschränkungen in der DDR ein umfangreiches und vielseitiges Werk schuf. Die Arbeit zielt darauf ab, Göritz' Bedeutung als Pflanzenkenner und Gestalter herauszuarbeiten und sein Schaffen im Kontext der Gartenkunstgeschichte des 20. Jahrhunderts zu verorten.
Methodik und Herangehensweise: Die Arbeit basiert auf der Auswertung des Nachlasses von Hermann Göritz, der in der Staatsbibliothek zu Berlin aufbewahrt wird. Die Analyse der umfangreichen Dokumente und Pläne bildete die Grundlage für die Untersuchung seines Lebens und Schaffens. Die Arbeit fokussiert sich auf Göritz’ Planungen für private Gärten und öffentliche Anlagen, wobei eine detaillierte Betrachtung der Pflanzpläne im Mittelpunkt steht.
I. Hermann Göritz - Lebensdaten: Dieses Kapitel gibt einen chronologischen Überblick über Göritz' Leben, beginnend mit seiner Kindheit in Ostpreußen, seiner Ausbildung und den Stationen seiner beruflichen Laufbahn. Es werden die wichtigen Einflüsse und Begegnungen auf Göritz’ Leben und Werk beschrieben, besonders seine Zeit bei Karl Foerster und seine Arbeit in der Arbeitsgemeinschaft Forster-Mattern-Hammerbacher.
II. Hermann Göritz und die Arbeitsgemeinschaft Forster-Mattern-Hammerbacher: Dieses Kapitel untersucht Göritz' Rolle innerhalb der Arbeitsgemeinschaft Forster-Mattern-Hammerbacher, einem bedeutenden Kreis von Gartenarchitekten. Es analysiert Göritz’ Beitrag zum „Bornimer Stil“ durch die detaillierte Betrachtung und den Vergleich von Pflanzplänen, die er für die Arbeitsgemeinschaft erstellte. Es wird die Frage untersucht, inwieweit Göritz von dem Bornimer Stil beeinflusst wurde und welche eigenen Gestaltungsansätze er entwickelte.
III. Hermann Göritz als Gestalter im öffentlichen Raum: Dieses Kapitel widmet sich Göritz' Tätigkeit als Gestalter im öffentlichen Raum, mit einem Schwerpunkt auf Wohnumfeldgestaltung in der DDR und Pflanzungen auf Gartenschauen (IGA Erfurt). Es analysiert seine Planungsansätze für verschiedene öffentliche Räume, untersucht die verwendeten Pflanzen und Gestaltungselemente und bewertet die Bedeutung seiner Arbeit für die damalige Zeit.
IV. Hermann Göritz als Gestalter privater Gärten: Dieses Kapitel analysiert die Entwicklung von Göritz' Gestaltungsstil in privaten Gärten über die Jahrzehnte. Es untersucht die Veränderungen in seiner Formensprache, die Pflanzenauswahl und die Gestaltungsprinzipien, die in seinen Planungen zum Ausdruck kommen. Es wird der Vergleich zu den Gestaltungsmerkmalen des Bornimer Stils gezogen und Göritz' eigenständiger Beitrag zur Gartenkunst beleuchtet.
Schlüsselwörter
Hermann Göritz, Garten- und Landschaftsarchitektur, Bornimer Stil, Karl Foerster, Pflanzenverwendung, Stauden, Gehölze, Wohnumfeldgestaltung, Gartenschauen, DDR, Gartenplanung, Gestaltungsprinzipien, Pflanzenkenntnis, Rhythmus, Kontrast.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Dissertation: Hermann Göritz - Leben und Werk
Was ist der Gegenstand dieser Dissertation?
Die Dissertation untersucht das Leben und Werk des Garten- und Landschaftsarchitekten Hermann Göritz, insbesondere seine Bedeutung für die Pflanzenverwendung im 20. Jahrhundert. Sie beleuchtet seinen Werdegang, seine Zusammenarbeit mit bedeutenden Persönlichkeiten des Bornimer Kreises und analysiert seine Planungen für private und öffentliche Gärten.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit fokussiert sich auf Göritz' beruflichen Werdegang und seine Entwicklung als Pflanzenexperte, den Einfluss des Bornimer Stils auf sein Werk, seine Gestaltungsprinzipien und -methoden in privaten Gärten, die Analyse seiner Arbeit im öffentlichen Raum (Wohnumfeldgestaltung, Parks, Gartenschauen) und die Nachhaltigkeit und Bedeutung seines Werks für die heutige Gartenkunst.
Welche Methoden wurden angewendet?
Die Arbeit basiert auf der Auswertung des Nachlasses von Hermann Göritz in der Staatsbibliothek zu Berlin. Die Analyse der umfangreichen Dokumente und Pläne bildete die Grundlage für die Untersuchung seines Lebens und Schaffens. Der Fokus liegt auf Göritz’ Planungen für private Gärten und öffentliche Anlagen, wobei eine detaillierte Betrachtung der Pflanzpläne im Mittelpunkt steht.
Wie ist die Dissertation strukturiert?
Die Dissertation gliedert sich in vier Hauptkapitel: Kapitel I beschreibt Göritz' Lebensdaten; Kapitel II untersucht seine Rolle in der Arbeitsgemeinschaft Forster-Mattern-Hammerbacher; Kapitel III behandelt seine Arbeit im öffentlichen Raum; und Kapitel IV analysiert seine Gestaltung privater Gärten. Jedes Kapitel enthält eine Einleitung mit Zielsetzung und Methodik sowie eine abschließende Diskussion.
Welche Rolle spielte Hermann Göritz in der Arbeitsgemeinschaft Forster-Mattern-Hammerbacher?
Dieses Kapitel analysiert Göritz' Beitrag zum „Bornimer Stil“ durch den detaillierten Vergleich von Pflanzplänen, die er für die Arbeitsgemeinschaft erstellte. Es untersucht den Einfluss des Bornimer Stils auf Göritz und seine eigenen Gestaltungsansätze.
Wie ist Göritz' Arbeit im öffentlichen Raum charakterisiert?
Dieses Kapitel befasst sich mit Göritz' Tätigkeit in der Wohnumfeldgestaltung der DDR und Pflanzungen auf Gartenschauen (IGA Erfurt). Es analysiert seine Planungsansätze für öffentliche Räume, die verwendeten Pflanzen und Gestaltungselemente und bewertet die Bedeutung seiner Arbeit für die damalige Zeit.
Wie entwickelte sich Göritz' Gestaltungsstil in privaten Gärten?
Kapitel IV analysiert die Entwicklung von Göritz' Gestaltungsstil in privaten Gärten über die Jahrzehnte. Es untersucht die Veränderungen in seiner Formensprache, Pflanzenauswahl und Gestaltungsprinzipien und vergleicht diese mit den Merkmalen des Bornimer Stils, um Göritz' eigenständigen Beitrag herauszustellen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Dissertation?
Schlüsselwörter sind: Hermann Göritz, Garten- und Landschaftsarchitektur, Bornimer Stil, Karl Foerster, Pflanzenverwendung, Stauden, Gehölze, Wohnumfeldgestaltung, Gartenschauen, DDR, Gartenplanung, Gestaltungsprinzipien, Pflanzenkenntnis, Rhythmus, Kontrast.
Wo kann ich mehr über Hermann Göritz erfahren?
Die Dissertation bietet eine umfassende Darstellung von Göritz' Leben und Werk. Weitere Informationen könnten in Archiven (z.B. Staatsbibliothek zu Berlin) oder spezialisierten Publikationen zur Gartenkunstgeschichte zu finden sein.
- Citar trabajo
- Antje Dill (Autor), 2013, Die Bedeutung des Gartengestalters Hermann Göritz für die Pflanzenverwendung des 20. Jahrhunderts, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/512596